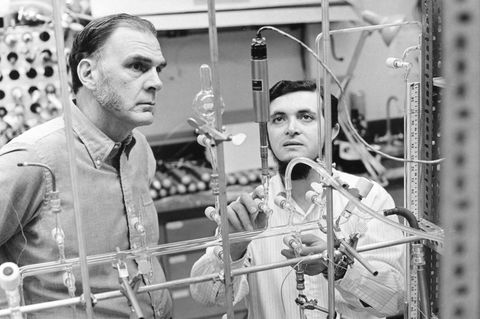GEO.de: Frau Neubauer, 14 Bundesländer schicken Einsatzkräfte zur Räumung Lützeraths, sie haben sich mit Wasserwerfern, Pferden und Hunden angekündigt – das volle Aufgebot. Woher nehmen Sie Ihre unerschütterliche Zuversicht, dass die zahlreichen Protestaktionen der vergangenen Monate und Jahre in letzter Minute doch noch Wirkung zeigen?
Luisa Neubauer: Wirkung zeigen sie schon längst. Immerhin sind fünf weitere umliegende Dörfer schon gerettet, die eigentlich zum heutigen Zeitpunkt dem Abriss geweiht sein sollten. Niemand hätte gedacht, dass die Räumung zu einem derart großen Thema werden würde. Politiker*innen und RWE hatten darauf spekuliert, dass wir den Ort leichtfertig hergeben. Wir aber sind noch da, zu Tausenden. Jede Person, die gerade über Lützerath spricht, die hinfährt, die protestiert, die Widerstand leistet, setzt ein ganz wichtiges Zeichen. Das ist nach langen Kämpfen ein Erfolg, der Hoffnung macht.
Lützerath – die Ruhe vor dem Sturm

Lützerath – die Ruhe vor dem Sturm
Haben frühere Protestaktionen wie die um den Hambacher Wald dazu beigetragen, aus dem Erfolgsgedächtnis zu schöpfen und mit Zuversicht im Widerstand zu bleiben?
Auf jeden Fall. Erfolge wie die um den Hambacher Wald machen es für die Regierung aufwendig, die Klimabewegung zu unterschätzen. Oder denken wir an Fridays for Future. Es war so unwahrscheinlich wie unerwartet, dass diese Form der Jugendklimabewegung nachhaltig Bestand haben würde. Wir haben gezeigt, dass wir es ernst meinen. Erfolg kann aber auch trügerisch sein. Wir tendieren dazu, ihn nur dort zu sehen, wo er gut vermarktet wird. Viele Erfolge aber sind subtil und kaum bis gar nicht messbar.
Zum Beispiel?
Wenn in vielen großen Städten öffentlicher Nahverkehr auf einmal günstig wird. Wenn Menschen aus sich heraus entscheiden, Solaranlagen zu installieren. Wenn der Druck steigt, soziale Standards in der Energiewende zu erhöhen. Das alles sind Aspekte, die oftmals unter dem Radar laufen.
Die Klimabewegung bezeichnet Lützerath als 1,5-Grad-Grenze. Um die 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klimaschutzabkommens nicht zu reißen, dürfe – so der Appell – unter dem Dorf keine weitere Kohle zutage gefördert werden. Wie realistisch ist denn das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch?
Es steht auf jeden Fall zur Disposition. Es wird sehr, sehr schwer werden, unsere internationalen Zusagen noch einzuhalten – vielleicht unmöglich. Die Regierung steht damit unter gewaltigem Druck, Lösungen zu präsentieren. Die gibt es bisher nicht einmal in Ansätzen. Das besorgt uns natürlich extrem.
Apropos Sorge: Warum sind wir als Gesamtgesellschaft nicht besorgter? Sind wir katastrophengesättigt?
Die Besorgnis ist, glaube ich, relativ groß. Was aber macht man mit einer Sorge, die einen in die eigene Ohnmacht treibt? Wer aus einer Sorge heraus nichts machen kann, sieht weniger die Ursprünge der Sorge als die Sorge selbst als Problem. Dann gucken Menschen weg und reden sich erfolgreich ein, dass alles nur halb so schlimm ist und sie als Einzelperson ohnehin nichts tun können. Deswegen kann es in der Klimafrage nicht allein darum gehen, über die Krise zu informieren. Entscheidend ist es, die Menschen zu inspirieren, zu motivieren und schließlich zum Handeln anzustiften.
Wie kann das in unserer krisengeschüttelten Zeit gelingen? Wo sehen Sie den Hebel der Veränderung?
Jetzt geht es in erster Linie um eine Aktivierung hinsichtlich so gewichtiger Fragen wie die der Energie- und Verkehrswende. Die Parteien stellen immer wieder zur Schau, dass sie nur ein begrenztes Interesse daran haben, ihren Versprechen gerecht zu werden. Also müssen wir den Schutz des Klimas auch unabhängiger von den Parteien erkämpfen. Wir leben in einer Zeit, in der wir nicht mehr in Ruhe auf eine Regierung warten können, die sich nicht genügend einbringt. Das führt zu einem treibenden Aktivismus, der Tatsachen schafft. Wir packen es an und werden entscheidende Wenden selbst gestalten.
In letzter Zeit mehren sich kritische Stimmen zu politischen Protestformen wie die der Letzten Generation. Deren neue Aktionsformate stoßen bei vielen auf Widerstand. Ist das strategisch noch zielführend oder verliert die Klimabewegung damit die Unterstützung der breiten Bevölkerung?
Ich glaube nicht, dass jede Bewegung sich als Ziel setzen muss, Zuspruch von der breiten Bevölkerung zu bekommen. Entscheidend ist es, dass man innerhalb der Bewegung und auch über die Bewegung hinausgehend Arbeitsteilung betreibt. Einige Organisationen beschäftigen sich dezidiert mit der Gewinnung und Überzeugung von Mehrheiten und platzieren wichtige Themen in der sogenannten Mitte der Gesellschaft, andere wiederum produzieren ein Dringlichkeitsbewusstsein und wieder andere führen ganz konkrete Kämpfe wie die in Lützerath. Warum sollte jede Bewegung auf die gleiche Art und Weise das Gleiche erreichen wollen? Unterm Strich kämpfen wir für dasselbe Ziel. Umso wichtiger ist es, dass wir das auf die vielfältigste Art und Weise tun. Fridays for Future, die Umweltorganisationen oder auch die Letzte Generation müssen da ein großes Spektrum abbilden, ihre Kräfte – wie aktuell in Lützerath – bündeln und dabei so innovativ sein wie nur irgend möglich.
Bleiben wir kurz bei der Letzten Generation, die als Protestform auch mit Erpressung arbeitet: Entweder wir bekommen ein Gespräch mit dem Kanzlerkandidaten oder wir hungern uns zu Tode. Entweder ihr führt ein Tempolimit und das 9-Euro-Ticket ein oder wir legen das Land lahm. Wie passt es in eine repräsentative Demokratie, dass eine Minderheit der breiten Bevölkerung etwas aufzwingen will?
Ich würde infrage stellen, ob wir hier von einem Aufzwingen sprechen sollten oder nicht vielmehr von einer Erinnerung an die Regierung und deren selbstgesteckten Ziele. Ob eine Partei den Weg des 9-Euro-Tickets begrüßt oder nicht, ist natürlich die Entscheidung der Partei, aber die Arbeitsverweigerung, die wir von Verkehrsminister Wissing nachgewiesener Weise erleben, ist doch die eigentliche Erpressung. Durch sein Nichthandeln befeuert er negative Klimaeffekte. Natürlich wäre eine derartige Methode völlig unangemessen und auch nicht zu rechtfertigen, wenn es darum ginge, eine Regierung willkürlich in eine dogmatische Richtung zu zwingen. Aber hier geht es darum, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, die unsere Lebensgrundlagen und unsere Zukunft schützen – was ja das selbsterklärte Ziel der Bundesregierung ist. Dafür wurde sie gewählt.
Einzelne Personen wie Sie oder auch Greta Thunberg sorgen dafür, dass Gruppen wie Fridays for Future weltweit wirkmächtig werden. Braucht es für die Klimabewegung Vorbildfiguren, beziehungsweise Klimaheld*innen?
Es ist ja etwas Menschliches, dass wir uns an anderen orientieren. Die Personen, die in irgendeiner Form repräsentativ sind, tendieren dazu, zusätzlich auch Identifikationsfigur zu sein. Wir Menschen sind Herdentiere und damit können wir arbeiten. Niemand sollte sich aber davon einschränken lassen, weil man meint, den Personen nicht entsprechen zu können, die man aus dem Fernsehen oder aus dem Internet kennt. Das führt nur zu Handlungsunfähigkeit.
Sie haben gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland kürzlich gesagt, dass Ihnen eine ökologische Oppositionspartei fehle. Ist es an der Zeit, das zu ändern und in die Politik zu gehen?
Die Frage stellt sich zurzeit gar nicht. Ich finde es befremdlich, wie selbstverständlich davon gesprochen wird, dass man in die Politik aufsteigt. Stattdessen sollten wir die Verantwortung, die jetzt schon von vielen Menschen in diesem Land übernommen wird, als einen mindestens ebenbürtigen elementaren Beitrag sehen. Demokratie heißt ja auch, dass es eine Zivilgesellschaft gibt, die sich organisiert. Im Moment mangelt es an Politiker*innen, die die Politik umsetzen, die sie versprochen haben. Die Versprechen aber sind ja schon da. Was es jetzt braucht, ist der Druck der Öffentlichkeit.
Welche Protestformen wünschen Sie sich dahingehend für die Zukunft der Klimabewegung?
Das, was wir in der Zukunft brauchen, leben wir schon heute vielfach. Im besten Fall werden wir darüber hinaus besser darin, uns international zu organisieren und solidarisch füreinander einzustehen. Wir sehen ja gerade, wie erfolgreich Allianzen sein können. Das hat eine unglaubliche Macht entfaltet. Wie sich die Kräfte kanalisieren lassen, erleben wir gerade unter anderem in Lützerath. Davon werden wir auch in Zukunft mehr sehen.