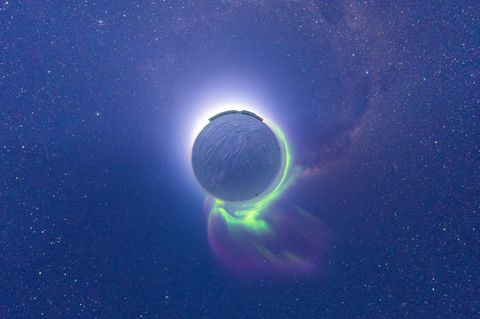Vor einigen Jahren setzte sich der britische Bildungsforscher Harry Dyer freiwillig, im Dienst der Wissenschaft, einer ziemlich surrealen Situation aus: Er besuchte die erste britische Zusammenkunft von Flat Earthers, Menschen also, die überzeugt sind, die Erde sei eine Scheibe.
Er wollte herausfinden, wer diese Menschen sind, was sie antreibt. Und natürlich auch, wie man sie davon überzeugen könnte, dass die Sache mit der flachen Erde offensichtlicher Nonsens ist. In einem Interview antwortete er: "Am besten wäre es, ihnen etwas zu zeigen, das beweist, dass die Erde nicht flach ist. Leider habe ich nicht das Geld, um jeden von ihnen ins All zu schicken. Aber vielleicht wäre es ein Schritt in diese Richtung, ihnen einen Raketenstart zu zeigen."
Nun gebührt Dyer alle Achtung vor dem masochistisch anmutenden Unterfangen, stundenlang Verschwörungstheoretikern zuzuhören. Aber seine Schlussfolgerungen greifen zu kurz. Denn kein Raketenstart würde einen eingefleischten Flat Earther von seiner Überzeugung abbringen – schon gar nicht, wenn der im "Staatsfernsehen" gezeigt wird. Das ist ja gerade das Verstörende, dass Verschwörungstheoretiker Fakten, Beweise, Belege und Plausibilitäten gelassen ignorieren.
Die Frage, warum sie das tun, versuchte jüngst ein kalifornisches Forschungsteam zu beantworten. Die Ergebnisse der Studie wirken zunächst irritierend.
Je leichter eine These zu widerlegen ist, desto attraktiver ist sie
Das Team hat Fragebögen zur Covid-19-Pandemie ausgewertet und kommt zu dem Ergebnis: Die Zustimmung zu Falschbehauptungen, zum Beispiel, dass 5G-Strahlung die Pandemie verursacht habe, ist umso größer, je mehr symbolische Stärke die Befragten daraus ziehen. Es zählt also nicht der Wahrheitsgehalt einer Aussage – Zustimmung oder Ablehnung werden als Akte des Widerstands oder des Nachgebens interpretiert. Wer Falschinformationen zum Virus oder zur Impfung zustimmt, signalisiert dem "Gegner", in diesem Fall dem Staat und der Wissenschaft, Stärke und Unabhängigkeit.
Anders gesagt: Je absurder eine These, desto verlockender ist es für manche Menschen, ihr zuzustimmen: Die Unglaubwürdigkeit einer Aussage korreliert direkt mit der durch die Zustimmung gewonnenen "Stärke".
Zwar betonen die Autoren der Studie, dass es sich dabei um eine extreme Haltung handle, die nicht die Mehrheit der Befragten repräsentiere. Und auch Harry Dyer hält die Flat Earthers eher für eine marginale Bevölkerungsgruppe. Doch Randerscheinungen sind nicht unbedeutend. Sie verraten immer auch etwas über die Mitte, deren Rand sie bilden. Zu Recht weist Dyer darauf hin, dass Theoretiker wie Michel Foucault ihre soziologischen Analysen des 20. Jahrhunderts auf die Betrachtung von gesellschaftlichen Randgruppen stützen.
Psychologische Gründe, Wissenschaft in Frage zu stellen, gibt es viele. Einer davon ist offenbar die Sehnsucht nach Stärke, und sei sie auch nur symbolisch. Wir müssen uns der Erkenntnis stellen, dass die Berufung auf unumstößliche, handlungsleitende Fakten ("Listen to the science!") an manchen Menschen abprallt. Dass Faktenchecks als Zeichen der Schwäche aufgefasst werden. Dass Menschen irrational sein können, wenn sie glauben, es nütze ihnen. Dass das Versprechen von "Stärke" in einer ins Wanken geratenen Welt die eigenen Überzeugungen, das eigene Handeln stärker bestimmen kann als Zahlen und Fakten.
Wie sonst wäre es zu erklären, dass der mächtigste und machtgeilste Mann der USA ausgerechnet vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen behaupten konnte, der Klimawandel sei "der größte Betrug, der jemals an der Welt begangen wurde"?
Es ist kein Trost, hilft aber, sich klarzumachen: Wissenschaftsskepsis und -leugnung sind kein neues Phänomen: Der Satz "Credo, quia absurdum", "Ich glaube, (nicht obwohl, sondern) weil es widersinnig ist", ist Jahrhunderte alt. Schon zu Beginn des 3. Jahrhunderts verteidigte Tertullian die göttliche Abstammung und die Auferstehung Christi gegen die Zumutung einer rationalen, von Naturgesetzen bestimmten Welt. Und stiftete so: Gemeinschaft und Stärke.
Die These der Forschenden aus Kalifornien scheint auf den ersten Blick widersinnig. Leider ist sie – nicht darum, sondern trotzdem – glaubwürdig.