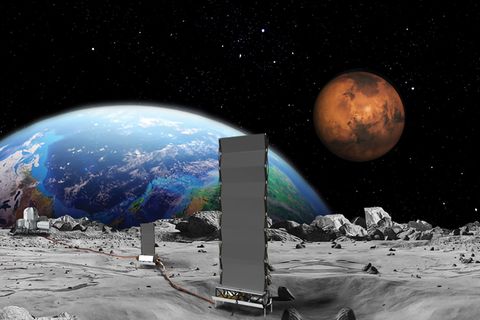Der Ursprung von allem liegt in der Tiefe des Raums: Wer es schafft, zu den weit entfernten Sichtgrenzen des Weltalls zu blicken, schaut in die weiteste Vergangenheit des Universums. Denn in der Beobachtung des Weltalls sind Raum und Zeit eng miteinander verwoben: Weil das Licht ferner Sterne Milliarden Jahre braucht, zu uns zu kommen, wird jedes Bild zu einem Bild einer Vergangenheit, die weit vor dem Anbeginn der Menschheit liegt.
Das muss verstehen, wer deuten will, was auf den Bildern zu sehen ist: Die Aufnahmen des James-Webb-Weltraumteleskops sind Zeitreisen. Wir blicken mal Tausende, mal Millionen Jahre in die Vergangenheit, und manche Sterne, deren Strahlung von den superempfindlichen Messinstrumenten der Apparatur heute aufgezeichnet wird, waren möglicherweise längst verglüht, als unsere Sonne entstand, vor gut viereinhalb Milliarden Jahren.
Das James Webb Space Telescope (JWST) ist das teuerste und komplexeste Forschungsgerät, das die Menschheit jemals ins All geschossen hat. Es wurde als Nachfolger des in die Jahre gekommenen Hubble-Weltraumteleskops geplant und sollte eigentlich bereits 2007 erste Bilder senden; eine Milliarde US-Dollar Budget waren dafür eingeplant. Als es an Weihnachten 2021 endlich abhob, also 14 Jahre zu spät, hatte der Bau etwa zehn Milliarden US-Dollar verschlungen: zehnmal mehr als geplant und mehr als doppelt so viel wie der LHC-Teilchenbeschleuniger in Genf.
Eine Welt vor unserer Zeit: Spektakuläre Aufnahmen des James-Webb-Weltraumteleskops

Eine Welt vor unserer Zeit: Spektakuläre Aufnahmen des James-Webb-Weltraumteleskops
Eine teure Fracht, die da, zusammengefaltet wie ein Schmetterling in seiner Puppe, an Bord einer Ariane-5-Rakete mithilfe von 670 Tonnen Treibstoff ins All geschossen wurde. Als der Apparat die Rakete hinter sich gelassen hatte, war das Zittern in den Bodenstationen von Nasa, Esa und der kanadischen Raumfahrtbehörde CSA noch längst nicht zu Ende: Die Berechnungen hatten ergeben, dass es entlang der einmonatigen Reise des James-Webb-Weltraumteleskops zu seinem Parkplatz im All mehr als 300 Punkte gab, an denen das Projekt unwiederbringlich scheitern könnte. Doch nichts ging schief: Sonnenschild, Haupt- und Sekundärspiegel entfalteten sich perfekt, und seit Anfang Februar 2022 sendet das Teleskop erste Bilder zur Erde. Eine Meisterleistung der Wissenschaft und der Ingenieurskunst.
Haben sich der Aufwand und das Risiko gelohnt? Die Auswertung der ersten Aufnahmen macht Forschenden große Hoffnung. Ihr Ziel war es, weiter als je zuvor in die Vergangenheit zu schauen, in die Frühzeit unseres Universums, tief in die verborgenen Geburtsstätten junger Sterne und in die Atmosphären fremder Planeten.
Infrarotkameras suchen nach dem ersten Leuchten im Universum
Der Beobachtungsposten des James-Webb-Weltraumteleskops ist der "Lagrange-Punkt 2", ein Ort in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde, wo sich die Anziehungskräfte von Sonne und Erde gegenseitig aufheben. Auf diese Weise von den Schwerkräften der beiden Himmelskörper stabilisiert, suchen die Infrarotkameras an Bord nach dem ersten Leuchten des Universums, von der Expansion des Raums ins Rote gestreckt. Denn während das Weltall sich ausdehnt, dehnt es auch das Licht zu immer größeren Wellenlängen. Je weiter das Licht zu uns unterwegs war und je länger es dafür gebraucht hat, desto stärker wurde es gestreckt, und desto röter erscheint es. Die älteste bisher bekannte Galaxie hatte das Vorgängerteleskop Hubble im Jahr 2016 gefunden: Sie ist so weit entfernt, dass wir sie 400 Millionen Jahre nach dem Urknall sehen. Nun haben Forschende auf den ersten Bildern des James-Webb-Weltraumteleskops aber bereits mehrere Galaxien ausgemacht, die älter zu sein scheinen als alles je zuvor Gesehene.
Im Dezember lieferte ein internationales Forschungsteam um Brant Robertson von der University of California, Santa Cruz, dann auch Beweise für das Alter der neu entdeckten Sterne. Als sie die spektrale Zusammensetzung des Lichts zweier Galaxien analysierten, stießen sie auf JADES-GS-z13-0, annähernd 13,5 Milliarden Jahre alt, also rund 325 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden.
Weitere uralte Galaxien werden derzeit spektroskopischen Untersuchungen unterzogen. Was auffällt: Sie sind häufiger, größer und heller, als Forschende es erwartet hätten. Nun sucht die Wissenschaft nach Erklärungen dafür. Vielleicht wuchsen die Ansammlungen Dunkler Materie, deren Schwerkraft einst die gewöhnliche Materie zu Galaxien sammelte, schneller als gedacht. Das wäre ein Hinweis, dass bei Dunkler Materie neben der Gravitation noch andere, bislang unbekannte Formen der Wechselwirkung herrschen. Vielleicht zogen die Galaxienkeime aber auch mehr Materie an, und es entstanden mehr Sterne.
Vielleicht sind es aber auch gar nicht mehr, sondern bloß hellere Sterne. Schon lange vermuten Astronominnen und Astronomen, dass diese frühen Sterne im Universum zur "Population III" gehörten: Sterne, die keine schweren Elemente enthalten und nahezu nur aus Wasserstoff und Helium bestehen. Dadurch konnten sie unglaublich heiß werden und zu gigantischer Größe anwachsen, 100- oder sogar 1000-fach massereicher als unsere Sonne. Beobachtet wurden solche Ur-Sterne bisher wohl noch nie; auch deshalb wollen Forschende weitere Spektren aufzeichnen, in denen die chemische Zusammensetzung der Sterne sichtbar werden könnte.
Aus der jüngeren Vergangenheit liefert das James-Webb-Weltraumteleskop ebenfalls beeindruckende Bilder. Dank seiner Infrarotsensoren empfängt es Signale auch jenseits des sichtbaren Lichts, das meist durch Staubwolken abgefangen wird. Denn während Staub kurzwelliges blaues Licht besonders stark streut und reflektiert, lässt es langwellige Infrarotstrahlung durch. Und so sind viele der beeindruckendsten Bilder Kinderfotos von Sternen: Sie wachsen aus Gas und Staub, sodass Gebiete, in denen junge Sterne entstehen, oft verhüllt sind. Die neuen, detaillierten und hochaufgelösten Einblicke in diese Regionen sollen helfen zu verstehen, wie sich dort Gas und Staub zu Sternen verdichten.
Auch auf der Suche nach Exoplaneten, also Planeten jenseits unseres Sonnensystems, soll das Teleskop helfen. Der Spektrograf an Bord des JWST wies bereits Wasserdampf in der Atmosphäre von WASP-96b und Kohlenstoffdioxid auf WASP-39b nach, zwei ultraheißen Gasriesen. Nun suchen Forschende auch auf womöglich erdähnlichen Himmelskörpern nach Wasser. Etwa in TRAPPIST-1, einem System mit sieben Gesteinsplaneten, die einen kleinen kühlen Stern so eng umkreisen, dass sie allesamt in den Orbit des sonnennächsten Planeten Merkur passen würden. Drei von ihnen liegen in der bewohnbaren Zone, wo fließendes Wasser möglich ist. Erste Testaufnahmen bestätigen, dass das Teleskop prinzipiell wohl imstande wäre, Atmosphären um die Planeten zu entdecken. Auswertbare Ergebnisse werden jedoch noch einige Zeit kosten.
In der Zwischenzeit lassen sich immerhin die Planeten im Sonnensystem im Detail betrachten, darunter Jupiter, die Ringe Neptuns oder Wolken auf dem Saturnmond Titan. Und Forschende können sich mit ihren Projekten auf Beobachtungszeit im zweiten Jahr des JWST bewerben, das im Juli beginnt. Denn was wir bislang gesehen haben, war nur der Beginn – ein erstes Austesten der Möglichkeiten, die das neue Teleskop bietet.