Wenn wir uns im Spiegel betrachten, erblicken wir eine Person, die uns seit Jahren vertraut ist, die wir aber nur selbst in dieser Form kennen: unser seitenverkehrtes Ich. Die Haare fallen scheinbar "richtig", kleine Asymmetrien wirken stimmig, der Blick wirkt gewohnt und selbstverständlich. Oft sind wir dann allerdings überrascht, irritiert, fühlen uns gar abgestoßen, wenn wir ein Foto von uns sehen: dasselbe Gesicht zwar, doch auf der Aufnahme erscheint es ungewohnt, nicht mehr so harmonisch. Plötzlich scheint die Nase schiefer, das Lächeln schräg, der Scheitel auf der falschen Seite, der Ausdruck härter. Woher rührt dieses Gefühl der Irritation?
Eine nüchterne Antwort lautet: Gewöhnung. Psychologinnen nennen das Phänomen den Mere-Exposure-Effekt – also die Beobachtung, dass allein die wiederholte Begegnung mit einem Reiz dazu führt, dass wir ihn positiver bewerten. Weil wir uns fast ausschließlich als gespiegelte Version sehen, gefällt uns genau diese Variante von uns selbst am besten; die Kamera zeigt hingegen die für uns ungewohnte. Für andere ist es freilich umgekehrt: Sie kennen uns nur so, wie die Kamera uns zeigt – und finden genau diese Ansicht meist attraktiver. Dieser Effekt erklärt, warum wir unsere reflektierte Erscheinung oft mögen, fotografische Aufnahmen jedoch kritisch beäugen.
Ein besonders anschauliches Beispiel für dieses Prinzip liefert der digitale Alltag. In Programmen wie Teams oder Zoom sehen wir uns standardmäßig ebenfalls seitenverkehrt – so, wie wir es von unserem Badezimmer- oder Garderobenspiegel kennen. Für die anderen erscheint das Bild jedoch ungespiegelt. Wer einmal die Funktion deaktiviert hat, kennt das unangenehme Gefühl: Plötzlich wirkt das eigene Gesicht seltsam, beinahe verdreht. Dass die Voreinstellung auf Spiegelung gesetzt ist, kommt also nicht von ungefähr. Sie soll uns das gewohnte Bild liefern und damit die Irritation vermeiden.
Die Wirkung zeigt sich nicht bloß bei Gesichtern, sondern auch bei Melodien
Der Mere-Exposure-Effekt offenbart einen simplen, aber grundlegenden und weitreichenden Mechanismus emotionaler Bewertung: Vertrautheit schafft Sympathie. Unser Gesicht ist nur ein Beispiel. Denn ganz gleich, ob es sich um einen Menschen oder bloß um einen Namen handelt, um ein Bild oder einen Klang: Je häufiger wir ihm begegnen, desto positiver bewerten wir ihn – selbst dann, wenn wir ihn kaum bewusst wahrnehmen.
Die Wirkung lässt sich im Alltag überall beobachten. Ein Lied, das uns beim ersten Hören kaltlässt, wirkt nach dem dritten oder vierten Mal plötzlich eingängig. Ein Logo, das uns ständig begegnet, bleibt im Gedächtnis, wirkt vertraut – nicht zuletzt, weil wir oftmals, ohne darüber nachzudenken, wissen, wofür es steht. So erscheint es uns nicht fremd, sondern geradezu vertraut. Ähnlich geht es uns mit Menschen, denen wir regelmäßig über den Weg laufen: Kolleginnen im Büro, Nachbarn im Treppenhaus, Menschen, die zur gleichen Zeit den gleichen Bus zur Arbeit nehmen. Sie alle erscheinen uns mit der Zeit sympathischer, ganz ohne intensiven Kontakt.
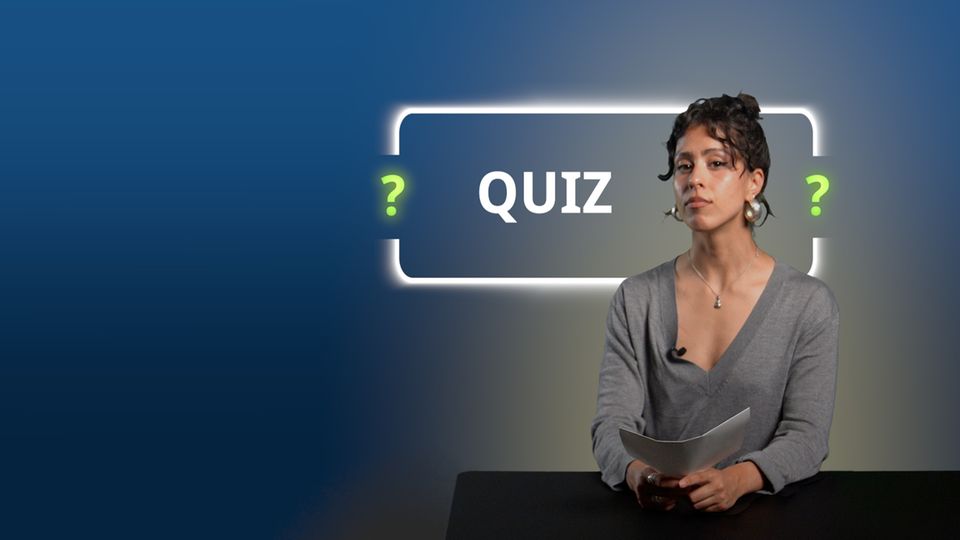
Das Prinzip ist erstaunlich robust. Es funktioniert bei einfachen Silben ebenso wie bei komplexen Kunstwerken, bei abstrakten Formen ebenso wie bei Tieren. Entscheidend ist allein die Wiederholung: Was wir kennen, löst weniger Unsicherheit aus, wirkt einschätzbarer – und damit angenehmer. Der Mere-Exposure-Effekt ist gewissermaßen das psychologische Grundrauschen unseres ästhetischen Urteils: Er lenkt unsere Vorlieben leise, aber stetig.
Aus einem einfachen Experiment erwuchs eine weitreichende Theorie
Robert Zajonc, ein polnisch-amerikanischer Psychologe, war es, der den Effekt in den 1960er-Jahren systematisch untersuchte. Er ließ Versuchspersonen Kunstwörter, chinesische Schriftzeichen oder Gesichter sehen – mal nur ein einziges Mal, mal in häufiger Wiederholung. Das verblüffende Ergebnis: Selbst wenn die Teilnehmenden die Zeichen nicht verstanden, fanden sie jene angenehmer, die sie häufiger gesehen hatten. Aus dieser schlichten Versuchsanordnung erwuchs letztlich eine einflussreiche Theorie der modernen Psychologie: Wiederholung prägt unser Urteil stärker, als wir ahnen. Spätere Studien bestätigten, dass der Effekt nahezu universell wirkt – ob bei Musik, Architektur oder sogar bei politischen Botschaften.
So erklärt sich auch unser Zögern vor der Kamera. Wir sind unser Spiegelbild gewohnt, in all seinen Eigenheiten. Ein Foto dagegen zeigt die "andere" Version unseres Gesichts – und konfrontiert uns mit einer Perspektive, die wir kaum kennen. Dazu kommt, dass Fotos uns häufig aus Winkeln zeigen, die wir selbst gar nicht kennen: von der Seite, im Profil, beim Sprechen oder von schräg hinten. Vor dem Spiegel dagegen sehen wir uns fast ausschließlich frontal – was die Irritation auf Fotos noch verstärkt.
Besonders anschaulich wird der Mechanismus in der Musik. Der Refrain eines Liedes, die Hookline eines Popsongs – sie sind nichts anderes als kalkulierte Wiederholungen. Anfangs vielleicht unscheinbar, werden sie mit jeder Wiederkehr vertrauter, bis sie sich als Ohrwurm festsetzen. Der Effekt, der unser Alltagsbild sympathisch erscheinen lässt, sorgt also auch dafür, dass wir Melodien lieben lernen.
Es ist eine Gratwanderung zwischen Vertrautem und Unbekanntem
Doch Vertrautheit hat ihre Grenzen. Hören wir einen Song zu oft, schlägt Zuneigung in Langeweile um. Auch Bilder oder Werbespots, die wir zu häufig sehen, verlieren ihren Reiz. Die Psychologie kennt dafür ein Gegenstück: den Neuigkeitseffekt. Manchmal steigert gerade das Unerwartete, das noch nicht Vertraute, unsere Aufmerksamkeit und Faszination. Zwischen diesen Polen – dem Bekannten, das beruhigt, und dem Neuen, das lockt – bewegen sich unsere Vorlieben.
Am Ende bleibt die Erkenntnis: Schönheit ist nicht nur eine Frage der Proportionen oder der Symmetrie, sondern auch der Gewöhnung. Was wir oft sehen, gefällt uns besser. Und vielleicht lohnt es sich, beim nächsten kritischen Blick auf eine Fotografie daran zu denken: Für andere Menschen ist die Version unseres Gesichts eben nicht irritierend, sondern das, was sie kennen – und vielleicht sogar: schön.






























