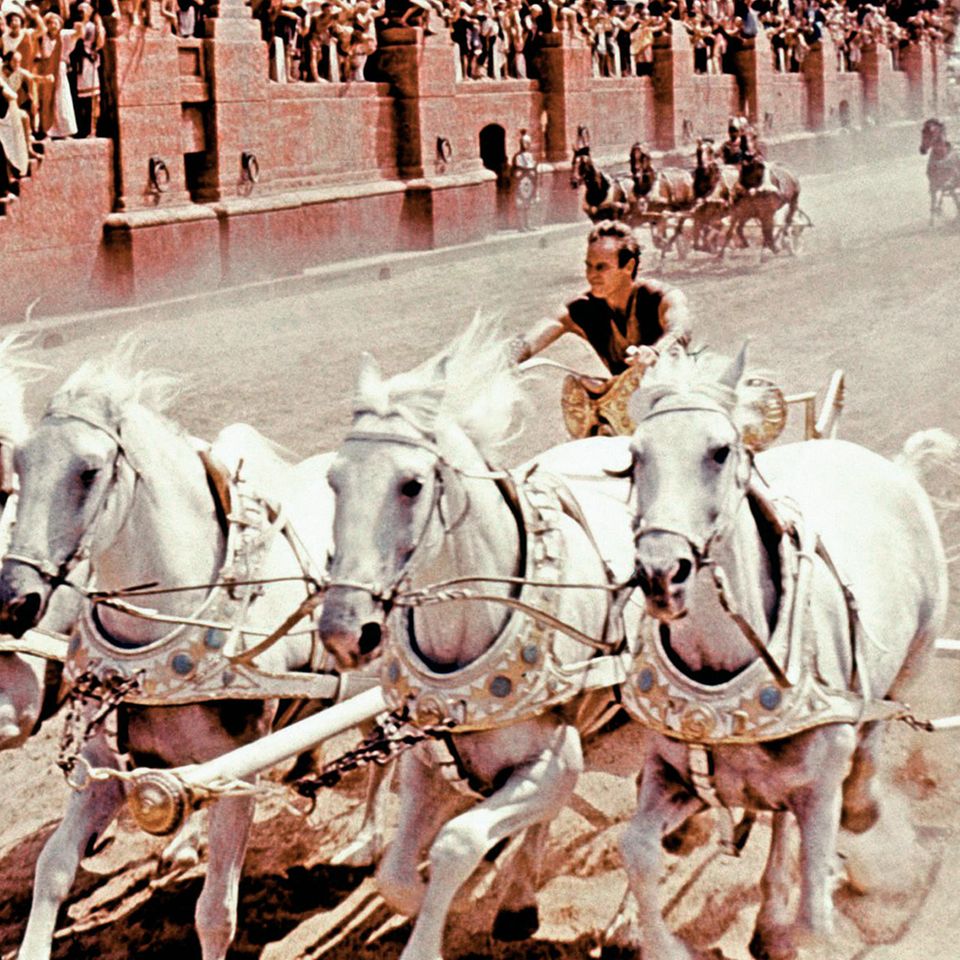In Ablagerungen an einem Keramiktopf aus der Römerzeit haben Wissenschaftler Eier des Peitschenwurms gefunden. Sie sehen den Nachweis des Darmparasiten als Bestätigung dafür, dass der Topf seinerzeit menschliche Fäkalien enthielt und die Römer mithin solche Gefäße als Nachttöpfe nutzten. Diese Annahme sei zuvor nur unzureichend belegt gewesen, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Journal of Archaeological Science: Reports.
"Konische Töpfe dieses Typs sind im Römischen Reich recht weit verbreitet und wurden in Ermangelung anderer Beweise oft als Vorratsgefäße bezeichnet", sagt Ko-Autor Roger Wilson laut einer Mitteilung. "Die Entdeckung vieler dieser Gefäße in oder in der Nähe von öffentlichen Latrinen hatte zu der Vermutung geführt, dass sie als Nachttöpfe verwendet worden sein könnten, aber bis jetzt fehlte der Beweis."
Das Team um Studienleiter Piers Mitchell von der University of Cambridge hatte ein Gefäß untersucht, das auf der italienischen Insel Sizilien gefunden wurde, im Badehaus eines größeren Gebäudekomplexes. Es stammt den Forschern zufolge aus dem 5. Jahrhundert, ist 31,8 Zentimeter hoch und hat am oberen Rand einen Durchmesser von 34 Zentimeter. Außen verlaufen zwei dekorative Wellenlinien. Am Boden und am Rand fanden die Experten harte, mineralisierte Ablagerungen. Vier weitere, ähnliche Gefäße wiesen diese Spuren nicht auf.
Eier des Peitschenwurms belegen bisherige Annahmen
Die Wissenschaftler lösten die Ablagerungen und erhielten durch die Zugabe verdünnter Salzsäure und wiederholtes Zentrifugieren der Probe ein cremiges, gelbes Sediment-Kügelchen. Als sie das verdünnten und unter dem Mikroskop untersuchten, fanden sie insgesamt acht Eier des Peitschenwurms Trichuris trichuria. Diese bis zu fünf Zentimeter langen Parasiten leben im Darm infizierter Menschen. Ihre Eier werden mit dem Kot ausgeschieden und können über verunreinigtes Wasser oder Lebensmittel in den nächsten Menschen gelangen. Die Eier der Parasiten sind von einer Chitin-Schicht geschützt und können so Jahrhunderte überdauern.
"Dieser Topf stammt aus dem Bäderkomplex einer römischen Villa", sagt Mitchell. "Es ist wahrscheinlich, dass die Besucher der Thermen diesen Nachttopf benutzten, wenn sie auf die Toilette gehen wollten, denn die Thermen verfügten über keine eigene Latrine. Bequemlichkeit war ihnen offensichtlich wichtig." Die Forscher schreiben, dass die Nutzer womöglich direkt auf dem Gefäß gesessen haben, vermutlich sei es aber als Teil eines Flechtwerks oder Holzstuhls genutzt worden. Eine spätere Verunreinigung des Topfes mit Peitschenwurm-Eiern halten sie für unwahrscheinlich, weil diese fest in den Ablagerungen eingeschlossen waren.
Keramikgefäße, die in Museen ausgestellt würden und ähnliche Ablagerungen enthielten, könnten auf Wurmeier untersucht werden, um zu prüfen, ob sie auch als Nachttöpfe genutzt wurden, schreiben die Forscher. Allerdings belege die Abwesenheit von Parasiten nicht, dass die Gefäße nicht als Nachttöpfe genutzt wurden. Schließlich könnten die Nutzer einfach frei von Würmern gewesen sein.