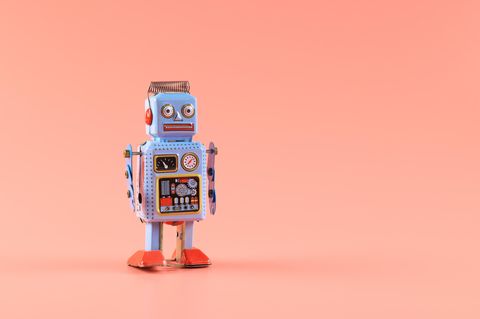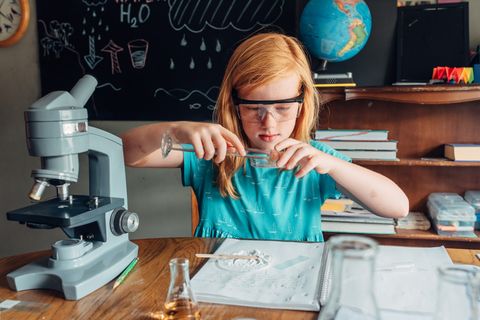Gargalesis sei eine der "mysteriösesten menschlichen Verhaltensweisen", schreibt die griechische Forscherin Konstantina Kilteni über ihr Spezialgebiet. Ja, sie zähle zu den "größten ungelösten Rätseln der Neurowissenschaften". Dabei bezeichnet der sperrige Fachbegriff etwas sehr Banales: Kitzeln. Nicht das sanfte Kribbeln, wenn Federn oder Fingerspitzen unsere Haut streicheln oder eine Fliege sich durch die Körperbehaarung kämpft. Sondern das heftige Kitzeln, wenn jemand unsere Fußsohlen krault oder seine Finger wiederholt in unsere Achselhöhlen bohrt. Viele von uns müssen dann lachen, unabhängig davon, ob das Gekitzeltwerden ein Spaß oder eine Qual ist. Mit einer Ausnahme: Sind die bohrenden Finger unsere eigenen, bleibt das Gefühl aus.
Warum können wir uns selbst nicht kitzeln? Welchen Zweck erfüllt Kitzeln überhaupt? Warum sind nicht alle Menschen und Körperregionen gleich empfindlich? Forschende wissen erstaunlich wenig über diese Fragen – und das, obwohl sich schon große Geister wie Aristoteles, Galileo Galilei und René Descartes Gedanken darüber machten. Charles Darwin sah im Kitzeln gar den Vorläufer des Humors. Schließlich lösen beide Phänomene ähnliche Reaktionen aus: Wir lachen, wir krümmen uns, wir bekommen eine Gänsehaut. Ein guter Witz, so glaubte Darwin, kitzele auf besondere Weise unseren Geist.
Gekitzelte Ratten kichern im Ultraschallbereich
Einiges deutet darauf hin, dass die Wurzeln der Gargalesis weit in unsere Entwicklungsgeschichte zurückreichen. Liebevolles Kitzeln bringt Babys schon mit wenigen Monaten zum Lachen. Es ist eine der ersten Interaktionen überhaupt, die ihnen zuverlässig freudiges Glucksen entlocken. Größere Kinder quietschen oft schon in bloßer Erwartung einer Kitzelattacke.
Die Reaktion ist nicht auf unsere Spezies beschränkt. Killern Forschende Ratten, kichern diese im Ultraschallbereich. Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans kitzeln sich sogar gegenseitig – und reagieren mit Lauten, die menschlichem Lachen ähneln.
Obwohl Kitzeln so weit verbreitet ist, muss die Forschung auf dem Weg zur Erkenntnis noch etliche Hürden nehmen. Erstens differenzierten Forschende in der Vergangenheit nicht sauber zwischen leichtem und kräftigem Kitzeln. Dabei aktivieren dezente Berührungen andere Rezeptoren in der Haut und rufen auch eine andere Reaktion hervor. Wir lachen nicht, sondern weichen instinktiv zurück, kratzen oder reiben die Hautstelle – vermutlich, um Parasiten und Schmutz loszuwerden.
Zweitens lässt sich Kitzeln in Laborsituationen schwer standardisieren. In vielen Versuchen wurden Studienteilnehmer von Menschen gekitzelt, die ihnen nahestanden. Freunden etwa oder dem Partner. Doch dabei nahm jeder Kitzelnde unterschiedliche Körperstellen mit unterschiedlicher Intensität ins Visier. Roboterhände oder Einlegesohlen mit elektronisch gesteuerten Noppen könnten Abhilfe schaffen.
Drittens konzentrieren sich neurowissenschaftliche Studien bislang vor allem auf den Unterschied zwischen reflexhaftem Lachen (durch Kitzeln) und freiwilligem Lachen (als Ausdruck von Spaß und Freude). Kilteni will das nun ändern. Sie sieht gewaltiges Potenzial für die Hirnforschung. Gargalesis sei "ein einzigartiges Modell für das komplexe Zusammenspiel zwischen somatosensorischer Wahrnehmung, motorischer Kontrolle und affektiver Verarbeitung, das für viele Bereiche der Neurowissenschaften von Bedeutung ist", schreibt die Forscherin in der Fachzeitschrift "Scientific Advances". Sie selbst geht dem Thema am Karolinska Institut in Schweden und der Radboud-Universität im niederländischen Nijmegen auf den Grund. In ihrer Übersichtsarbeit fasst sie den Wissensstand zu den großen Fragen des Kitzelns zusammen.
Warum sind wir nicht überall gleich kitzelig?
Fußsohlen, Achselhöhlen und Flanken sind bei vielen Menschen besonders lohnende Ziele für eine Kitzelattacke. Dabei sind diese Bereiche des Körpers nicht übermäßig berührungs- oder schmerzempfindlich. Die Haut der Lippen, des Gesichts und der Fingerspitzen enthält deutlich mehr Sinneszellen. Auch als erogene Zonen spielen Fußsohlen oder Achselhöhlen keine Rolle. Darwin glaubte, dass wir dort besonders kitzelig seien, wo wir selten berührt werden – oder wo Berührungen normalerweise großflächig statt punktuell ist. Dagegen spricht allerdings, dass wir an Rücken und Po selten kitzelig sind.

Warum lachen wir, auch wenn wir keinen Spaß haben?
Als Zeichen der Zuneigung und als Spiel mit körperlicher Nähe macht Kitzeln großen Spaß. Doch es kann auch schmerzhaft werden und unsere Grenzen überschreiten. Schon Darwin schrieb: "Ein kleines Kind, das von einem fremden Mann gekitzelt wird, würde vor Angst schreien." Selbst als Foltermethode wurde Kitzeln eingesetzt. Dass wir dabei lachen, heißt nicht, dass wir die Berührungen genießen.
Das lässt sich sogar messen. "Die Forschung zeigt, dass durch Kitzeln hervorgerufenes Lachen dem freudigen Lachen weniger ähnlich ist, als wir vielleicht denken", schreibt Kilteni. "Insbesondere hat es andere akustische Parameter (zum Beispiel Komplexität und Tonhöhe), löst ein höheres Maß an emotionaler Erregung aus, ruft eine andere neuronale Aktivierung und andere Hirnkonnektivitätsmuster hervor und unterscheidet sich in der Wahrnehmung vom fröhlichen Lachen." Vermutlich handelt es sich deshalb eher um einen primitiven Reflex als um ein soziales Signal.
Warum können wir uns nicht selbst kitzeln?
Die führende Theorie lautet: Versuchen wir uns selbst zu kitzeln, erwartet das Gehirn die Berührung und unterdrückt den Reiz. Stattdessen priorisiert es Reize von außen, denn die sind wichtiger für das Überleben. Bildgebende Studien des Gehirns bestätigen das – allerdings nur für neutrale Berührungen oder sanftes Kitzeln, auch Knismesis genannt. Entsprechende Studien zu Gargalesis stehen noch aus.
Eine Arbeit aus dem Jahr 2000 untersuchte Menschen, die aufgrund einer Schizophrenie Stimmen hörten oder sich fremdbestimmt fühlten. Sie nahmen ihre eigenen Berührungen als genau so kitzelig wahr wie die anderer Menschen. Offenbar konnte ihr Hirn selbst ausgelöste Reize nicht mehr sauber von äußeren Reizen unterscheiden.
Warum sind Menschen unterschiedlich kitzelig?
Subjektives Empfinden ist schwierig zu messen. Unsere direkten Sinneswahrnehmungen unterscheiden sich ebenso wie deren Verarbeitung im Gehirn. Zwei Theorien besagen, dass Kinder kitzeliger sind als Erwachsene, weil sie durch das Lachen ihren Humor entwickeln oder sich durch spielerische Kitzelkämpfe auf ernste Auseinandersetzungen vorbereiten. Andere Forschende vermuten einen Zusammenhang mit einer emotionalen Persönlichkeit, oder mit der gegenwärtigen Gemütslage. Bewiesen ist jedoch keine dieser Hypothesen.
Wozu dient Kitzeln überhaupt?
Lernen wir beim Wettkitzeln, unsere verwundbaren Körperteile im Kampf zu schützen? Stärken die Berührungen unsere Bindung zu Eltern, Freunden und Familie? Handelt es sich um einen sanften Übergang von kindlichem Spiel zu erotischen Berührungen? Oder ist unsere Reaktion auf das Kitzeln nicht mehr als ein Schreckreflex, mit dem wir Ungemach abwenden wollen? Noch wissen wir es nicht. Doch Kilteni ist zuversichtlich, "dass die modernen Neurowissenschaften bald in der Lage sein werden, Erklärungen für das zu liefern, was Sokrates, Aristoteles, Erasmus, Bacon, Galileo, Descartes und Darwin vor Rätsel stellte."