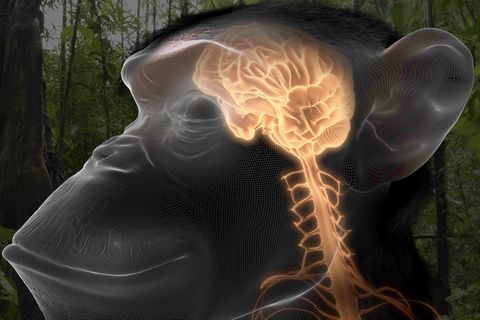Kopfbälle beim Fußball oder Zusammenstöße etwa beim American Football können zu unbemerkten Hirnschäden führen. Drei Forscherteams haben sich die Gehirne von Sportlern genauer geschaut.
Das erste Team entdeckte spezifische Reaktionen auf Kopfbälle in den Tiefen der Gehirnfurchen. "Unsere Studie zeigte, dass Menschen mit mehr Kopfbällen stärkere Störungen in einer bestimmten Schicht der Hirnfurchen aufwiesen, und diese Störungen waren mit schlechteren Leistungen in Denk- und Gedächtnistests verbunden", sagte Co-Studienleiter Michael Lipton von der Columbia University in New York City.
Für die Studie im Journal "Neurology" wurden 352 Amateurfußballer mit einem Durchschnittsalter von 26 Jahren sowie 77 Athleten aus Sportarten ohne Kollisionen im Durchschnittsalter von 23 Jahren untersucht. Die Fußballspieler aus dem Großraum von New York wurden in vier Gruppen eingeteilt: Die Mitglieder der ersten absolvierten nach eigenen Schätzungen in den vergangenen 12 Monaten im Schnitt 3.152 Kopfbälle, die der vierten Gruppe nur 105.
Mit Gehirnscans untersuchte das Team Gewebe in der Mitte der weißen Substanz und an deren Grenze zur grauen Substanz, der sogenannten Großhirnrinde. "Wir haben uns diese Schnittstelle angesehen, weil graue und weiße Substanz unterschiedliche Dichten haben und sich bei Kopfstößen unterschiedlich bewegen", erklärt Lipton. Dadurch werde die Grenzfläche besonders verletzungsanfällig.
Auswirkungen der Kopfbälle auf das Hirn
Ergebnis: Je mehr Kopfbälle die Probanden absolviert hatten, desto stärkere Störungen zeigte die Mikrostruktur des Gewebes vor allem in den Tiefen der Hirnfalten. Die Anordnung der Nervenfasern veränderte sich dort ebenso wie die Bewegung der Wassermoleküle. Fußballspieler in der Gruppe mit der höchsten Belastung zeigten demnach deutlich stärkere Störungen in der Mikrostruktur als Fußballspieler in der niedrigsten Gruppe und Menschen ohne Kontaktsport.
Die Forscher zeigen somit nach eigenen Angaben erstmals am lebenden Menschen die Bedeutung von Stößen für die tiefen Regionen der Hirnfalten. Sie hatten dazu die sogenannte Diffusion-Kernspintomographie (dMRI) genutzt.
Und mehr noch: Bei Tests zum Lernen und Erinnern von Wörtern schnitten die Spieler am schlechtesten ab, die im Orbitallappen, dem Bereich über den Augenhöhlen, besonders starke Strukturänderungen in den Tiefen der Hirnfalten hatten.
Nach Angaben der Universität beweist die Studie jedoch nicht, dass ein Kopfball diese Gehirnveränderungen verursacht, sondern zeigt lediglich einen Zusammenhang auf. "Eine zentrale offene Frage ist die Dauerhaftigkeit der beobachteten Veränderungen in der weißen Substanz", schreibt das Team. Das müssten weitere Studien klären.
Kinder sollen mit leichteren Bällen trainieren
Der Deutsche Fußball-Bund hat schon seit langem auf mögliche Hirnschäden bei Kindern reagiert. Er empfiehlt für sie unter anderem einen reglementierten Trainingsplan und leichtere Bälle für das Kopfballtraining sowie bei älteren Jugendlichen einen geringeren Balldruck. "Dies ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung", sagte Peter Berlit, der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN), der Deutschen Presse-Agentur. Aus neurologischer Sicht wären etwaige Einschränkungen auch bei erwachsenen Laien wünschenswert. "Demgegenüber stehen natürlich die Dynamik und die Regeln des Fußballspiels."
"Die Vor- und Nachteile von sportlicher Betätigung und wiederholten Kopftraumata sind schwer gegeneinander aufzuwiegen und müssen in jedem Fall individuell betrachtet werden", sagte Berlit. Sport sei nachgewiesenermaßen vorteilhaft für die Hirngesundheit mit Vermeidung von Krankheiten wie Demenz und Schlaganfällen. Sportarten ohne Risiko für Kopftraumata seien dabei grundsätzlich die gesündere Alternative. "Am schlechtesten ist es, gar keinen Sport zu machen!"
Wenn Grenzen im Gehirn verschwimmen
Ein zweites Team um Lipton entdeckte in einer ähnlich aufgebauten Studie, dass die eigentlich klare Grenze zwischen weißer und grauer Substanz im Hirn von Amateurfußballern mit der zunehmenden Zahl an Kopfbällen immer mehr verwischt. In diesem Fall war auch der Bereich über der Augenhöhle besonders betroffen. Eine geringere Schärfe der Trennlinie in diesem orbitofrontalen Bereich war mit schlechteren Leistungen in Gedächtnistests assoziiert. Dabei sollten die Probanden gehörte Wortreihen sofort wiederholen.
"Das Wichtige an unserer Studie ist, dass sie wirklich erstmals zeigt, dass wiederholte Einwirkungen auf den Kopf spezifische Veränderungen im Gehirn verursachen, die wiederum die kognitive Funktion beeinträchtigen", sagte Lipton.
Beide Studien seien seriös, sagte Berlit. In beiden Studien seien die entdeckten Auffälligkeiten in den genannten Hirnregionen im orbitofrontalen Bereich mit einer schlechteren kognitiven Leistung assoziiert. "Es handelt sich um die bislang größte Kohorte von Amateur-Fußballspielerinnen und -spielern, bei denen mikrostrukturelle Hirnveränderungen nach wiederholten Kopftraumata untersucht wurden."
In bisherigen Kopftrauma-Studien sei die Diffusions-Kernspintomographie meist nur auf bestimmte Regionen der tiefen weißen Substanz oder des Gehirns als Ganzes angewandt worden, sagte Berlit. Nun seien damit explizit Grenzbereiche zwischen weißer und grauer Substanz untersucht worden.
Wenn Grenzen im Gehirn verschwimmen
Eine statistische Analyse in der "Jama Network Open"-Studie habe ergeben, dass die entdeckten Auffälligkeiten im Hirn durchaus ursächlich für die schlechtere kognitive Leistung nach wiederholten Kopftraumata sein könnten, sagte Berlit. "Einschränkend muss dazu jedoch gesagt werden, dass Kausalitäten in einer Beobachtungsstudie nicht belegt werden können."
Insgesamt seien weitere Studien nötig, die die klinische Relevanz der beschriebenen Auffälligkeiten untersuchen, betonte Berlit. In den vorliegenden Studien hingen wiederholte Kopftraumata zwar mit einer schlechteren Hirnleistung zusammen, "jedoch erreichte das schlechtere kognitive Abschneiden nicht das Ausmaß einer klinisch relevanten Beeinträchtigung".
Lipton möchte untersuchen, ob es einen Zusammenhang zwischen den entdeckten Schäden und der chronisch traumatischen Enzephalopathie gibt, die etwa mit Gedächtnis- oder Bewegungsstörungen einhergeht.
Untersuchung zu Boxer-Demenz
Ein drittes US-Team analysierte die Auswirkungen von wiederholten starken Stößen auf den Kopf, wie sie beim Boxen, American Football oder Zusammenprallen von zwei Fußballern vorkommen. Diese können nachweislich zur chronisch traumatischen Enzephalopathie (CTE) führen, oft auch Boxer-Demenz genannt.
Derzeit kann die Krankheit erst nach dem Tod sicher diagnostiziert werden. Dabei wird eine erhöhte Ansammlung des p-Tau-Proteins, das auch bei Alzheimer eine Rolle spielt, in Hirnfurchen nachgewiesen. Einige Sportler zeigen jedoch Symptome dieser Enzephalopathie, bevor dieses Protein auftritt. Die Forscher haben nun mehrere frühe Hirnveränderungen nach Stößen auf den Kopf nachgewiesen, wie sie im Journal "Nature" berichten.
Sie hatten 28 Männer untersucht, die bei ihrem Tod zwischen 25 und 51 Jahre alt waren: Darunter waren vor allem American-Football-Spieler mit oder ohne Diagnose für die Enzephalopathie und eine Kontrollgruppe ohne Kontaktsport.
Eine der auffälligsten Entdeckungen war ein im Schnitt 56-prozentiger Verlust spezieller Nervenzellen in Furchen der Großhirnrinde bei allen untersuchten Football-Spielern, egal ob sie bereits eine Enzephalopathie entwickelt hatten oder nicht. Diese Region ist bei Stößen auf den Kopf den größten mechanischen Kräften ausgesetzt. Dort treten - unabhängig vom Verlust der Nervenzellen - auch die Ablagerungen des Proteins p-Tau auf.
Zudem gehen die Forscher von einem sich verstärkenden Kreislauf innerhalb des Hirns aus. "Wiederholte Schläge in kurzen Abständen reaktivieren vermutlich ein bereits entzündetes System, verhindern vollständige Reparatur und die Rückkehr zu einem stabilen Zustand", schreibt das Team.
Verlust von Nervenzellen bei relativ jungen Spielern
"Diese Ergebnisse haben das Potenzial, unsere Sichtweise auf Kontaktsportarten grundlegend zu verändern", sagte der korrespondierende Autor Jonathan Cherry von der Boston University. "Sie legen nahe, dass die Belastung durch wiederholte Stöße auf den Kopf Nervenzellen abtöten und langfristige Hirnschäden verursachen kann – unabhängig von der chronisch traumatischen Enzephalopathie."
"Dies ist nach unserem Wissen die erste Studie, die einen so erheblichen Verlust eines spezifischen Neuronentyps bei jungen Personen zeigt, der allein durch wiederholte Stöße auf den Kopf verursacht wird", schreibt das Team in der Studie. Allerdings untersuchten die Autoren nicht, ob diese neuronalen Verluste mit den Ergebnissen kognitiver Tests korrelierten, die die Sportler zu Lebzeiten absolviert hatten.
"Die umschriebenen Hirnveränderungen sind die Initialzündung für das Entstehen einer CTE und müssen deshalb ernst genommen werden", sagte DGN-Generalsekretär Berlit. "Vor allem, wenn es über einen längeren Zeitraum zu wiederholten Kopfprellungen kommt, ist das Risiko erhöht." Die Studie erfolgte zwar an American-Football-Spielern, es gibt laut Berlit jedoch vergleichbare Daten für das Boxen und den Fußball. Hier seien vor allem die Personen in der Mannschaft betroffen, bei denen ein Zusammenstoß vermehrt zu erwarten sei, insbesondere die Verteidiger.