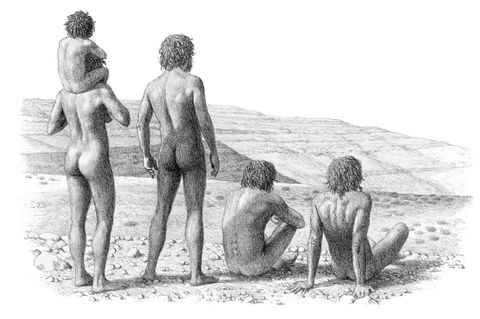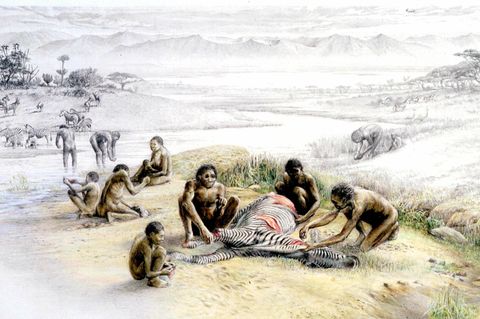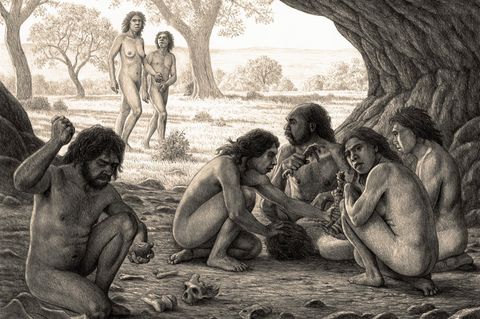Wir Menschen leben in einer Welt der menschengemachten Dinge – und in jeder Sekunde kommen ungezählte neue hinzu. Ein österreichisch-kanadisches Forschungsteam hat nun die sogenannte Technosphäre definiert und ihr Gewicht geschätzt. Das Ergebnis: Von Menschen geschaffene Gegenstände bringen zusammengenommen 1000 Milliarden – eine Billion – Tonnen auf die Waage, wie das Team im Fachmagazin "Earth System Dynamics" berichtet. Das entspreche etwa dem Gewicht aller Lebewesen auf diesem Planeten, vom Menschen bis zum Bakterium.
Häuser, Autos, Stromleitungen, Spielzeuge: All diese Dinge sind zwar ein wichtiger Bestandteil des materiellen Wohlstands. Doch zugleich führen sie zu einer "raschen Ausbeutung natürlicher Ressourcen und Verbrennung fossiler Brennstoffe", sagt Dominik Wiedenhofer vom Institut für Soziale Ökologie der BOKU in Wien, der das Projekt gemeinsam mit Eric Galbraith von der McGill-Universität leitete, laut einer Pressemitteilung. Das dezimiere die Artenvielfalt, verursache den Klimawandel und erzeuge große Mengen an Abfallstoffen.
Zu einer ähnlichen Größenordnung waren schon 2020 Forschende vom israelischen Weizmann-Wissenschaftsinstitut in Rehovot gekommen. Neu an der aktuellen Studie ist, dass die Forschenden menschengemachte Dinge als eigenständige Sphäre des Erdsystems definiert und vermessen haben. Zur Technosphäre zählen sie nur "nicht-lebende Gegenstände, die funktional im Einsatz sind", wie es weiter heißt. Pyramiden, Abfälle oder Nahrungsmittel wurden demnach nicht eingerechnet.
Früher verwendete Begriffe wie die "Anthroposphäre" seien wissenschaftlich wenig brauchbar, erklärt Dominik Wiedenhofer. "Wenn ein Begriff alles umfasst, was Menschen je berührt haben – vom Mikroplastik bis zur Zahnbürste – dann erklärt er am Ende nichts", sagt Wiedenhofer.
Das für die Studie entwickelte Kategoriensystem ordnet technische Objekte nach ihrem gesellschaftlichen Nutzen – zum Beispiel Transport, Energieversorgung oder Informationsverarbeitung. Auf diese Weise, so Wiedenhofer, könne man besser verstehen, welche Bereiche besonders stark wachsen, welche Strukturen ressourcenintensiv sind – und wo Hebel für Nachhaltigkeit liegen.
Bewegliche Dinge sind besonders schädlich für die Ökosphäre
Rund die Hälfte der kompletten Technosphäre besteht der Studie zufolge aus Gebäuden, ein Drittel zählt zur Transport-Infrastruktur: Straßen, Brücken, Schienen und Pipelines. Bewegliche Teile der Technosphäre dagegen – das sind vor allem motorisierte Fahrzeuge, Flugzeuge und Maschinen – machen zwar nur etwa 1,6 Prozent der Gesamtmasse aus. Doch sie haben eine überproportional große Wirkung auf Ressourcenverbrauch, Biodiversität und Klimawandel.
Den Autorinnen und Autoren zufolge bieten die neuen Erkenntnisse Grundlagen für Nachhaltigkeitsstrategien und den Schutz von Ressourcen – zum Beispiel durch Kreislaufwirtschaft, nachhaltiges Bauen und technologiearme Alternativen.
"Gleichzeitig liefert das Konzept wichtige Anknüpfungspunkte für die Klimaforschung", heißt es in der Pressemitteilung, "etwa in Bezug auf Emissionen, Landnutzung und Energieflüsse". "Wir brauchen eine Technosphäre, kommentiert Wiedenhofer, "die nicht nur funktioniert, sondern dem Leben auf diesem Planeten dient."
Der Handlungsbedarf ist enorm: Der Studie zufolge hat sich das Gewicht der Technosphäre seit dem Jahr 1900 etwa alle zwei Jahrzehnte verdoppelt. Ein solches Wachstum erinnere nicht an natürliche Kreisläufe, sondern an industrielle Logik – und stelle eine Herausforderung für planetare Grenzen dar, resümiert Wiedenhofer.
Die Autorinnen und Autoren der israelischen Studie hatten schon 2020 gewarnt: Sollte der Trend anhalten, könnte die anthropogen erzeugte Masse bis zum Jahr 2040 die globale Biomasse um den Faktor drei übertreffen.