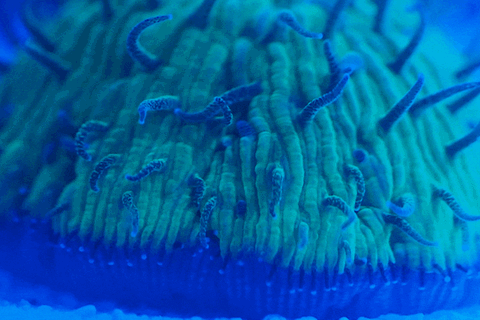Um die Zukunft vorauszusehen und zu gestalten, hilft es oft, die Vergangenheit zu betrachten – auch bei Korallen. Tropische Riffe gehören zu den artenreichsten Lebensräumen der Welt, doch der Klimawandel bedroht ihre Existenz. Wie schnell werden sie sich an die steigenden Temperaturen im Ozean anpassen können?
Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Gießener Meeresbiologin Maren Ziegler hat nun eine Analysemethode entwickelt, die einen neuen Blick auf die Zukunftschancen der Riffe wirft. Wie die Forschenden in der Fachzeitschrift "Global Change Biology" berichten, werteten sie dafür Bohrkerne aus Korallenriffen in Palau und Papua-Neuguinea aus. Die tieferen Kalkstrukturen der Steinkorallen, die darin zutage treten, berichten sehr detailliert von den Lebensbedingungen früherer Zeiten – ähnliche wie Baumringe in den Wäldern an Land. Die Proben entstammen der zweijährigen Forschungsexpedition Tara Oceans: Pacific, an der auch ein GEO-Reporterteam teilnahm:
Die Wissenschaftsgruppe um Ziegler konnte nun in den Bohrkernen erstmals genauer rekonstruieren, wie sich die Lebensgemeinschaft der symbiontischen Mikro-Algen in den Korallen über Jahrzehnte hinweg verändert hat.
Diese winzigen Algen leben als Zooaxenthellen in den Geweben von Steinkorallen und versorgen sie über Photosynthese mit Energie. Sie ermöglichen so erst den Aufbau der Kalkskelette – und damit der Lebensvielfalt am Riff. Doch die Symbiose ist empfindlich: Bei starker Erwärmung stoßen Korallen ihre Algen ab. Sie "bleichen". Nur wenn langfristig wieder neue Symbionten in die Gewebe einziehen, können sich die Korallen erholen.

Wie diese Partnerschaft sich in Klimakrisen entwickelt, ist bislang rätselhaft. Aktuelle Gewebeproben geben immer nur eine kurze Momentaufnahme. Die Analyse von DNA-Spuren in den Bohrkernen von zwei weit verbreiten Steinkorallenarten aber ließ Zieglers Forschungsteam nun einen Zeitraum von 110 Jahren betrachten.
Dabei zeigte sich: Die Zusammensetzung der "Algen-Gärten" kann je nach Standort stark variieren. In den Korallen aus Papua-Neuguinea blieb die Symbionten-Gemeinschaft erstaunlich stabil. Anders jedoch in Palau: Dort verschob sich im Lauf der Zeit immer wieder die Artenzusammensetzung. Wurde das Meerwasser wärmer, tauschten die Korallen die meisten Mitbewohner gegen hitzetolerantere Arten aus. Sie passten die "Gärten" in ihrem Gewebe dem Umweltstress an – und überlebten dadurch.
Die Erkenntnisse könnten der Forschung nun helfen, besonders widerstandsfähige Korallenarten und -populationen im Meer zu finden und möglicherweise sogar gezielt Steinkorallen mit hitzetoleranten Symbionten zu züchten – zwei wichtige Hoffnungsschimmer im weltweiten Kampf gegen das Korallensterben.