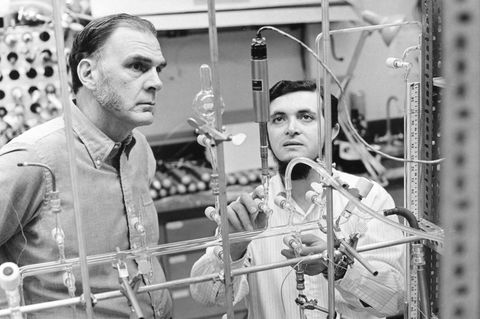Niemand weiß so genau, wo sich Boaty McBoatface versteckt. "Irgendwo auf dem Schiff muss es sein", sagt ein Decksmitarbeiter. Tief im Schiffsbauch vielleicht, in einem Hangar oder einer der vielen Kammern, die sich zwischen den Wänden des Rumpfs verbergen? Klein genug wäre es dafür. Über der Schiffsbar hängt ein Foto von Boaty McBoatface: ein autonomes U-Boot, gerade mal gut 3,5 Meter lang und rund wie eine Zigarre. Eigentlich sollte der neue Forschungseisbrecher der Briten, in dessen Untiefen der gelbe Torpedo jetzt verstaut ist, selbst mal diesen Namen tragen: Boaty McBoatface. Stattdessen ist das jetzt ein Messinstrument wie viele auf dem neuen Prachtschiff der britischen Forschungsflotte.
Boaty McBoatface: Ein Name, der nicht sein durfte
Einen neuen Forschungseisbrecher zu bauen, leisten sich europäische Länder – außer Russland, das ständig neue vom Stapel laufen lässt – vielleicht alle Jahrzehnte mal. Entsprechend prestigeträchtig war das Projekt, in das Großbritannien 200 Millionen Pfund (233 Millionen Euro) investierte, soviel wie zuletzt in den 1980ern für ein wissenschaftliches Vorhaben in den Polarregionen. 2016 war das neue Schiff des altehrwürdigen British Antarctic Survey fast fertig und brauchte einen Namen. Die Briten und Britinnen sollten selbst entscheiden, per Internetabstimmung. Der Gewinner: Boaty McBoatface, ein Unsinnsname, der übersetzt so viel heißt wie "Bötchen McBootsgesicht." Der Vorschlag des ehemaligen BBC-Moderators James Hand heimste mehr als dreimal so viele Stimmen ein wie der zweitplatzierte Name "RRS Poppy-Mai". Die ganze Welt freute sich mit am Humor der Inselmenschen.
Aber nicht so sehr die britische Forschungsinstitution NERC. Der Name sorgte für ein politisches Gerangel, bei dem sich auch Ed Vaizey und Jo Johnson, die damaligen Minister für Kultur und für Wissenschaft, einschalteten. Sogar ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss wurde einberufen. Das Ergebnis: Der Forschungseisbrecher durfte einen ernsthaften Namen bekommen, dafür sollte etwas anderes nach Volkswillen benannt werden. Deswegen heißt die gelbe U-Boot-Raupe jetzt Boaty McBoatface, der 129 Meter lange Eisbrecher dafür RRS Sir David Attenborough, nach dem britischen Naturforscher und Tierfilmer.

Trotz allem und vielleicht nicht zum Vergnügen der stolzen britischen academia lebt der Name aber trotzdem weiter und erinnert an die Eskapade: Im Rennpferd "Horsey McHorseface", im Zug von Stockholm nach Göteborg, dem "Trainy McTrainface", und in der australischen Fähre "Ferry McFerryface" – die allerdings nur zwei Jahre so heißen durfte, bis sie einen ehrwürdigeren Namen bekam.
Den Deutschen wird ein ähnliches Dilemma übrigens erspart bleiben. Der Name des neuen Forschungseisbrecher, der derzeit in Planung ist, steht nämlich schon fest: ganz schlicht Polarstern 2.
Viel Platz, aber wenig Ambiente
Viele Briten nennen ihr neues Forschungsschiff trotzdem noch liebevoll Boaty McBoatface – anders als die Menschen, die heute darauf arbeiten. Nun ist RRS Sir David Attenborough kein Name, der schnell von den Lippen geht (RRS steht für Royal Research Ship; es gibt auch noch HMS – His/Her Majesty’s Ship, MV – Motor Vessel, und SS – Sailing Ship). Deshalb sagen Crew und wissenschaftliches Personal schlicht: die SDA.
Wer das Forschungsschiff heute betritt, dem fällt auf: So neu sieht es nach zwei Saisons in Arktis und Antarktis gar nicht mehr aus. An einigen Stellen ist der Lack abgeplatzt und zeigt rostige Flecken. Die Seile an Deck sind rau und aufgerieben, wo sie gegeneinander schrubben. Und an den Rettungsringen sind Buchstaben abgefallen, "SIR DAVID AT ENBOR UGH" steht auf einem.

Innen aber riecht es nach Möbelhaus, new couch smell. Das Parkett wirkt nicht, als wären schon zwei Jahre lang schwere Arbeitsstiefel darüber gestapft. Ein Konferenzraum mit hellen Holztischen, ein Tagesraum mit einem Berg aus Sitzsäcken und viele grauweiße Flure geben der SDA etwas Bürohaftes. Die Meinungen darüber gehen auseinander. "Hat keinen Charakter", sagen die, die sich lieber an ihre Fahrten auf dem Vorgängerschiff RRS James Clarke Ross erinnern, der 30 Jahre älteren und 30 Meter kürzeren JCR. Andere freuen sich über den vielen Platz überall, vor allem in den Kabinen: Zwischen Doppelstockkoje und Sitzecke könnte man glatt ein Tänzchen aufführen. "Die SDA ist ein gutes Schiff", hört man immer wieder.
Per Joystick ans Ende der Welt
Im Frühjahr 2024 gleitet die SDA mit etwa sechs Knoten (elf Kilometer pro Stunde) durchs Weddellmeer nahe der Antarktischen Halbinsel, die wie ein Finger Richtung südamerikanischen Kontinent zeigt. Betriebsgeschwindigkeit sind 13 Knoten, doch draußen schwimmen Hindernisse: Schollen und Eisberge ziehen wie ein endloser Film an den Panoramafenstern im Aufenthaltsraum vorbei, während die Forschenden auf ihren Laptops herumklicken, sich leise unterhalten oder einfach nur nach draußen starren.
Auf einmal neigt sich das Schiff zur Steuerbordseite. Die Meeresoberfläche kommt immer näher, bis sie fast die ganze Fensterfläche ausfüllt. "Uuuuaaaahhh", raunt es durch die Gruppe, ein paar rutschen auf den Ledercouches nach vorn, andere gegen die, die neben ihnen sitzen. Doch schon hat sich die SDA wieder aufgerichtet, sie ist nur durch eine besonders dicke Scholle gefahren. "Krass", sagt ein Wissenschaftler. "Ich hatte komplett vergessen, dass wir überhaupt fahren."
Tatsächlich sind die zwei Sechszylinder- und zwei Neunzylinder-Motoren mit je 2.750 Kilowatt so designt, dass sie die beiden 4,5 Meter dicken Propeller so leise wie möglich antreiben. Das soll helfen, die Lebewesen in der Umgebung nicht zu stören. Mit dem seltsamen Effekt, dass man nun Geräusche wahrnimmt, die man auf älteren Schiffen wohl gar nicht gehört hätte. Vom Arbeitsdeck aus klingt das Hydrauliksystem des Ruders wie ein Monster, das im Schiffsbauch jammert.
Gestützt von Satelliten sorgt außerdem das dynamische Positionier-System dafür, dass der Forschungseisbrecher immer so ruhig wie möglich durch seine Umgebung manövriert. Kapitän und Offiziere auf der Brücke bewegen Joysticks oder legen ihre Hand auf drehbare Halbkugeln, um die Position zu verändern. Der Computer berechnet dann, wie das Zusammenspiel aus Maschinen, Propellern, Heck- und Bugstrahlrudern aussehen muss, um das Schiff so sanft wie möglich dorthin zu bewegen. Tatsächlich merkt man an Bord manchmal kaum, dass man überhaupt unterwegs ist. Sogar die gefürchtete Drake-Passage zwischen Südamerika und Antarktis macht nur noch wenige seekrank.

In den Maschinenräumen: ausgefeilte Technik, auf der Namen wie Rolls Royce und Bergen kleben. Geraldine Wythe, seit Jahrzehnten Ingenieurin auf Forschungsschiffen, führt im Schnelldurchlauf an allem vorbei – der Wasseraufbereitungsanlage, den speziellen, vertikalen Strahlrudern, dem System, dass Motorhitze in Heizwärme umwandelt. Man könnte denken, dass hier nur Hightech verbaut wurde, aber Wythe winkt ab: "Die Technologien selbst gibt es schon lange", sagt sie. Nur hat man sie hier eben alle vereint.
Was ist denn dann wirklich neu auf der SDA? "Dass im Prinzip niemand mehr im Maschinenraum Wache halten müsste", sagt Wythe. Sie und ihre Kollegen können alles auch per Tablet überwachen und bedienen. Was Wythe aber nicht nur gut findet. "Ein guter Ingenieur kennt seine Maschinen", sagt sie. "Du musst ihnen zuhören, sie beobachten. Ob sie heißer werden als sonst, ob es ein komisches Geräusch gibt." Einen "mechanischen Garten" nennt sie das Labyrinth aus Maschinenräumen. Und wie jeder Garten brauche der Pflege und Aufmerksamkeit.
Ein schwimmendes Labor – wenn es funktioniert
Nicht nur im Schiffsbau, auch in Sachen Wissenschaft hat man sich mit der SDA viel Mühe gegeben. Als erstes Forschungsschiff überhaupt lassen sich auf ihr Wasserproben ohne Metallkontakt sammeln und analysieren, mit einer stahlfreien CTD-Rosette und einem metallfreien Labor. Das ist wichtig, weil die Wissenschaft heute immer mehr darüber lernt, welche große Rolle Metalle in den biogeochemischen Prozessen spielen, die im Ozean aber nur in Spuren vorkommen. Schon ein Handy im metallfreien Labor kann die Proben verunreinigen, umso mehr, wenn das ganze Messinstrument aus Stahl besteht.
Unter dem Schiff hängen mehrere Sonare, mit denen man zum Beispiel Krillschwärme in 3D sehen kann. Insgesamt sind 750 Quadratmeter der Schiffsfläche als Labor eingerichtet, plus Platz für 10 Laborcontainer auf dem riesigen Arbeitsdeck. Außerdem an Bord: Stahlseil für Proben in bis zu 8000 Metern Tiefe, fünf Kräne, um gleich mehrere Instrumente gleichzeitig über die Reling schicken zu können, und ein riesiges Kolbenlot, das sich 42 Meter tief in den Meeresgrund bohren kann, um Proben zu nehmen.
Aber nicht alles funktioniert auch schon. Das Unterwassersystem, das eigentlich konstant frisches Seewasser für Experimente in die Labore leiten sollte, verstopft immerzu. Sehr zum Leidwesen derer, die damit arbeiten wollen: Zwischen den WhatsApp-Nachrichten "Unterwassersystem ist an!" und "Ist wieder aus!" liegen manchmal nur Minuten, um hinunterzurennen und die Instrumente an- oder abzuschalten. Und der vier mal vier Meter große "Mondpool", der auf anderen Forschungsschiffen oft eine dunkle Luke ganz unten im Schiffsbauch ist und sich hier imposant vom Arbeitsdeck aus öffnen und ausfahren lässt, ist genauso eine Legende wie Boaty McBoatface: Auf dieser Fahrt hat ihn noch niemand gesehen. Er ist kaputt.