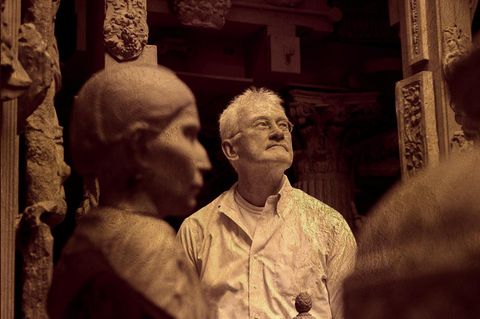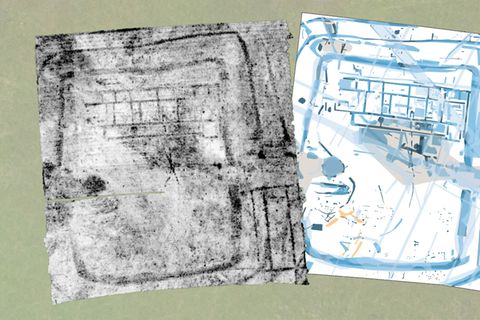GEO: Herr Professor Hölscher, Sie setzen sich in Ihrer Forschung mit antiken Fluchtafeln auseinander, deren Zweck es sein sollte, Mitmenschen Schaden zuzufügen. Wie kann man sich diese Tafeln genau vorstellen?
Prof. Michael Hölscher: Es handelt sich um kleine Bleitäfelchen, auf denen in griechischer oder lateinischer Schrift Flüche niedergeschrieben sind. Es gibt Anleitungen, die genau beschreiben, welche Formeln man verwenden muss, um jemanden zu verfluchen.
Was waren denn die Motive, jemanden zu verfluchen?

Zum Beispiel Liebeskummer: um einen Widersacher loszuwerden. Oder vor Gericht, damit der Gegner den Prozess verliert. Ein anderes Beispiel ist ein wirtschaftlicher Konkurrent, der geschädigt werden soll. Ein Klassiker sind Wagenrennen: Man wettet auf einen bestimmten Wagenlenker und verflucht einen anderen, um den Gewinn einzustreichen. Erhalten geblieben sind auch Flüche gegen Diebe: Eine Tafel zeugt davon, dass dem Gast einer Badeanstalt der Bademantel gestohlen wurde und er daraufhin den Dieb verfluchte.
Jetzt möchten wir natürlich gern einen Fluchtext hören.
Diesen hier, in dem es um ein Wagenrennen geht, finde ich sehr eindrücklich: "Heilige Engel, überfallt und bindet hinab und greift jetzt an. Bindet, stürzt, werft nieder, zerhackt in Stücke die Pferde und Wagenlenker des Teams der Blauen."
Das sind sehr explizite Verwünschungen. Was passierte mit dem Bleitäfelchen, wenn der Fluch dort eingeritzt war?
Der Besitzer konnte Zauberzeichen hinzufügen, um die Wirkung zu verstärken. Man konnte das Täfelchen auch um einen Hühnerknochen rollen, als Zeichen des Todes, es mehrfach durchbohren oder ihm ein gefesseltes, durchbohrtes Püppchen aus Lehm beilegen. Anleitungen beschreiben, dass man das Schriftstück am Grab eines frühzeitig verstorbenen vier Finger tief vergraben und dabei eine bestimmte Formel sprechen sollte. Manche Tafeln wurden auch in Brunnen geworfen. Im Prinzip übergab man die Tafel Gottheiten oder Dämonen, denen man die Macht zuschrieb, den Fluch auszuführen. Das Ganze war also eine rituelle Handlung.
Wie verbreitet war diese Art des Verfluchens?
Offenbar sehr, denn bislang haben Forschende rund 1700 Fluchtafeln aus der Zeit zwischen etwa 500 vor und 500 nach Christus gefunden, von Rom bis Trier und von Kleinasien bis Britannien. Die Menschen waren von der Wirksamkeit der Flüche überzeugt. Plinius etwa schrieb: "Es gibt in der Tat niemanden, der nicht fürchtet, durch furchtbare Verwünschungen gebannt zu werden." Sobald also jemand ernsthaft krank wurde oder Misserfolge im Beruf erlebte, stand die Befürchtung im Raum, verflucht worden zu sein. Deshalb war diese Praxis laut römischem Recht auch verboten.
Weil die Fluchtafeln eine Art Selbstjustiz waren?
Genau. Je nach Fluch sollte eine Person körperlich zu Schaden kommen, bisweilen sogar zu Tode gebracht werden. Die Flüche standen im Gegensatz zur römischen Rechtsordnung. Die große Zahl der entdeckten Tafeln zeigt aber, dass viele Menschen sie im alten Rom trotz Verbots aufsetzten und das Ritual heimlich durchführten. Wir können uns diese Fluchtafeln als antike Form von Herausforderungsbewältigung vorstellen.
Welchen Wert haben die Tafeln für die Forschung?

Sie sind für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen spannend. Anhand der Täfelchen lässt sich etwa ablesen, welche Namen im alten Rom zu welchen Zeiten verbreitet waren, aber auch, wie sich die lateinische Sprache über Jahrhunderte entwickelt hat. Sozialgeschichtlich sind die Tafeln interessant, weil sie Auskunft über den sozialen Status von Personen geben können. Im Bereich der Alltagsgeschichte lässt sich anhand der Fluchpraxis nachvollziehen, wie die Römer mit schwierigen Situationen umgingen.
Nun sind Sie ja Theologe. Welche Rolle spielen die Tafeln für Ihre Forschung?
Mich interessiert insbesondere, ob es im Neuen Testament Anspielungen auf die Fluchtafeln gibt.
Geht es in der Bibel nicht eher um Segen als um Flüche?
Das meinen viele, aber im biblischen Denken kann Gott sowohl segnen als auch verfluchen. Und im Markus- und Matthäusevangelium verflucht Jesus einen Feigenbaum, der danach verdorrt und keine Früchte mehr trägt. Diese Aktion steht beispielhaft dafür, dass Gebet wirklich wirksam sein kann. Ich habe speziell die Johannesoffenbarung untersucht, die am Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. wahrscheinlich in Kleinasien in der heutigen Türkei verfasst wurde. Dieser Text setzt sich intensiv mit römischer Kultur und römischer Religion auseinander.
Diese Region stand in der Antike unter römischer Herrschaft. Die Christen waren nur eine Minderheit.
Ja, ich konnte Hinweise darauf finden, dass die frühen Christen die Johannesoffenbarung vor dem Hintergrund der Fluchtafeln auf eine ganz besondere Weise lesen und verstehen konnten. Die römischen Himmelsgottheiten rücken dann in die Nähe von dubiosen Unterweltsmächten.
Und wie genau?
In Offenbarung 18 heißt es zum Beispiel: "Dann hob ein gewaltiger Engel einen Stein auf, so groß wie ein Mühlstein; er warf ihn ins Meer und rief: So wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hinabgeworfen werden und man wird sie nicht mehr finden." Babylon steht für Rom. Diese und weitere Formulierungen lesen sich fast exakt so wie die Verwünschungen auf den Fluchtafeln. Auf die Menschen der damaligen Zeit konnte ein solcher Text seine besondere Wirkung entfalten: Die römische Religion und Kultur scheint mit ihren eigenen Waffen geschlagen zu werden. Allerdings wird Rom in der Johannesoffenbarung ausgerechnet durch eine Praxis vernichtet, die das römische Recht selbst als magisch einstuft und verbietet. Davon abgesehen finde ich als Theologe die Fluchtafeln aber auch vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Debatte interessant, wie wir mit Sprache angemessen umgehen.
Wie meinen Sie das?
Die Fluchtafeln sind eine Art Hatespeech der Antike. Der Unterschied zu Hass und Hetze im Internet ist natürlich, dass die Menschen damals davon ausgingen, durch die Flüche körperlich schaden zu können. Nichtsdestotrotz zeigt uns der Vergleich, wie alt die Diskussion darüber ist, wie schädlich und zerstörerisch Sprache wirken kann.