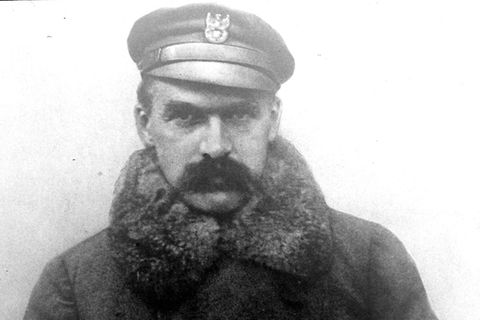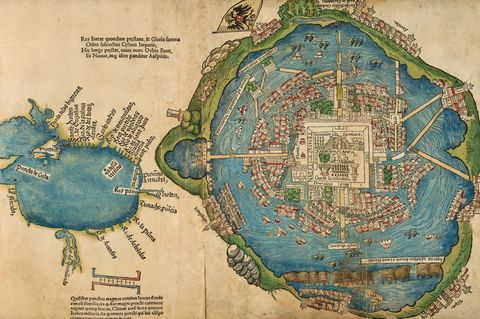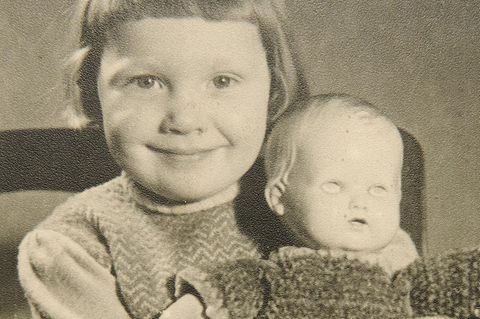Noch vor wenigen Jahren war diese Zahl kaum vorstellbar: Deutschland und die meisten anderen NATO-Staaten wollen in den kommenden Jahren fünf Prozent ihres jeweiligen Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben. Das sieht eine Erklärung vor, die beim bevorstehenden Gipfel des Bündnisses in Den Haag beschlossen werden soll. Im vergangenen Jahr hat Deutschland seine Verteidigungsausgaben auf gut zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung erhöht. Da erscheinen fünf Prozent, auch wenn sie erst 2035 erreicht werden sollen, ambitioniert. Aber die Geschichte zeigt: Deutschland hat diesen Wert schon einmal fast erreicht.
In der ersten Hälfte der 1950er-Jahre lagen die öffentlichen Militärausgaben noch bei fast null. Die Alliierten hatten die Bundesrepublik entmilitarisiert. Also entstanden dem jungen Staat nur wenige Ausgaben, etwa für den Bundesgrenzschutz, der die innerdeutsche Grenze schützen sollte.
Second-Hand-Panzer
Das änderte sich 1955. Im Kalten Krieg bemühte sich der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer, Deutschland in den Westblock einzubinden. Also trat die Bundesrepublik der NATO bei und gründete mit dem Segen der alliierten Westmächte am 12. November die Bundeswehr. Die ersten Soldaten wurden noch in zivilen schwarzen Anzügen vereidigt, weil neue Uniformen zwar bestellt, aber noch nicht fertig genäht waren.

Ansonsten kaufte die neue Armee vor allem gebrauchtes Material: Panzer aus den USA, Bomber aus Großbritannien. Einige Maschinengewehre des Typs MG42 hatten deutsche Firmen noch im "Dritten Reich" für die Wehrmacht produziert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatten etwa Frankreich und Norwegen sie weitergenutzt und verkauften sie jetzt an Deutschland. Damals gab die BRD sieben Milliarden Mark, also etwa 3,8 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für das Militär aus.
Die größte Armee Europas
In den folgenden Jahren stieg diese Quote. Deutschland gab mit dem Leopard 1 die Entwicklung eines eigenen Kampfpanzers in Auftrag, baute Kasernen im ganzen Land und führte 1957 die Wehrpflicht ein, sodass die Militärausgaben auf den bisherigen Rekrodwert von 4,9 Prozent im Jahr 1963 stiegen. Damals umfasste die Truppe rund 400.000 Soldaten und wuchs danach stetig weiter, wie auch die Verteidigungsausgaben – allerdings nur in absoluten Zahlen.

Weil die deutsche Wirtschaft kräftig zulegte, sank nämlich der Anteil des Militärbudgets auf etwa drei Prozent in den 1970er- und 1980er-Jahren. In dieser Zeit bildete die Bundeswehr mit knapp einer halben Million Soldaten, etwa 7000 Panzern sowie 1000 Luftfahrzeugen die größte NATO-Armee Europas.
Heute ist die Bundeswehr davon weit entfernt. Mit dem Ende der Sowjetunion schien die größte Bedrohung Geschichte zu sein, und Deutschlands Verteidigungsausgaben sanken nun auch in absoluten Zahlen. 2007 betrugen sie noch 1,1 Prozent des BIP. Schon damals erfüllte Deutschland seine NATO-Verpflichtungen damit nicht. Das Bündnis hatte es 2002 zur Beitrittsbedingung für die Baltischen Staaten gemacht, dass sie zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung ins Militär investieren. Der Gerechtigkeit halber sollten auch die anderen Mitglieder diese Quote anstreben.
Russland kauft günstiger
Seit dem vergangenen Jahr erfüllt Deutschland das gerade noch gültige Zwei-Prozent-Ziel und liegt damit im Mittelfeld der NATO-Staaten. Etwa Kanada, Spanien und Italien investieren weniger, Großbritannien, Polen und die USA mehr. In absoluten Zahlen geben die NATO-Länder insgesamt rund zehnmal so viel Geld für Verteidigung aus wie Russland. Allerdings gilt es zu beachten: Einen großen Teil davon stemmen die USA, deren Schutzversprechen für Europa Donald Trump infrage stellt. Außerdem kauft Russland vor allem günstige Panzer und Flugzeuge aus eigener Produktion, während europäische Länder mehr für ihr Material bezahlen müssen. Dies eingerechnet, geben Europa und Russland laut einer Studie des International Institute for Strategic Studies derzeit etwa gleich viel für das Militär aus. Das neue Fünf-Prozent-Ziel könnte das ändern.