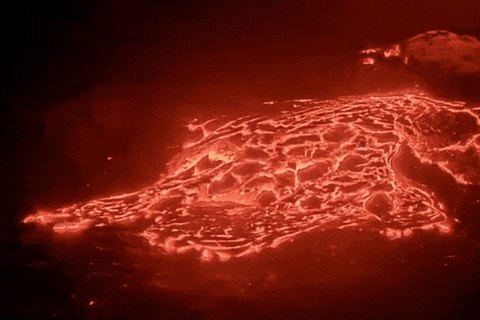GEO: Frau Dr. Scheller, Libyen gilt als gescheiterter Staat. Was bedeutet das für die Hilfe nach der Flutkatastrophe?
Dr. Bente Scheller: Die Katastrophe trifft auf ein Land, in dem es schwer ist, sich rasch ein einheitliches Lagebild zu verschaffen. Das betraf zunächst vor allem das Ausmaß der Katastrophe, aber auch die Berichterstattung und Koordination von internationaler Hilfe. Die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung unter Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba kontrolliert nur den Westen des Landes. Ihr Mandat ist abgelaufen, Neuwahlen wurden bisher immer wieder herausgezögert. Der Osten und damit das von der Flut besonders betroffene Gebiet um die Stadt Darna steht unter der de facto-Herrschaft von General Kalif Chalifa Haftar. Beide Machtblöcke werden durch verschiedene, rivalisierende Milizen unterstützt.
Wofür steht General Haftar?
Haftar führt seit 2015 offiziell die Libysche Nationale Armee an, eine der beiden Streitkräfte, die sich nach dem Sturz Gaddafis gebildet haben. Haftars Herrschaft im Osten Libyens fällt vor allem dadurch auf, dass er das Wohl der Zivilbevölkerung in seinem Einflussbereich vernachlässigt. In den vergangenen Jahren wurde zu wenig Geld in die Infrastruktur investiert. Staudämme wurden nicht ausreichend gewartet, was dazu geführt hat, dass sie angesichts der Wassermassen nun gebrochen sind. Straßen wurden nicht ausgebaut, was es für Hilfskräfte schwierig macht, Güter zu liefern. Haftar setzt seinen Machtapparat vor allem dafür ein, sich weiter zu bereichern und die eigene Machtbasis zu stärken. Korruption und Nepotismus sind zum Selbstzweck geworden. Um die Interessen der Bevölkerung geht es in diesem Land schon lange nicht mehr.

Könnte die Flutkatastrophe Haftars Machtposition schwächen?
Das ist schwer zu sagen. Er steht aktuell unter enormem Legitimationsdruck, denn ganze Dörfer und Stadtteile sind dem Erdboden gleichgemacht. Andererseits befürchte ich, dass Haftar versuchen wird, die humanitäre Hilfe zu politisieren. Indem er internationale Hilfsgüter abzweigt, könnte er sich als großer Helfer inszenieren. Machthaber können von Katastrophen profitieren.
Könnten die Libyer und Libyerinnen aus Protest gegen Haftar auf die Straße gehen?
Das sehe ich zumindest im Moment nicht. Die libysche Bevölkerung hat das Vertrauen in alle Regierenden verloren, sie hat nach 2011 bitter erfahren, dass Demokratie nicht umgesetzt wurde, sondern Libyen zum Gebilde von Räumen begrenzter Staatlichkeit geworden ist. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Proteste der Zivilbevölkerung keinen politischen Wandel bewirkt haben. Der Machtapparat um Haftar ist in Ostlibyen sehr gefestigt.
Wie sinnvoll ist internationale Hilfe im Falle Libyens?
Uns nicht genehme Machthaber dürfen uns nicht darüber entscheiden lassen, ob wir Hilfsgüter schicken oder nicht. Laut der Charta der Vereinten Nationen muss humanitäre Hilfe an diejenigen geliefert werden, die sie brauchen. Katastrophenhilfe rettet Leben und lindert Leid – unabhängig davon, von wem die betroffenen Menschen regiert werden. Das Risiko, dass Hilfsgüter veruntreut werden, müssen wir in Kauf nehmen. Ohnehin sollte gerade die Europäische Union ein Interesse daran haben, den Libyerinnen und Libyern Unterstützung zukommen zu lassen. Hilfe aus Deutschland, durch das Technische Hilfswerk, ist angelaufen, und auch die Europäische Union ist mit mehr als 7 Millionen Euro Soforthilfe unterwegs.
Muss man nicht damit rechnen, dass durch Korruption oder Machtmissbrauch die Hilfsgüter nie die Menschen erreichen, die sie am dringendsten benötigen?
Grundsätzlich ist das immer ein Risiko. Aufgrund der enormen Zerstörungen und das Auslöschen ganzer Landstriche wurde entschieden, die ohnehin stark traumatisierte Zivilbevölkerung in den betroffenen Regionen zu evakuieren und in andere Landesteile zu bringen. Die Solidarität und Hilfsbereitschaft der Libyer*innen ist enorm. Unter den Menschen spielen die politischen Machtkämpfe kaum eine Rolle. Das Land trauert kollektiv. Die Versorgung der Zivilbevölkerung wird in einem großen Maße dezentral über Familienstrukturen erfolgen, wobei die Gastfamilien selbstverständlich auch materielle Hilfe brauchen, die internationale Akteure zur Verfügung stellen. Vor dem Hintergrund dieser Realitäten ist die Sorge um eine Instrumentalisierung der externen Hilfe und um Korruption weniger relevant, auch wenn sie niemals ausgeschlossen werden kann.
Wie könnte es in Libyen in den Monaten nach der Katastrophe weitergehen?
Trotz der unklaren Machtverhältnisse standen die Zeichen in Libyen vor der Katastrophe auf Aufschwung: Mit seinen Exportgütern Öl und Gas profitiert der Staat massiv vom Ukraine-Krieg und steigenden Energiepreisen. Es sind viele neue Arbeitsplätze entstanden, der Internationale Währungsfonds prognostiziert für Libyen 2023 ein Wirtschaftswachstum von 17,5 Prozent. Das hat den Menschen im Land bislang Hoffnung gegeben. Dass die Machtfrage zwischen der international anerkannten Regierung in Tripolis und General Haftar auf absehbare Zeit gelöst wird, sehe ich dagegen nicht. Russland unterstützt Haftar, um dem Westen in der Region etwas entgegenzusetzen und hat kein Interesse daran, Libyen zu stabilisieren.
Nach dem Erdbeben in Marokko wurde die dortige Katastrophenhilfe ebenfalls als schleppend kritisiert. Fällt Katastrophenmanagement Staaten in Nordafrika schwerer als solchen in Europa?
Man kann nicht ganzen Ländern pauschal unterstellen, sie seien nicht in der Lage, effizient Hilfe zu organisieren, wenn sie diese überhaupt wünschen. Es geht hier um Katastrophen wirklich unvorstellbaren Ausmaßes. Wenn wir uns an die Flut im Ahrtal 2021 erinnern, gab es dort ebenfalls viel Kritik, etwa an mangelnden Warnungen und an der langsamen Arbeit von Behörden. Das Problem ist tiefgreifender: Vor allem der Klimawandel konfrontiert uns immer häufiger mit immer schweren Katastrophen wie Flut- und Sturmereignissen oder Waldbränden. Das heißt, alle Staaten sind dazu aufgerufen, neue Mechanismen für den Katastrophenfall zu entwickeln.