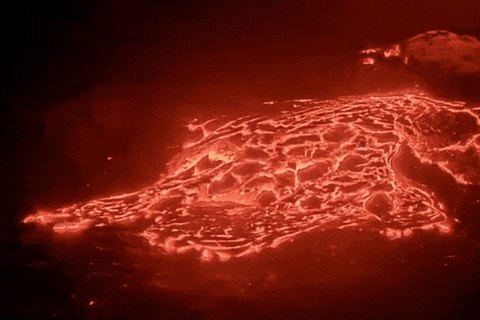Das Hochwasser im Juli 2021 war die größte Naturkatastrophe in Deutschland seit sechs Jahrzehnten. Allein im Ahrtal starben 135 Menschen, weitere 50 Personen in Nordrhein-Westfalen. Die Sachschäden lagen in Deutschland bei mehr als 30 Milliarden Euro. Ursache war ein ungewöhnlich schwacher Jetstream, der ein Tiefdruckgebiet, das sehr warme und feuchte Luftmassen aus dem Mittelmeer mir sich trug, tagelang über einer Region verharren ließ, deren Böden bereits von Niederschlag gesättigt waren. Auf diese Böden prasselten innerhalb weniger Stunden Regenmengen, die sonst in mehreren Monaten hinabregnen.
Katastrophenpotenzial war noch größer
Von schlimmstmöglichen meteorologischen Bedingungen war später die Rede, und dass man diese Überschwemmung als neuen Maßstab im Katastrophenschutz nehmen müsse. Dabei hätte alles noch viel schlimmer ablaufen können, zeigt nun eine Studie in der Fachzeitschrift "Communications Earth and Environment".
Die Forschenden aus den Niederlanden, der Schweiz, der Slowakei und Großbritannien simulierten das Wettergeschehen, indem sie die atmosphärischen Bedingungen nur geringfügig variierten. "Wir könnten glauben, die schlimmsten Überschwemmungen bereits erlebt zu haben", sagt die Hauptautorin Vikki Thompson, die als Klimawissenschaftlerin am Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut arbeitet. "Unsere Forschung zeigt aber, dass die Überschwemmungen in Deutschland im Jahr 2021 mit nur geringfügigen Änderungen der Wetterlage noch verheerender hätten ausfallen können."

Mit ihren Worst-Case-Szenarien wollen die Forschenden den Katastrophenschutz stärken. "Indem wir alle möglichen Szenarien verstehen, können wir Behörden und Gemeinden dabei helfen, sich besser auf zukünftige extreme Wetterereignisse vorzubereiten, die durch den Klimawandel immer wahrscheinlicher werden."
Das Forschungsteam verwendete Computermodelle, in denen es kleine Änderungen an den atmosphärischen Bedingungen in Nordeuropa Anfang Juli 2021 simulierte. Es erstellte verschiedene plausible Szenarien, um zu untersuchen, ob der Niederschlag hätte länger anhalten, sich über größere Gebiete ausbreiten oder an anderen Orten fallen können.
Schon bei kleinen Änderungen zeigte sich, dass dasselbe Wettersystem vier statt drei Tage lang hätte anhalten können. In einem solchen Fall hätten die Flüsse zwischen den Niederschlagsperioden keine Zeit gehabt, das Wasser abzutransportieren. Die Folge wären schlimmere Überschwemmungen flussabwärts gewesen, in Großstädten wie Köln und Bonn.
Die extremen Niederschläge, die Teile Westdeutschlands, Belgiens und der Niederlande trafen, hätten sich auch über weitere und geschlossenere Gebiete ausbreiten können, insgesamt von der Gesamtgröße Belgiens, was die Rettungsdienste in mehreren Ländern gleichzeitig überfordert hätte. Und hätte sich dasselbe Wettergeschehen nur geringfügig nach Westen verschoben, hätten dicht besiedelte Städte wie Maastricht oder Luxemburg die schlimmsten Überschwemmungen erlebt.
Kleine Änderungen mit großen Auswirkungen
Die Studie zeigt: Damit sich ein solcher "perfekter Sturm" zusammenbraut, müssen viele ungünstige Faktoren zusammenkommen. Doch wenn sie einmal da sind, entscheiden vergleichbar kleine Faktoren darüber, wie groß die Katastrophe wird. Nur kleine Veränderungen hätten die Folgen vervielfacht. Daher sollte der Katastrophenschutz nicht nur aus der letzten Katastrophe lernen, was tatsächlich passiert ist, sondern was in einem plausiblen Worst Case hätte passieren können.
Die Hydrologin Hannah Cloke von der Universität Reading warnt: "Der Klimawandel führt dazu, dass extreme Niederschlagsereignisse wie die Überschwemmungen von 2021 häufiger und intensiver auftreten. Die Forschung zeigt uns, dass wir uns auf Szenarien vorbereiten müssen, die über das hinausgehen, was wir bisher erlebt haben, denn die nächste Überschwemmung könnte noch schlimmer sein."