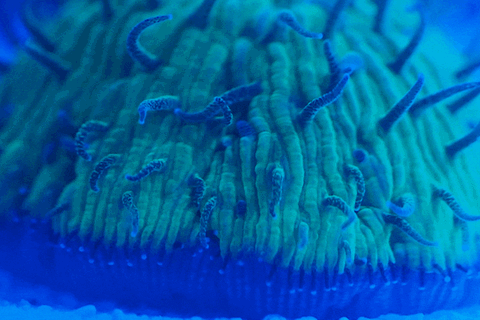Stille Felder aus weißen Korallenskeletten, die bis vor kurzem noch schillernd bunt und von Fischschwärmen umgeben waren: Vor Australien durchziehen Spuren der Zerstörung die Unterwasserwelt des Great Barrier Reef. Auf einer Länge von mehr als 1000 Kilometern hat eine schwere Korallenbleiche die Riffe erfasst. Nach der Auswertung von Unterwasser- und Luftaufnahmen stuft die Nationalparkverwaltung die Schäden nun offiziell als verheerende "Massenbleiche" ein.
Eine Hitzewelle mit Wassertemperaturen von bis zu 30 Grad Celsius setzt den Riffen seit Wochen zu: Derart gestresst, stoßen viele Korallen die winzigen Algen ab, die als "Untermieter" in ihrem Gewebe leben und sie mit Zuckern versorgen. Es bleiben bleiche Korallenpolypen zurück, die mit ihren Tentakeln zwar weiter Nahrung aufnehmen können. Aber sie sind geschwächt und krankheitsanfällig. Hält die Hitze noch länger an, werden die meisten bleichen Korallen daran zugrunde gehen.
Die Katastrophe kommt nicht überraschend: Forschende in Australien verfolgen schon seit November besorgt die Wassertemperaturen am Riff. Wir haben ihre Angst selbst erlebt: Gemeinsam mit den Fotografen Jürgen und Stella Freund war ich für GEO drei Monate lang am Great Barrier Reef unterwegs. Wir haben Wissenschaftsgruppen begleitet, die engagiert daran arbeiten, Korallen im Überlebenskampf mit dem Klimawandel mehr Zeit zu verschaffen. Sie härten in Hightech-Laboren Korallen ab, setzen Abermillionen Larven aus, tüfteln an Schiffen mit Wolkenmaschinen, die besonders wichtigen Riffen kühlenden Schatten spenden sollen.

Nach der desaströsen Korallenbleiche in der Karibik im Sommer 2023 und der Vorhersage eines "El Niño"-Jahres für den Pazifik war allen Forschenden klar: Auch das Great Barrier Reef könnte nun wieder von einer Hitzewelle getroffen werden, wie seit 2016 bereits vier Mal. "Die meisten Korallenbänke hier konnten sich bislang von solchen Schäden zwar wieder weitgehend erholen", erklärte mir Katharina Fabricius, die seit Jahrzehnten in Townsville am berühmten Institut AIMS (Australian Institute of Marine Science) forscht. "Aber eigentlich brauchen sie dafür rund zehn Jahre Zeit". Inzwischen folgen die Hitzewellen viel zu dicht aufeinander: Die Schläge der Klimakrise laugen das Riffsystem aus. "Wir müssen endlich weltweit die globale Erwärmung stoppen", fordert Fabricius, "sonst sieht die Zukunft für die Korallen trotz aller Bemühungen am Riff schlecht aus."
Für die Forschenden ist die Arbeit in den betroffenen Meeresgebieten inzwischen oft schwer zu ertragen: "Ich weiß noch genau, wie ich 2016 zu einem Riff gefahren bin, das für mich immer zu den schönsten gehörte", erinnert sich David Wachenfeld, Leiter des Forschungsprogramms am AIMS: "Doch als ich abtauchte, war es so geisterhaft ausgeblichen, dass ich es nicht geschafft habe, alle beschädigten Stellen zu zählen. Es war ... einfach nicht auszuhalten". Wachenfelds Stimme stockt, und dem erfahrenen Wissenschaftler, der seit 32 Jahren die Korallen Australiens erforscht, kommen Tränen.

Das Great Barrier Reef besteht aus fast 3000 einzelnen Riffen auf einer Ozeanfläche fast ebenso groß wie Deutschland. Nach allen Korallenbleichen bislang hat es darin Überlebende gegeben: "Superkorallen", die auch mit höheren Wassertemperaturen zurechtkommen.
Einige Forschungsgruppen suchen genau solche "Superhelden" unter den Blumentieren, um aus ihnen Korallenriffe der Zukunft zu züchten. Und deshalb ist eine Hitzewelle wie die, an der das Riff derzeit krankt, für die Wissenschaft paradoxerweise zugleich eine niederschmetternde Rückkehr des weißen Todes – und eine Chance: eine Art "notwendige Katastrophe". Denn nur in Stressphasen können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermitteln, welche Korallen des Riffs tatsächlich solche Belastungen aushalten. Und warum.
Die Meeresforscherin Paige Strudwick von der University of Technology Sydney geht am Great Barrier Reef genau diesen Fragen nach: "Die Korallen, die ich beobachte, reagieren sehr unterschiedlich", sagt sie. "Manchen scheinen die hohen Temperaturen tatsächlich nur wenig auszumachen."
Aus solchen Hoffnungsträgern könnten die Riffe der Zukunft erwachsen. Allerdings nur, wenn wir alle als Weltgemeinschaft zugleich dafür sorgen, dass sich das Fieber der Erde nicht immer weiter erhöht.