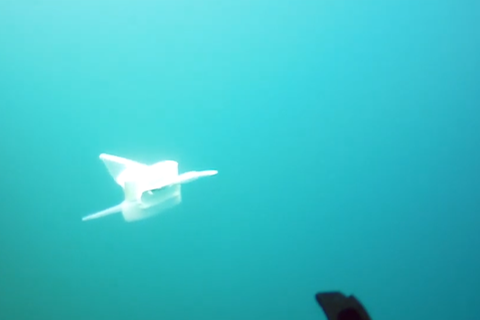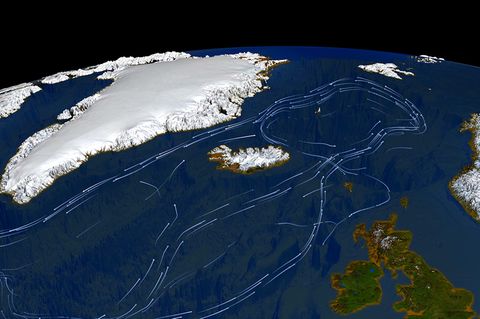Der Leuchtturm auf der Anhöhe über dem Hafen von Taliarte schickt seinen Lichtfinger noch in die Dämmerung, als verschlafene junge Leute Plastikflaschen, Kühlboxen, Wasserschöpfer an Bord der "Plocan 1" hieven, die am Pier festgemacht hat. Rund 20 Minuten jagt das Boot dann an der Ostküste Gran Canarias entlang gen Süden. Als es um eine Landzunge biegt, öffnet sich der Blick auf die Bucht von Gando - und auf neun orangefarbene Gerüste, ein jedes trägt ein Kunststoffdach und eine Positionslampe. Als hätte jemand Gartenpavillons im Meer verteilt, so schaukeln sie auf den Wellen. Drei Meter ragt jede Konstruktion aus dem Wasser, ihr Wesentliches ist allerdings unter dem Meeresspiegel verborgen: An den sechs Pfeilern hängen rund 20 Meter lange Säcke aus dünner Kunststofffolie. Es sind Riesenreagenzgläser, in denen jeweils gut 40 000 Liter Meerwasser schwappen, inklusive Bewohnern von der Alge bis zur Fischlarve.
"Mesokosmen" - so nennen die Wissenschaftler die XXL-Behältnisse. Ein internationales Team unter Führung des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel hat sie installiert. Sie erlauben einen Blick in die Zukunft, weil sie das Schicksal der Meere im 21. Jahrhundert und darüber hinaus simulieren. Die neun Mesokosmen stehen für acht verschiedene Meereswelten. In sieben Schritten bis etwa 2150 nehmen sie eine Entwicklung vorweg, die geprägt sein wird von einer Zutat: von Säure. Denn die Zukunft der Ozeane - sie wird sauer sein.
Die Versauerung der Meere ist der Zwilling des Treibhauseffekts, genauso teuflisch wie dieser, in der Diskussion über den Klimawandel jedoch viel weniger präsent. Die Ursache beider Phänomene: eine Menschheit, die rücksichtslos fossile Brennstoffe verfeuert.
Was heißt "Versauerung"?
Jeder, der in seiner Küche einen Sprudler stehen hat, kennt das Prinzip: Wenn wir CO2 in die Trinkflasche pressen, reagieren Wasser und Kohlendioxid miteinander und bilden Säure. Doch die feine saure Note, die wir im Getränk schätzen, bekommt den Ozeanen nicht. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts ist der CO2-Gehalt in der irdischen Lufthülle von 280 auf knapp 400 Millionstel Volumenanteile (ppm) gestiegen. Der Wert wäre noch viel höher, hätten nicht die Weltmeere rund ein Drittel des Kohlendioxids, das die Menschheit in die Luft geblasen hat, geschluckt. Und das hat sie an ihrer Oberfläche saurer werden lassen. Der pH-Wert, das Maß für den Säuregrad, ist von 8,2 auf 8,1 zurückgegangen.
Aber was bedeutet die Versauerung für das Leben im Meer? Was stellt das veränderte Milieu etwa mit dem Phytoplankton an? Diese Winzlinge stehen am Anfang der marinen Nahrungskette; sie verschaffen aber auch uns die Luft zum Atmen, weil sie mit ihrer Fotosynthese gewaltige Mengen Sauerstoff produzieren. Und wie verkraften Zooplankton, Krebse, Fischlarven oder Flügelschnecken den sinkenden pH-Wert, wie ergeht es größeren Organismen, Seesternen, Oktopussen, Fischen? (Ein Beispiel: Siehe den Kasten unten.) Was wird aus den Räubern an der Spitze der Nahrungspyramide, wenn sich deren Basis verändert? Wie sieht die Zukunft des Ozeans aus?
Tiefgreifende Veränderungen
"Ja, es wird weiterhin Leben im Meer existieren", sagt Riebesell. Ja, wir werden weiterhin im Meer baden können. Aber das Meer wird ein anderes sein. Die marinen Ökosysteme werden sich tiefgreifend wandeln. Welche Folgen das für die Menschen hat, die auf den Ozean als Nahrungs- und Erwerbsquelle angewiesen sind, vermag noch niemand genau zu sagen.
Es kann sein, dass alles noch einige Zeit gut geht. Aber Ulf Riebesell fürchtet, es könnte einen "tipping point" geben, einen Punkt, an dem das Meer kippt, die Zerstörung der Ökosysteme ihren Lauf nimmt. Ohne die Chance, die Folgen der Versauerung dann noch aufzuhalten. Riebesell sieht nur einen Weg, das zu verhindern: konsequenten Klimaschutz.
Lesen Sie die ganze Reportage im GEO Magazin 2/2015.
KORALLEN: ANGRIFF AUFS RIFF
Wie wirkt das Mehr an Säure auf Korallen?
Die Versauerung der Meere setzt unter den Blumentieren vor allem Steinkorallen zu. Sie scheiden an ihrer Fußscheibe Aragonit ab, eine Form von Kalk. Je niedriger der pH-Wert des Wassers, desto schwieriger wird es für die Tiere, diesen Stoff aufzubauen: Das Riff wächst langsamer. Zudem kann das Plus an Kohlendioxid im Ozean, ähnlich wie erhöhte Wassertemperaturen, eine "Korallenbleiche" auslösen: Die Fotosynthese treibenden Organismen, mit denen die Polypen in Symbiose leben und die den Korallen ihre Farbe schenken, werden ausgestoßen. Übrig bleiben die bleichen Nesseltiere. Ohne ihre Symbionten aber können Polypen auf Dauer nicht überleben.
Wie steht es heute um die Riffe?
Die Zahl der riffbildenden Korallen ist in vielen Regionen Südostasiens und der Karibik drastisch zurückgegangen - an manchen Stellen sogar um mehr als 80 Prozent. Studien in Gewässern Südthailands und im Roten Meer registrierten ein zwischen 13 und 24 Prozent geringeres Wachstum von Korallen. Schuld daran sind neben der Versauerung allerdings meist auch höhere Wassertemperaturen, Wirbelstürme und die Verschmutzung der Ozeane. Im Great Barrier Reef Australiens fanden Wissenschaftler allerdings seit den 1970er Jahren einen Rückgang der Kalkbildungsrate um etwa 40 Prozent, den sie vor allem auf die Versauerung zurückführen.
Wie sieht die Zukunft aus?
Düster. Wenn der CO2-Gehalt der Luft weiter steigt, werden die Riffe sich auflösen: Die Korallen bilden nicht mehr ausreichend Kalk, um den Verlust durch Säurefraß auszugleichen. Wann es so weit sein wird, darüber gehen die Prognosen auseinander - vielleicht schon 2040 oder erst 2075. Bereits vorher aber wird sich die Biodiversität in den Riffen drastisch verringern.