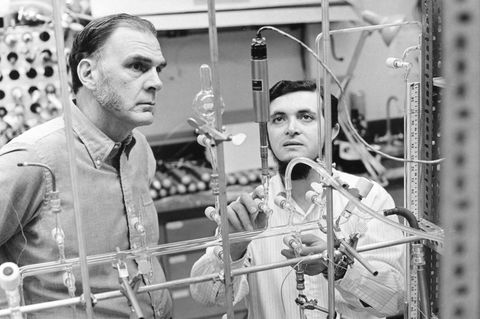Ein differenziertes System der CO2-Besteuerung mit höheren Abgaben auf Emissionen durch Luxus-Konsum würde britischen Forschern zufolge für mehr Gerechtigkeit zwischen Arm und Reich innerhalb eines Landes sorgen. Im Fachblatt "One Earth" stellen sie ein Modell vor, in dem auf Ausgaben etwa für Essen, Reisen, Wohnen und Freizeitaktivitäten eine CO2-Steuer anfällt.
Die Forscher um Yannick Oswald von der englischen University of Leeds unterscheiden dabei zwischen Basis-Konsum und Luxus-Konsum. "Einige Emissionen entstehen im Zuge eines angemessenen Lebensstandards." Dazu gehören den Forschenden zufolge Bereiche wie Wohnen, Essen und der Zugang zu Gesundheitsversorgung. "Andere Emissionen entstehen beim Streben nach Luxus." Dazu zählen sie Langstrecken-Urlaubsflüge und Sommerausfahrten in PS-starken Cabrios.
Manche Emissionen einfacher zu vermeiden als andere
Zwar trage jede ausgestoßene Tonne CO2 gleich zur Klimaerwärmung bei, doch manche Emissionen seien einfacher zu vermeiden als andere. "Es ist aus sozialen und Gerechtigkeitsgründen sowie mit Blick auf die Klimaschutzziele richtig, verstärkt Emissionen zu senken, die durch noch zu definierenden Luxus-Konsum entstehen", sagt Andreas Burger vom Umweltbundesamt (Uba), der nicht an der Studie beteiligt war.
Reiche Menschen erzeugten durch ihren Lebensstil oft deutlich mehr CO2-Emissionen und wälzten die dadurch entstehenden Umweltkosten zum Teil auch auf die Gesellschaft ab, sagte Burger. Er bezweifelt allerdings, ob das nun vorgestellte Instrument der beste und aussichtsreichste Weg ist.
CO2-Steuern sind ein politisches Werkzeug, um klimaschädliche Anschaffungen und Aktivitäten teurer zu machen und dadurch Emissionen zu senken und Geld für Klimaschutzmaßnahmen einzunehmen. Solche Steuern gibt es beispielsweise in Mexiko, Kanada, Frankreich und Großbritannien. In Deutschland gibt es die Energiesteuer und eine CO2-Bepreisung über den Emissionshandel, aber keine CO2-Steuer.
Art der Ausgabe in den CO2-Preis mit einfließen lassen
Dem Team um Oswald zufolge werden in Ländern, in denen es eine CO2-Steuer gibt, alle Emissionen gleich belastet - oder der Preis gilt nur für Emissionen aus bestimmten Bereichen, beispielsweise Wärme und Treibstoff. Aus Sicht der Forscher wäre es aber gerechter, in die Berechnung des CO2-Preises auch die Art der Ausgabe einfließen zu lassen und damit reiche Haushalte stärker zu belasten.
Der CO2-Ausstoß pro Kopf variiert stark zwischen armen und reichen Ländern. Aber auch innerhalb Deutschlands sind die Unterschiede immens, und dabei muss man noch nicht einmal arme Menschen mit Milliardären vergleichen. So weist das Umweltbundesamt in einem 2020 veröffentlichten Bericht darauf hin, dass in Haushalten mit weniger als 1000 Euro Nettoeinkünften im Monat im Durchschnitt rund sechs Tonnen Treibhausgas-Emissionen pro Jahr verursacht werden. Bei ansonsten gleichbleibenden Eigenschaften sind es für einen Haushalt mit Nettoeinkünften von über 4000 Euro dagegen circa 13 Tonnen - also mehr als doppelt so viel.
In seine Berechnungen bezog das Team um Oswald Daten aus 88 Ländern ein, darunter sowohl ärmere als auch reichere. Es bildete 14 Konsumkategorien und versah sie - je nach Land - mit einem spezifischen CO2-Preis. Im Beispiel USA würden etwa auf den Autokauf und auf Flugreisen mehr als 200 US-Dollar pro erzeugter Tonne CO2 anfallen, auf Heizung und Strom weniger als 100 Dollar. Dieses differenzierte System verglichen die Forscher mit einem System eines einheitlichen CO2-Preises, den sie in den USA mit 150 US-Dollar pro Tonne ansetzen.
Aus Sicht der Forscher ist ihr System gerechter. Bei unterschiedlich hohen CO2-Steuern würden demnach weltweit 52 Prozent der angefallenen Abgaben von Luxusausgaben stammen, im Vergleich zu 37 Prozent bei einem einheitlichen Steuersatz. Reichere Haushalte müssten sowohl relativ als auch absolut mehr CO2 einsparen, beziehungsweise mehr zahlen, wenn sie das nicht tun.
Damit das differenzierte Steuersystem tatsächlich maßgeblich zum Erreichen der Pariser Klimaziele beitragen könne, müsse es zeitnah, universell und mit hohen, steigenden CO2-Preisen eingeführt werden, schreiben die Forscher.
Burger vom Uba betrachtet die Überlegungen der Forscher insofern als eine Art "schöne Utopie": "Es ist gut, dass das mal durchgerechnet wurde. In der Praxis dürfte eine höhere CO2-Besteuerung für Luxuskonsum nur selten das Mittel der Wahl sein." Er sieht unter anderem praktische Probleme bei der Umsetzung. Wie definiert man, was Luxus- und was Basisausgaben sind? "Bei Privatjet und Yacht ist das eindeutig. Beim Auto ist das schon schwieriger", sagt Burger.
Außerdem gäbe es andere Möglichkeiten, um die Klimapolitik gerechter zu gestalten. Dazu gehöre zum Beispiel die Streichung von umweltschädlichen Subventionen, etwa des sogenannten Dienstwagenprivilegs sowie eine höhere Besteuerung großer, emissionsintensiver Pkw bei der Kraftfahrzeugsteuer. Zudem sollte man die Einnahmen aus der CO2-Steuer einsetzen, um ärmere Haushalte durch ein Klimageld zu entlasten und Förderprogramme auflegen, die auch diesen Haushalten Investitionen zur Senkung ihres fossilen Energieverbrauchs ermöglichen, sagt Burger.
Ein Problem des nun vorgeschlagenen Modells, das die Forscher um Oswald auch selbst sehen, ist, ob Behörden überhaupt genug Informationen haben, um eine solche Steuer einzuführen. Schließlich müsste für jede Art von Konsum eindeutig festgestellt werden, ob es in die Kategorie Luxus oder Basis fällt. Zudem erwarten die Forscher eine große Gegenwehr: "CO2-Steuern mit Luxus-Fokus zielen auf Gruppen mit hohen Einkommen. Diese dürften am besten in der Lage sein, gegen eine solche Maßnahme zu lobbyieren", heißt es in einer Mitteilung.
"Trotz der Einschränkungen unseres Modells, die Botschaft ist diese: Wenn man Klimamaßnahmen konzipiert, kann man die unterschiedlichen Konsumarten miteinbeziehen", sagt Oswald. "Und das würde solche Maßnahmen fast standardmäßig gerechter machen."