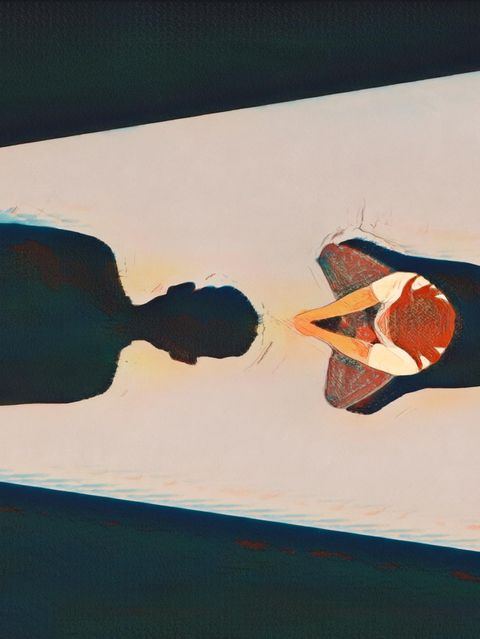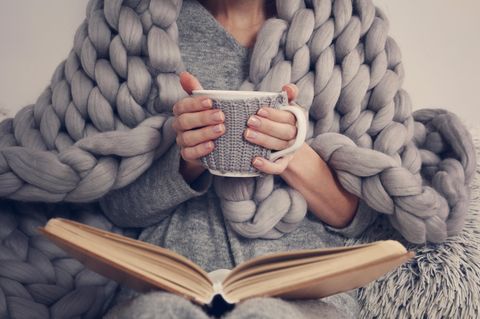"Das schaffe ich nie", dachte ich vor meinem ersten Winterbad. Und: "Ich will es schaffen." Aus dem beheizten Auto schaute ich auf die unruhige, graue Nordsee. Der Wind pfiff durch das einen Spaltbreit geöffnete Fenster, dichte Wolken hingen am Himmel. Nicht die besten Voraussetzungen.
Am Morgen des 1. Januars 2023 erschien mein guter Vorsatz plötzlich lächerlich: Ein Eisbad nehmen, um das neue Jahr mit einem Erfolg zu beginnen. Trotzdem redete ich mir ein, dass es machbar sei und die Weichen für weitere Veränderungen in meinem Leben stellen würde. Also stieg ich aus dem Auto und den warmen Klamotten – der erste Härtetest, auf den sofort der erste Fehler folgte. Denn nach ein paar tiefen Atemzügen marschierte ich mit angehaltener Luft geradewegs in das kalte Nass, um den Moment der Überwindung schnell hinter mich zu bringen – bis mich die Kälte stoppte. Das Wasser reichte bis zu den Oberschenkeln, als ich abrupt stehen blieb und aufgeben wollte. Ich war zu schnell vorgeprescht und völlig unvorbereitet.
Der Kopf ist das Limit – und muss es manchmal auch sein
Ein Fehler, der böse enden kann. Zwar geht die Forschung davon aus, dass Kältereize eine positive Wirkung auf die Gesundheit haben. Kurzzeitiger biologischer Stress kann Stoffwechselvorgänge anregen, die Widerstandskraft erhöhen und Abwehrkräfte stärken. Auch auf Entzündungsprozesse und die Gefäßgesundheit soll ein Eisbad, wovon man wissenschaftlich übrigens erst ab einer Wassertemperatur von fünf Grad und kälter spricht, positiv wirken. Teilnehmende einer finnischen Studie aus dem Jahr 2004 gaben an, dass ihre Beschwerden bei Rheuma, Fibromyalgie oder Asthma nachgelassen hätten. Insgesamt hatte sich das Wohlbefinden der Winterbadenden verbessert. Stress, Anspannungen und Müdigkeit nahmen ab, während die Stimmung und das Energielevel profitierten. Forschende der Arctic University of Norway konnten außerdem einen positiven Effekt auf die Fettverteilung im Körper nachweisen: Winterschwimmen verringert demnach gesundheitsschädliches weißes Körperfett. Positive Kältereize sind sogar Gegenstand der Langlebigkeitsforschung und sollen imstande sein, die Lebenszeit zu verlängern.
Dennoch sind die Risiken des Eisbadens nicht zu unterschätzen. Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollten davon absehen. Untrainierten Personen drohen Herzrhythmusstörungen oder starke Unterkühlungen bis hin zum Kälteschock.
In meinem Fall ging es gut. Trotzdem waren die Auswirkungen auf den Körper deutlich spürbar. Das Wasser tat weh, es stach auf der Haut wie viele kleine Nadeln. Als es mir schließlich bis zum Hals reichte, fiel das Atmen schwer, ich schnaufte, fluchte und lachte, konnte aber kaum ein vernünftiges Wort mit meiner Begleitung wechseln. Wir hielten es wenige Minuten aus und eilten zurück an Land, um bibbernd in Jogginghosen und Bademäntel zu schlüpfen. Die Füße wie Eisblöcke, der Wind fast warm auf der geröteten Haut. Später las ich in der lokalen Zeitung, es hatten milde Temperaturen von etwa sieben Grad im Wasser und zwölf Grad in der Luft geherrscht – einen "Warmbadetag" nannten es erfahrene Teilnehmende des traditionellen Neujahrsschwimmens.
Auf dem Heimweg fror ich noch immer. Mit steifen Händen und in Eile hatte ich mich nicht vollständig abgetrocknet. Trotzdem war ich stolz, voller Energie und lebte – davon war ich überzeugt – ab jetzt rauchfrei. Nun garantiert der Gang ins kalte Wasser keinen erfolgreichen Rauchstopp, und wer erwartet, sich als neuer Mensch aus dem Eisbad zu erheben, wird vermutlich enttäuscht. Doch unzählige gescheiterte Versuche waren diesem vorangegangen, und das Winterbad sollte Mittel zum Zweck sein: um etwas zu schaffen, das genauso unmöglich erschien.
Fehler vermeiden: Tipps für das erste Eisbad
- Rücksprache mit einem Arzt oder einer Ärztin halten, gegebenenfalls eine sportmedizinische Untersuchung durchführen lassen
- Zur Vorbereitung einige Wochen kalt duschen oder bereits im Spätsommer mit dem Naturschwimmen beginnen
- Das erste Eisbad unter professioneller Anleitung durchführen oder zumindest eine Begleitperson mitnehmen
- Vor und während des Eisbads kontrolliert und regelmäßig atmen
- Niemals an steil abfallenden Ufern oder mit vollem Magen ins Wasser steigen
- Niemals kopfüber in das kalte Wasser springen
- Nicht zu lange im kalten Wasser ausharren
- Bei Kältezittern, Atemnot oder anderen Beschwerden sofort das Wasser verlassen
- Gründlich abtrocknen, nicht zu schnell aufwärmen
Mehr dazu erfahren Sie hier.
Zwischen Vernunft und Ausrede – ein schmaler Grat
Nachdem der erste Schritt also getan war, lautete mein neuer Vorsatz, jeden Monat einmal in der Nordsee zu baden. Diese Regelmäßigkeit war auch wichtig, erst nach einem Jahr erfolgte eine entscheidende Veränderung des Mindsets. Ich hatte mir realistische Ziele gesetzt und mich daran gehalten. Damit kam ein neues Verständnis für meine Möglichkeiten und Grenzen.
Im nächsten Winter spielte ich mit dem Gedanken, vom Eisbaden zum Eisschwimmen überzugehen. Wie lange würde ich es wohl im kalten Wasser aushalten? Grenzen zu verschieben motivierte mich – auch in anderen Lebensbereichen. Im folgenden Jahr joggte ich zum ersten Mal zehn Kilometer am Stück und meldete mich zu einem Bootcamp an. Für andere keine Besonderheit, für mich (unsportlich und introvertiert) eine große Überwindung.
Die neue Willenskraft brachte mich allerdings auch ans Limit. So absolvierte ich einen Mammutmarsch über 42 Kilometer – ein Wanderevent mit Tausenden Teilnehmenden, bei dem ich ohne konkrete Vorbereitung an den Start ging. Ich glaubte einfach, dass ich es schaffen kann. Und es gelang – wenn auch mit offenen Blasen an den Füßen und schmerzenden Beinen. Am Abend konnte ich kaum einen Fuß vor den anderen setzen.
Beschwerden nach dem Sport waren keine Seltenheit. Oft plagten mich Schwindel und Kopfschmerzen, manchmal die ganze Nacht. Einmal war die Migräne so stark, dass ich erbrechen musste. Wie beim ersten Winterbad wollte ich zu schnell zu viel und stieß an meine Belastungsgrenze. Der Sportpsychologe Hans-Dieter Hermann spricht im GEOplus-Interview von mentalen Strategien, die zu besseren Leistungen und mehr Selbstvertrauen verhelfen können. Dazu gehören bestärkende Selbstgespräche und eine zielgerichtete Einstellung, die ich auch bei mir feststellen konnte. Gleichzeitig warnt Hermann jedoch vor Übertreibung und Selbstüberschätzung. Vor allem im Freizeitsport seien die Ziele oft zu hoch, der unvorbereitete Organismus erlebe enorme Belastungen als bedrohliche Situation.
Ich musste also lernen, besser auf meinen Körper zu hören, und akzeptieren, dass ein an das Leistungsvermögen angepasstes Training gesünder ist als ein mit Willenskraft erzwungener Erfolg. Gelernt habe ich aber auch: Zwischen Vernunft und Ausrede liegt ein schmaler Grat. Die Kunst besteht darin, einen Mittelweg zu finden. Sollte ich das Schwimmen absagen, weil Regenwolken aufziehen? Nein. Sollte ich beim Sport kürzertreten, weil sich eine Erkältung anbahnt? Ja! Muss ich immer länger im kalten Wasser ausharren, um mir selbst etwas zu beweisen? Nicht mehr.
Um meinen Körper kennenzulernen, musste ich ihn aber belasten. Eine Studie von Olga Pollatos, Professorin für Gesundheitspsychologie an der Universität Ulm, zeigt, dass Sporttreibende ihren Körper besser wahrnehmen können. Ich möchte meine neu erlernte Freude an Bewegung beibehalten und ausbauen, um meine Gesundheit zu fördern, statt sie zu gefährden. Teil davon bleibt: Hin und wieder etwas aushalten, das unbequem ist. Und manchmal die Komfortzone verlassen, um zu wachsen. Aber nicht auf Zwang.

Produkttipps für das Naturschwimmen
- Schwimmboje – erhöht die Sichtbarkeit und dient im Notfall als Rettungsboje
- Surfponcho – hält nicht sonderlich warm, hilft aber ungemein beim Abtrocknen und Umziehen, auch im Sommer
- Mütze und Wollsocken – über den Kopf geht viel Wärme verloren, die Füße sind nach dem Winterbad eiskalt
- Thermobecher – ein heißer Tee tut besonders gut, wenn ein längerer Heimweg ansteht
- Wärmekissen – zu Hause angekommen, springt man nicht gleich unter die heiße Dusche, sondern wärmt sich langsam wieder auf
Die Dinge nehmen, wie sie kommen
Irgendwo zwischen Disziplin und Gelassenheit fällt es mir mittlerweile nicht mehr so schwer, in der kalten Nordsee zu baden. Nicht, weil ich weniger kälteempfindlich bin, sondern weil ich weiß, was kommt. Das Durchspielen von Bewegungen und Handlungen im Kopf kann laut dem Sportpsychologen Hermann ein Schlüssel zum Erfolg sein, weil Abläufe automatisiert und optimale Leistungen abgerufen werden können. Obwohl das monatliche Naturschwimmen kein sportlicher Wettkampf ist, hilft mir diese Strategie: Erst einmal die Füße. Atmen. Dann bis zu den Oberschenkeln. Atmen. Weiter bis zum Bauch. Zwischendurch, wenn Zweifel aufkommen, der Gedanke: "Ich habe das schon oft gemacht, ich kann das." Zum Schluss eine letzte Überwindung: einfach bis zum Hals abtauchen – kontrolliert, aber zügig.
In der Wahrnehmung schrumpft für einen Moment die Welt zusammen, und man ist ganz bei sich. Das Wasser sticht nach wie vor auf der Haut, die Atmung will schnell und flach gehen, lässt sich aber kontrollieren. Das erfordert volle Konzentration auf mich, bevor der Wahrnehmungskreis sich wieder erweitert. Als Erstes spüre ich das Wasser um mich herum, dann geht der Blick zu meiner Freundin, meistens lächeln wir uns kurz an, manchmal entfährt uns ein "Boah!" oder "Puh!", manchmal auch ein trockenes "Heute geht's". Es folgt der Blick in die Ferne. Ich nehme die Weite von Meer und Himmel bewusst wahr und finde darin Ruhe. Diesen Moment nicht zu verpassen ist inzwischen wichtiger als jeder neue persönliche Rekord.
Im Sommer gibt es kein Eisbad, sondern eine erfrischende Abkühlung in der Nordsee. Wir stellen bewusst kein Eisfass im Garten auf. Zu unserer monatlichen Verabredung gehört nämlich auch, die Gegebenheiten so zu nehmen, wie sie sind. Es hilft dabei, Abgrenzung zu lernen: Ich möchte nicht die Dinge um mich herum kontrollieren, sondern mich in ihnen. Durch das Naturschwimmen gehe ich anders mit Herausforderungen und Selbstzweifeln um. Nicht, weil es abhärtet, sondern weil es zugleich erdet und ermutigt, offen für Neues zu sein.