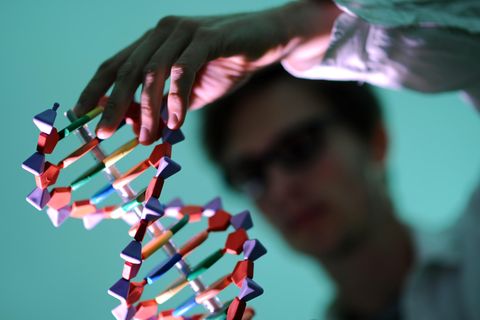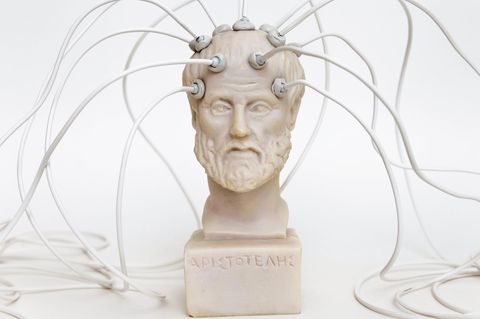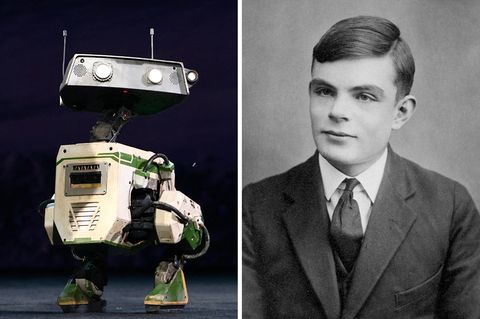GEO.de: Frau Spiekermann-Hoff, Elon Musk hat in der vergangenen Woche angekündigt, er wolle binnen sechs Monaten den ersten Menschen Computerchips ins Gehirn einpflanzen lassen. Er verspricht, Gelähmte gehen und Blinde sehen zu lassen. Ein Grund zum Jubeln?
Sarah Spiekermann-Hoff: So lange sich das Unternehmen im medizintechnischen Umfeld bewegt, so lange es darum geht, bei Schwerstbehinderten über Gehirnimpulse motorische Funktionen zu aktivieren, und so lange Neuralink sich an die gesetzlichen Vorschriften hält, die mit Menschenversuchen verbunden sind, finde ich das absolut legitim.
Musk verfolgt mit seinem Unternehmen Neuralink langfristig noch ein größeres Ziel: Er sorgt sich um den Siegeszug der Künstlichen Intelligenz und will Menschen für den Wettstreit mit ihr mit Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCI) technologisch aufrüsten. Überzeugt Sie das?
Das ist der blanke Unsinn. Die größte Gefahr, die von KI ausgeht, ist, dass sie uns abhängig macht oder emotional verführt oder verwirrt. Ein Beispiel: Wenn Menschen nicht mehr auffällt, dass es kein Mensch, sondern eine KI ist, die mit ihnen spricht, dann ist das zumindest potenziell hoch manipulativ. Wir könnten von einem solchen KI-Begleiter abhängig werden. Das ist tatsächlich eine große Gefahr. Solche Abhängigkeits- und Manipulationsprobleme löst man aber nicht mit einem Gehirnchip, mit dem wir dann angeblich automatisch auf Wikipedia zugreifen können soll. Denn Informationen oder gar Apps lassen sich nicht ins Gehirn "hochladen" wie auf eine Festplatte. Das ist ein grundlegendes Missverständnis.
Das müssen Sie erklären.
Ich bin erstaunt, dass man darüber überhaupt seriös redet. Denn im Gehirn gibt es im informationstechnischen Sinn gar keine Daten. Es gibt nur neurobiologische Zustände, die sich von Moment zu Moment verändern. Mit solchen technisch-wirren Ideen wird die Komplexität der Gehirnfunktion und der Funktionsweise des Gedächtnisses unterschlagen. Neuralink hat damit geworben, dass ein Affe mithilfe eines Gehirnchips ein Computerspiel mit dem Namen Pong spielt.
Im Wesentlichen funktionierte das so: Der Affe bewegte einen Punkt auf einem Bildschirm mithilfe eines Computers und eines Sticks. Dabei wurde die Gehirnaktivität aufgezeichnet und einer spezifischen Bewegung auf dem Bildschirm zugeordnet. Später "übersetzte" der Computer die Gehirnaktivität des Affen in die Punktbewegung auf dem Bildschirm. So konnte der Makake das Spiel schließlich sogar ohne Stick, allein aufgrund seiner Hirnaktivität spielen. Elon Musk und die IT-Industrie drumherum machen einen nicht erklärbaren Sprung, wenn sie von solchen einfachen Funktionen zu einem Übermenschen gelangen wollen, der durch seine Gehirnströme die Welt um sich herum steuert. Den technischen Pfad dahin sehe ich nicht.
Doch genau das, also die potenziell unbegrenzte Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten mit dem Mittel der Technik, ist doch das erklärte Ziel von Musk und anderen?
Diesem Irrtum liegt die Vorstellung vom Gehirn als einer Art Computer zugrunde. Der Körper ist keine Hardware, der Geist keine Software. Beim Menschen gibt es die Trennung zwischen beidem nicht, denn denken und leben bedeutet permanente Veränderung des biologischen Systems. Der Körper rekonfiguriert sich im Prozess des Lebens fortwährend selbst. Nach neueren Forschungen ersetzen sich 40 Prozent der Synapsen auf einem Neuron täglich neu. Keine Software macht das mit ihrer Hardware.

Können Sie sich auf Erkenntnisse aus der Kognitionsforschung stützen?
Die kognitionswissenschaftlichen Forschungen der vergangenen 30 Jahre zeigen, dass wir nicht nur mit dem Kopf denken, sondern mit dem ganzen Körper. Die Gefühle des Menschen sind ein permanenter Teil dessen, was das Gehirn tut, was wir denken. Gleichzeitig ist nichts von dem, was wir tun, getrennt von dem, was sich in unserer Umwelt befindet. Der Geruch von Chlor erinnert mich an das Schwimmbad meiner Kindheit. Der Geruch von Plätzchen macht mir gute Laune und lässt mich anders mit jemandem reden als der Geruch eines Bahnhofs. Die gesamte Information aus unsrer Umwelt ist Teil unseres Seins. Ein Computer kann so etwas gar nicht reproduzieren – und darum auch kein Selbst und kein Bewusstsein haben.
Trotzdem verkauft sich dieses Menschenbild ziemlich gut, etwa in Gestalt der Thesen des Militärhistorikers Yuval Harari …
Ähnlich wie Musk betreibt Harari in seinem Buch "Homo Deus" eine Art Computeranthropologie. Er propagiert die Idee, dass der Mensch nichts anderes sei als ein datenverarbeitendes System, ähnlich wie ein Computer. Das Gefährliche bei Harari ist, dass er so bekannt ist, dass er seine Ideen unseren Wissenschaftlern, Politikern und Investoren als neuesten wissenschaftlichen Stand oder gar als Zukunftsmodell verkauft – und noch dazu im Stil eines Sachbuchs.
Angesichts der Versprechungen der IT-Branche wirken philosophische oder ethische Einwände oft kleinlich. Ist das ein Problem?
Die IT-Industrie schafft es, völlig realistische, wissenschaftlich legitime Einwände gegen ihre Ideen als kleinlich erscheinen zu lassen, als nicht fortschrittlich, als Maschinenstürmerei. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Industrie uns einfach immer neue Technik verkaufen will. Und sie hat die Macht über die Informationsflüsse, über das, was in den Medien und unseren Newsfeeds passiert. Sie sorgt dafür, dass ihre Idee von der Zukunft und vom Fortschritt gesehen und gehört wird, und dass Alternativen und sinnvolle Argumente weggedrückt und verharmlost werden. Wir haben es mindestens seit zehn Jahren mit einer einseitigen Information zugunsten des IT-Geschäftsmodells zu tun. Ich kann Ihnen aber versichern, dass jeder seriöse Wissenschaftler, der sich zum Beispiel in der klinischen Forschung mit Menschen beschäftigt, den Kopf schüttelt über Aussagen von Neuralinkern, Harari und anderen.
Werden die denn gehört?
Zu wenig. Wissenschaftler, die sich im üblichen Veröffentlichungsprozess durchsetzen müssen, werden in der öffentlichen Wahrnehmung von Stimmungsmachern wie zum Beispiel dem Neurokonstruktivisten David Eagleman und anderen an die Seite gedrückt. Es gibt einige solche wissenschaftliche Stimmungsmacher, die den Geschäftsmodellen der IT-Industrie zuarbeiten. Und das über erstaunlich skurrile wissenschaftliche Erfolgspfade und Drittmittelprojekte, ohne eine Habilitation oder ordentliche Berufungsprozesse. Wenn solche Leute – wahrscheinlich von der IT-Industrie gepushte – populäre Bestseller veröffentlichen, verdrängen sie medial die echte Wissenschaft.
Wer bestimmt eigentlich, wo die Grenzen der IT-Technologie liegen, was wünschenswert ist und was nicht?
Was wünschenswert ist, bestimmt die IT-Industrie. Sie hat ihre Idee von der Zukunft zugunsten ihres eigenen Geschäftsmodells monopolisiert. Und je mehr die Branche den Menschen als Teil ihrer Maschine verorten kann, desto lukrativer für sie. Ohne die Unterstützung von kritischen Journalisten ist es kaum noch möglich, öffentlich eine alternative Zukunft und eine Orientierung an anderen Werten als der Science-Fiktion-Ökonomie des Silicon Valley zu formulieren. Science-Fiction regiert dank der märchenhaft reichen IT-Branche die Fantasie unserer Zeit. Aber Science-Fiction ist dunkel, und unsere Erde – das Einzige, was wir wirklich haben – ist in dieser Literatur nur ein Planet unter vielen. Das kann kein Zukunftsmodell sein.