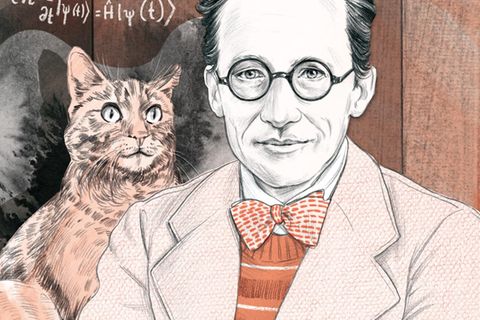Die isländische Halbinsel Reykjanes befindet sich regelmäßig im Ausnahmezustand. Immer wieder erschüttern Tausende Erdbeben die Region, reißen klaffende Spalten in die Erdoberfläche. Ausgelöst werden sie vom Vulkan Fagradalsfjall: In etwa 800 Metern Tiefe hat sich ein rund 15 Kilometer langer Tunnel gebildet, darin steigt flüssiges Gestein auf und bahnt sich seinen Weg an die Erdoberfläche.
Forschende überwachen jede Regung des Vulkans. Doch wie lässt sich überhaupt herausfinden, welches Unheil sich im Erdinnern zusammenbraut?
Seismometer registrierten in Island zuletzt mehr als tausend Beben am Tag
Der Fagradalsfjall, der Island derzeit in Aufruhr versetzt, ist einer von rund 1500 aktiven Vulkanen weltweit. Insbesondere jene, deren Ausbruch Menschenleben gefährden könnte, werden engmaschig überwacht. Denn bevor ein Vulkan ausbricht, gibt es durchaus Warnzeichen, etwa die gesteigerte seismische Aktivität: Das aufsteigende Magma erzeugt Spannungen im Gestein, die sich oft in Form von Erdbebenschwärmen entladen. Seismometer messen diese Erschütterungen. In Island registrierten sie zuletzt oft mehr als tausend Beben am Tag.
Die seismischen Wellen sind nicht nur ein Warnsignal, sondern liefern Forschenden auch wichtige Einblicke ins Erdinnere. Ihre Eigenschaften verraten, in welcher Tiefe das Beben seinen Ursprung nahm, und sie geben Aufschluss über die Beschaffenheit des Untergrunds. Heißes und lockeres Material etwa verlangsamt ihre Reise. So lässt sich mit Hilfe der Erschütterungen ein dreidimensionales Modell der Lage im Untergrund erstellen.
Seismometer sind jedoch nicht die einzigen Sensoren, die den Zustand von Vulkanen überwachen. Messgeräte detektieren etwa Gase wie Kohlendioxid und Schwefeldioxid, die sich aus dem Magma lösen und aus Rissen, Spalten, oder, wie derzeit in Island, aus einem Bohrloch austreten.
GPS-Sensoren und Tiltmeter (Neigungssensoren) an den Bergflanken eines Vulkans erspüren die Bewegungen des Bodens. Schwillt im Erdinnern eine Magmablase an, kann er sich um mehrere Zentimeter aufwölben. Diese Hebungen sind auch aus großer Höhe zu beobachten: Satelliten mit Radartechnologie können die Erdoberfläche sogar im Dunkeln oder bei bewölktem Himmel genau vermessen. Tasten die von ihnen ausgesandten Funkwellen dasselbe Gebiet mehrmals ab, offenbart die Differenz in den Messdaten, wo und wie stark sich die Erde gehoben oder gesenkt hat.
Die Überwachungstechnik liefert Wahrscheinlichkeiten, keine sicheren Vorhersagen
Infrarotmessungen von Satelliten, Drohnen und Wärmebildkameras wiederum machen sichtbar, ob sich der Boden aufheizt. Auch das vergangene Verhalten eines Vulkans interessiert Forschende. Anhand von Aufzeichnungen und Gesteinsanalysen rekonstruieren sie historischen Ausbrüche. So versuchen sie, den Vulkan und seine Eigenarten kennenzulernen.
In Island fließen Satelliten- und GPS-Daten derzeit in geophysikalische Computermodelle ein, die die Vorgänge im Erdinnern und das Risiko eines Ausbruchs berechnen. Doch letztlich liefern sie lediglich Wahrscheinlichkeiten: Ob der Vulkan ausbricht, wann, wo und wie sich das Magma schließlich seinen Weg an die Erdoberfläche bahnt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Der isländische Wetterdienst schreibt auf seiner Website: "Unsere Vorbereitungen zur Überwachung und Gefahrenabschätzung beruhen nach wie vor auf der Annahme, dass sich die Situation plötzlich und ohne Vorwarnung ändern kann."