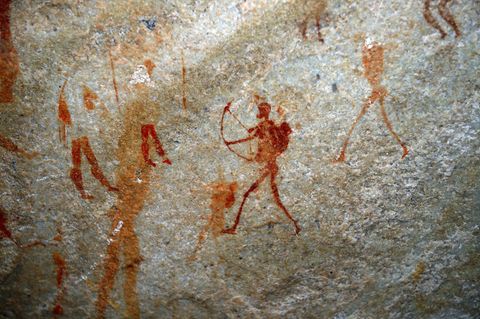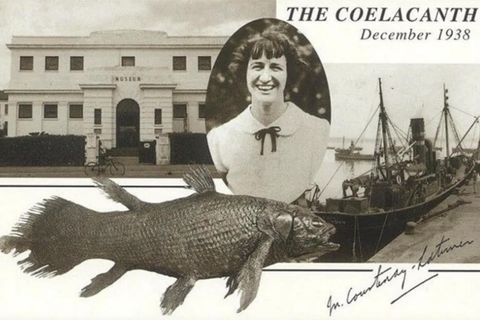Ob Makaken oder Spinnenaffen, Koboltmakis oder Languren: Viele Primaten bewegen sich mithilfe ihres agilen Schwanzes elegant durchs Geäst. Je nach Situation und Lebensweise dient der Fortsatz der Wirbelsäule als Stütze, Balancierhilfe, zusätzliche Hand. Er ist ein unbestrittenes Erfolgsmodell der Evolution.
Doch vor rund 25 Millionen Jahren spaltete sich von den Schwanzträgern eine Gruppe ab, die das Merkmal verlor: die Menschenartigen, auch Hominoidea genannt. Zu ihren heutigen Vertretern zählen Gibbons, Gorillas, Orang-Utans, Schimpansen und der moderne Mensch. Ihm blieben nur wenige Schwanzwirbel, die noch im Mutterleib zu einem dezenten Steißbein verwachsen. Der aufrechte Gang könnte Folge oder Treiber dieser Entwicklung gewesen sein. Die These ist jedoch nicht unumstritten: Manche Forschende argumentieren, dass ein Schwanz bei der Fortbewegung auf zwei Beinen nicht hinderlich ist, sondern zusätzliche Stabilität verleihen kann.
Doch nicht nur die Frage nach dem Warum ist offen. Ungeklärt war bislang auch: Wie kam den Menschenartigen der Schwanz überhaupt abhanden? Die Antwort liegt in unseren Genen.
Eine Veränderung des Gens Tbxt führt auch bei Mäusen zu kürzeren Schwänzen
Schuld könnte ein marodierender DNA-Abschnitt namens "AluY" sein, wie ein Team um Bo Xia und Itai Yanai vom medizinischen Forschungszentrum Langone Health der New York University herausfand. Alu-Sequenzen sind sprunghafte genetische Elemente, die im Laufe der Entwicklungsgeschichte immer mal wieder ihre Position im Erbgut wechseln. Bei den Menschenähnlichen mogelte sich AluY in ein Gen namens "Tbxt". Es zählt zu jenen Genen, die bei Wirbeltieren die Entwicklung des Schwanzes steuern. Ist eine Kopie des Gens etwa bei Mäusen, Hunden oder Katzen defekt, fehlt ihnen der Schwanz oder ist missgebildet. Sind beide Kopien defekt, sind die Embryonen meist nicht lebensfähig.
In den Zellen der schwanzlosen Primaten führte die neu eingebaute Alu-Sequenz dazu, dass die Zelle unvollständige Abschriften des Gens anfertigt. Sie schneidet einen Abschnitt einfach heraus. Die Proteine, die nach der verkürzten Anleitung gefertigt werden, scheinen ihren ursprünglichen Job nicht mehr einwandfrei erledigen zu können. Das zeigten Versuche mit Mäusen, deren Tbxt-Gen die Forschenden auf verschiedene Weise genetisch verändert hatten.
Je weniger vollständige und je mehr verkürzte Abschriften die Zellen der Nager während der Embryonalentwicklung fertigten, desto kürzer geriet auch der Schwanz der Tiere. Manche Mäuse kamen sogar ganz ohne Schwanz zur Welt. Im Extremfall zeigten sie tödliche Missbildungen, weil sich das Neuralrohr nicht schloss und das Rückenmark frei lag. Solche Neuralrohrdefekte plagen rund eines von 1000 menschlichen Neugeborenen, etwa in Form von Spina Bifida, umgangssprachlich als "offener Rücken" bezeichnet.
Das Forschungsteam geht davon aus, dass im Laufe der Entwicklungsgeschichte noch weitere genetische Veränderungen zum dauerhaften Verlust des Schwanzes beigetragen haben. Dass er sich durchgesetzt hat, spreche jedoch für handfeste Vorteile einer schwanzlosen Existenz. Womöglich sei sie mit einem Wechsel des Lebensraums einhergegangen, aus den Baumkronen auf den Boden. "Wir vermuten, dass der Selektionsvorteil sehr groß gewesen sein muss", schreibt das Team in der renommierten Fachzeitschrift "Nature". Denn der Verlust des Schwanzes scheine das Risiko von Neuralrohrdefekten zu erhöhen – ein 25 Millionen Jahre alter evolutionärer Kompromiss, der "auch heute noch die menschliche Gesundheit beeinflusst."