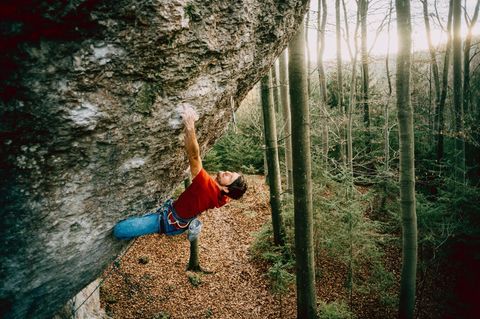Wie kamen Sie auf die Idee zu Ihrem außergewöhnlichen Fotoprojekt "Closed Cities"?
Das Konzept entwickelte sich über Monate, ausgehend von meinem Grundinteresse für Urbanität und Sperrgebiete. Im Zuge der Recherche wurde ich auf die geschlossenen Städte der ehemaligen Sowjetunion aufmerksam und begann ab diesem Zeitpunkt konkret nach aktuell existierenden und auch funktionierenden geschlossenen Stadtkonstrukten in aller Welt zu recherchieren.
Wie haben Sie Ihre Auswahl getroffen?
Mein Ziel war es, mehrere unterschiedliche Städte zu bearbeiten. Es sollte kein Projekt über reine Rohstoffstädte werden, auch nicht ausschließlich über gated communities. Interessiert haben mich die unterschiedlichen Gründe, die zur Entwicklung dieser Orte führten. Ich wollte die ökonomischen, politischen und soziologischen Ursachen zeigen. Außerdem sollten die Städte eine gewisse Größe und Einwohnerzahl haben. Der größte Ort des Projektes zählt etwa 100.000 Einwohner. Die Städte sollten in unterschiedlichen Ländern beziehungsweise Klimazonen positioniert sein, um ein spannendes Spektrum an urbaner Architektur zu zeigen. Letztendlich war natürlich ausschlaggebend, ob ich eine Genehmigung bekam, dort zu fotografieren
Wie lange dauerte es, bis sie alle Genehmigungen für die Besuche zusammen hatten?
Etwa zwei Jahre.
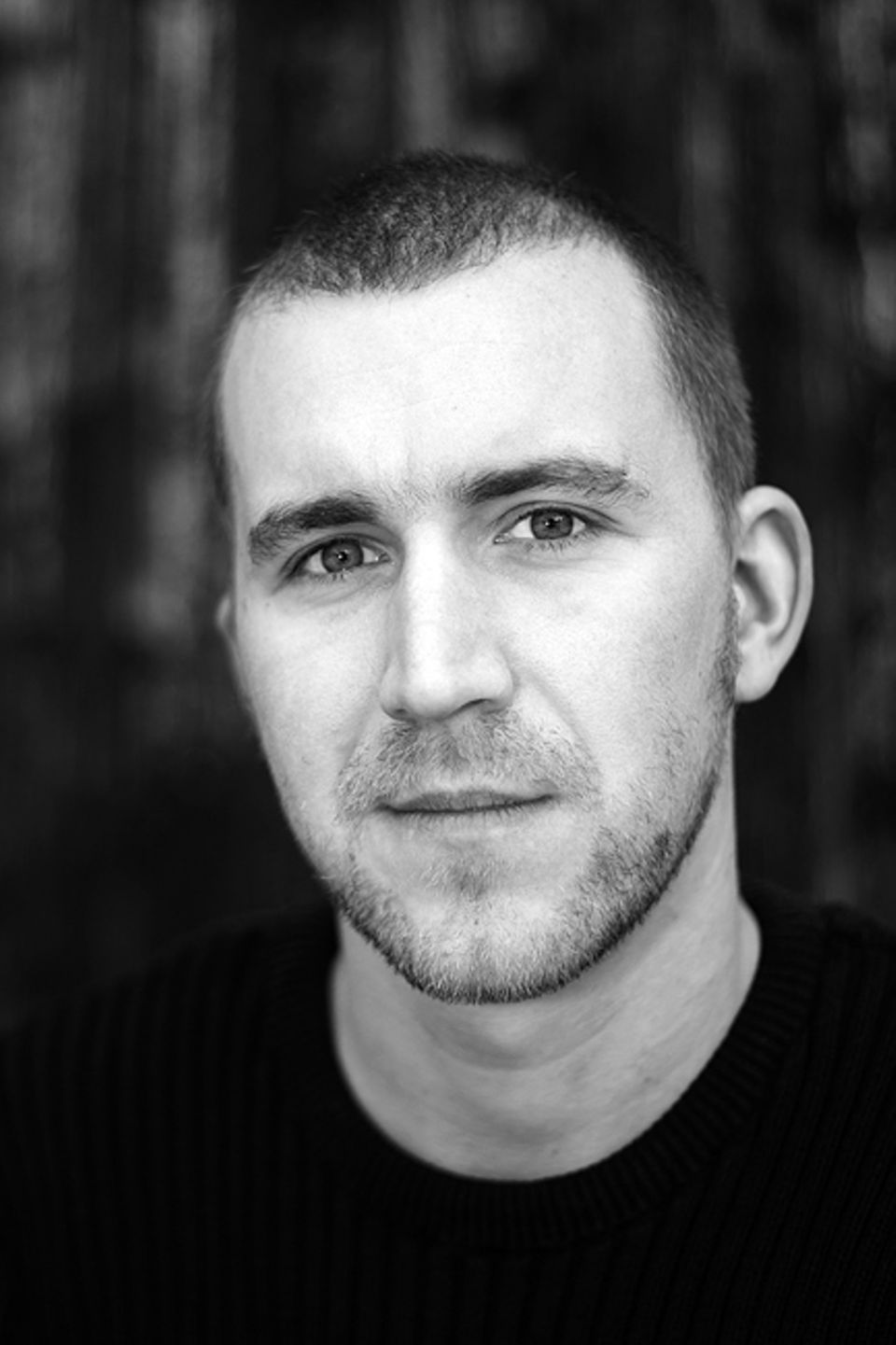
Was war für Sie die größte Herausforderung bei dieser Arbeit
Nach all den mühsamen Organisationsprozessen im Vorfeld und den Reisen selbst - war die größte Herausforderung, sich schnell und konzentriert einen Überblick vor Ort zu verschaffen und dann zu entscheiden, welche Objekte bei welchem Licht für ein Gesamtportrait am spannendsten sind. In Aserbaidschan beispielsweise, auf Oil Rocks, einer Stadt mitten im Kaspischen Meer, wurde mir vor Ort mitgeteilt, dass ich nur 3,5 Stunden Zeit hätte. Und das nach einer Vorbereitungszeit von rund einem Jahr. Das ist bei einem solchen Vorhaben so gut wie nichts. Solche unerwarteten Situationen dürfen einen nicht aus der Fassung bringen. Immerhin hatte ich nur diese eine Chance. Daneben brachte dieses Projekt enorme Kosten mit sich. Ich musste das Projekt Closed Cities selbst finanzieren.
Wie kommt man eigentlich in die Diamantenmine Mirny?
Mirny liegt in der russischen Teilrepublik Jakutien im Fernen Osten. Die Stadt wird ausschließlich von der Fluggesellschaft des dort fördernden Diamant-Konzerns angeflogen. Das heißt, der entscheidet, wer dorthin fliegt und wer die Stadt wieder verlassen darf. Mein siebenstündiger Flug mit einer uralten Tupolev von Moskau in die Eishölle von Mirny trieb mir den Angstschweiß auf die Stirn. Vor allem, weil ich befürchtete, dass diese Maschinen solange geflogen werden, bis sie auseinanderfallen. Kurze Zeit vorher hatte ein Flugzeug dieser Konzern-Airline einen totalen Elektronikausfall in der Luft. Die Ausstattung des Flugzeugs und die Besatzung wirkten auf mich wie das Setting eines Kubrick-Films aus den 1960ern.
Wie sahen die Arbeitsbedingungen vor Ort aus?
Die hygienischen Zustände waren teilweise katastrophal: wenig Wasser, manchmal gar keins. Ich stand permanent unter Beobachtung: Geheimdienst, Militär, Sicherheitskräfte kontrollierten jeden meiner Schritte. Das Fotografieren in den Minenfeldern, auf freiem Schussfeld in Sichtweite der gegnerischen Soldaten setzte mich sehr unter Druck. In Mirny machten mir die ständig wechselnden Temperaturen zu schaffen. Die Russen neigen dazu Innenräume zu überheizen, so herrscht innen gern 30 Grad Celsius. Doch außen sind es bis zu minus 50 Grad. Das belastet den Kreislauf enorm, aber auch das technische Equipment. Film zerbröselt ab minus 50 Grad.
Außerdem warnten uns die Einheimischen davor, die Bars zu besuchen. Nicht einmal die Toiletten sollte man ohne Begleitung aufsuchen. Es wird geschossen. Das ist wilder Osten.
In der Wüste dagegen raubte mir der Staub den Atem, und das ausströmende Gas machte mich mürbe und trübte meine Sinne. Manchmal ist die Luft derart gashaltig, dass die Beine und Gelenke anschwellen. Verwirrung und Kopfschmerzen machen sich unter den Arbeitern breit. Ich fühlte mich wie im Fegefeuer unter diesen gigantischen Flammen von 60 Meter und mehr. Und dann durfte ich sie nicht einmal fotografieren. Die Bilder wurden zensiert. Täglich bekam ich neue Aufenthalts- und Fotogenehmigungen erteilt. Es war ein Sperrgebiet im Sperrgebiet.
Warum sind in Ihren Bildern keine Menschen zu sehen?
Mein Ziel war es, den Themenkreis über diese spezielle urbane Architektur zu transportieren. Ich interessierte mich mehr für die Spuren der Menschen als für deren Abbild selbst. Außerdem, denke ich, wird dadurch das Surreale der Orte, die Unsichtbarkeit, noch mehr herausgearbeitet. Großstädte zu portraitieren, ohne deren Einwohner zu zeigen, führt zu einer sehr merkwürdigen Atmosphäre im Bild.
Welche Botschaft haben die "Closed Cities" für uns?
Wir leben im Zeitalter schwindender Ressourcen. Ganze Wirtschaftszweige brechen ein, das Klima verändert sich und politische Konflikte entstehen. Solche urbanen Siedlungsformen wie die "Closed Cities" repräsentieren für mich die Zeitenwende, in der sich die Menschheit Anfang des 21. Jahrhunderts befindet.