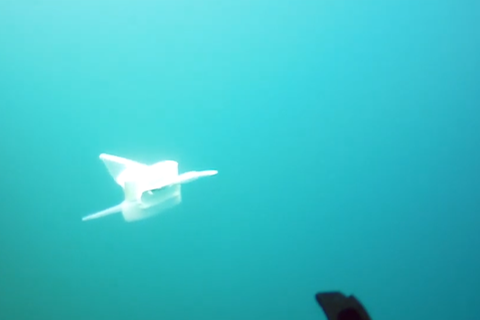Freitag, 26. Oktober: Ein schwankendes Zuhause
13.30 Uhr: Um halb zwei am Mittag legen wir ab. Im Kriechgang bewegt sich das massige Schiff an den Kais von Bremerhaven entlang. Ich kralle mich an der Reeling fest, starre auf die vorbeiziehenden Hafenkräne und die winkenden Angehörigen am Kai. Herbstkalt fährt mir der Wind in die Glieder. Eine Stunde später passieren wir die letzte Schleuse.
Die See ist ruhig, der Blick weitet sich allmählich über das Graubraun des trüben Hafenwassers, immer kleiner wird die Silhouette der Stadt, bis sie langsam hinter uns am Horizont versinkt. Allmählich verschwindet an back- und steuerbord das Land, bis uns nur noch Wasser umgibt. Vor uns liegen vier Wochen Hochsee.
Zuerst nehme ich meine Kabine genauer unter die Lupe. Sie ist ab sofort mein Zuhause, Arbeitsplatz und Rückzugsort: eine gemütliche Koje, in der Mitte Tisch und Stuhl, Schrank, Regale - alles niet- und nagelfest verzurrt, und zu meiner großen Freude zwei große Bullaugen mit Blick aufs Meer. Dann begebe ich mich auf Entdeckungsreise durchs Schiff, begegne auf den engen Fluren anderen Neuankömmlingen mit fragenden Gesichtern: Wo sind die Labore? Wo werde ich arbeiten? Wo sind all die Container, in denen noch das Equipment lagert, Kinosaal, die Sauna, das Schwimmbad, der Fitnessraum und nicht zuletzt: Wo ist die Messe, der Speisesaal?
Der "Rote Salon" überrascht mich mit seinen samtroten Plüschsofas, der "Blaue Salon" ist ausgelegt mit flauschigem Teppich, geschmückt mit einem Kamin und einem mahagonifarbenen, runden Konferenztisch, der vor einer rustikalen Bücherwand prangt. Daneben ein Piano. Das Schiff entpuppt sich als wahres Labyrinth, dessen Wege über das Treppenhaus sich schwierig gestalten. Noch gelingt es mir nicht sehr elegant, das Gleichgewicht zu wahren, während mir bei jedem Schritt die Stufe entweder entgegenkommt oder einfach unter mir wegsackt. Rechtzeitig zum Abendessen habe ich neben Seminarraum und Nasslabor auch die Messe entdeckt, deren Küche so gut ist wie ihr Ruf: Vier mal am Tag Essen vom Feinsten.
Samstag, 27. Oktober
Unsanft reißt mich eine Stimme aus dem Schlaf, die über den Flur plärrt, und die ich im Anflug leichter Panik schließlich als Ansage über den Bordlautsprecher identifiziere: mir bleiben gerade zehn Minuten, um mich aus dem Bett in meine Kleider zu schwingen und zum Seminarraum zu rasen. Erstes Bordmeeting um 9.00 Uhr für die Neuankömmlinge, Einweisung fürs Schiff, inklusive Vorstellungsrunde.
Dann gehe ich auf Tuchfühlung mit der Brücke. Ich muss mich erst daran gewöhnen, die schweren Außentüren aus Eisen zu öffnen, ohne dabei Gefahr zu laufen, mir die Fingergelenke auszukugeln, und entdecke schließlich das obere Schiffsdeck. Von hier oben gesehen, scheint die Polarstern über die Wellen zu fliegen. Noch ist die See ruhig, was sich über Nacht allerdings rasch ändert. Wir haben den Ärmelkanal erreicht.
Sonntag, 28. Oktober: Erste Begegnung mit einem hartnäckigen Begleiter
Im Morgengrauen waren es nur Kopfschmerzen, fürchterliche Kopfschmerzen, dann folgte Schwindel. Gegen 9.00 Uhr war ich bereits hoffnungslos seekrank. Vor meinen Augen schwankt alles, draußen brodelt die See, es stürmt und regnet. Den Tag habe ich neben schätzungsweise der Hälfte der Leute an Bord nur in der Horizontalen verbringen können. Selbst das Duschen in der so genannten Nasszelle, wie man das Bad in der Kabine nennt, wird zur Herausforderung: Einer Welle gleich, schwappt das Wasser auf dem Boden bei jeder Schiffsbewegung hin und her.
Dienstag, 30. Oktober
Dank Pflaster gegen Übelkeit hinterm Ohr, das offenbar Wunder wirkt, fühle ich mich nach zwei seekranken Tagen erholt. Noch leicht schwindlig zwar, aber deutlich besser. Und ich versuche, das wettzumachen, was ich in der Zwischenzeit verpasst habe. Mittlerweile haben wir den Golf von Biskaya erreicht.
Freitag, 2. November: Wie viele Blautöne hat der Ozean?
Inzwischen wird es merklich wärmer, jeden Tag steigt die Temperatur um ein paar Grad. Das Meer schimmert mal Himmelblau-, mal Azur-, Türkis-, Saphir-, oder Stahlblau. Stets verbringe ich mindestens eine Stunde auf Deck und starre gedankenverloren auf die Wellen. Wir sind auf der Höhe Marokkos, so zumindest suggeriert es die aktuelle Positionskarte im Intranet der Polarstern. Schwer vorstellbar. Seit Tagen umgibt uns nur der Ozean. Außerdem begleitet uns seit heute morgen eine Reihe blinder Passagiere: Eine Misteldrossel, zwei Stare, ein Fink und eine Bachstelze, die es wohl fernab ihrer eigentlichen Flugroute aufs offene Meer verdriftet hat.
Samstag, 3. November
Jeden Morgen die gleiche Routine: Von 9.00 bis 10.00 ist "Morning Talk" im Kinosaal. Jeder Wissenschaftler an Bord stellt seine Forschungsarbeit vor. Jeden Tag ein Ozean an Wissen, den es zu erforschen gilt.
Wir nähern uns den Kanaren. Die Luft hat bereits sommerliche 24 Grad Celsius. Die Stimmung steigt analog zur Außentemperatur. Morgen werden wir Las Palmas erreichen.
Einige Wissenschaftler werden uns dort verlassen - Abschiedsstimmung kommt dennoch keine auf. Denn für die meisten Forscher hat die Arbeit bislang noch gar nicht begonnen.
Sonntag, 4. November
Ankunft in Las Palmas. Im fahlen Purpur-Grau der Morgendämmerung schält sich zwischen Meer und Himmel allmählich eine Insel heraus. Endlich das Relief einer Landmasse, nach einer Woche auf dem offenen Meer. Welch ein Fest für die Augen! Das Lotsenboot "Maspalomas" macht an der Polarstern fest, die vor der Kanareninsel für kurze Zeit vor Anker gegangen ist. Fliegender Wechsel von Wissenschaftlern. Auch der Fotograf Solvin Zankl geht jetzt an Bord. Danach nimmt die Polarstern mit ihren 20000 PS wieder Fahrt auf mit Kurs auf unsere erste Fangstation.
Montag, 5. November: Ein erster Test für das Spezialnetz
Südlich der Kanaren. Unter uns an die 5000 Meter Ozean. Die erste Fangstation und ein Test, ob alle Handgriffe sitzen, ob das internationale Team aus 27 Zoologen und Planktonspezialisten eingespielt ist, ob die Technik, welche die Spezialnetze für den Tiefseefang steuert, funktioniert, ob die Koordination stimmt, zwischen Besatzung und Forschern, ob jeder seine Aufgabe kennt, so wie es in den vorangegangenen Tagen immer wieder im Detail besprochen wurde. Jetzt muss sich zeigen, ob die Technik hält, was sie verspricht. Alles läuft wie am Schnürchen.
Mittwoch, 7. November.
Uns hat ein ablandiger Sandsturm aus West-Sahara erreicht und mit der Staubwolke massenhaft Insekten beschert. Neben einigen verdrifteten See- und Singvögeln flattern nun Schmetterlinge über das Sonnendeck, flitzen Wanzen über die Holzbohlen des Arbeitsdecks oder hocken Heuschrecken so groß wie Zeigefinger an der Reeling - obwohl wir mehrere 100 Kilometer von der Küste entfernt sind! Zudem überzieht eine feine Schicht gelben Wüstensandes das gesamte Schiff.
Wir dringen mittlerweile in tropische Gefilde vor, 28 Grad Celsius im Schatten, die Luftfeuchte liegt bei 80 Prozent, fliegende Fische spritzen aus der Gischt empor. Wir haben die Kapverden hinter uns gelassen.
Donnerstag, 8. November: Beutezug in der eiskalten Tiefe
Die Polarstern nähert sich langsam den Zielkoordinaten: 11° 41'00 N, 20° 25'128 W. Der Tiefenmesser zeigt 4884 Meter. Es ist so weit. Der erste, richtige Tiefseefang. Das schwere Fangnetz liegt ausgebreitet auf dem Aufbau am Heck. "Schiff dreht", dröhnt die Meldung von der Brücke aus dem Walky-Talky des Ersten Offiziers, der am Heck das Fanggeschehen überwacht. Schwerfällig bewegt sich die Polarstern und legt sich allmählich gegen den Wind. So ist sie leichter zu manövrieren.
Das Schiff ist in Position, von der Brücke tönt die Stimme des Zweiten Nautischen Offiziers: "Zwei Knoten Fahrt. Netz kann zu Wasser". Stunden später ist es so weit: Mit geübten Handgriffen hievt die Besatzung das Aluminium-Monstrum an Bord. Die Forscher holen die Netze ein und flitzen mit den Fangbehältern ins Kältelabor. Das muss schnell gehen, denn an der Wasseroberfläche stirbt das Tiefseegetier in Minutenschnelle . Die Wissenschaftler sind begeistert. Bis in die frühen Morgenstunden sitzen viele von ihnen im Labor und untersuchen ihre Beute.
Samstag, 10. November
Bergfest. Die Hälfte der Tour liegt hinter uns. In einigen Tagen erreichen wir den Äquator. Auf dem Helikopterdeck herrscht tropische Stimmung. Zu Caipirinha und dem Singen der Zikaden, das selbst das Schiffsheulen übertönt, tanzen wir zu später Stunde. Ja, Zikaden! Seit uns der Sandsturm massenhaft Insekten beschert hat, ist es auf dem Schiff mitunter lauter als im afrikanischen Busch.
Sonntag, 11. November
23.00 Uhr, im Kältecontainer 2, der Solvin Zankl als Fotolabor dient. Einer der Wissenschaftler hat uns ein milchig durchsichtiges, insektenartiges Etwas in einem Becherglas zum Fotografieren überreicht. Wie gebannt starren wir im eiskalten Container auf das noch lebende Wesen, das Solvin sofort in eines seiner Aquarien gesetzt hat. Es rast durch das Wasser, dreht sich dabei wie wild um sich selbst, düst kurz darauf pfeilschnell vorwärts. Dann hat das seltsame Geschöpf im Wasserbehälter offenbar gefunden, was es sucht. Es umkreist ein durchsichtiges leeres, etwa drei Zentimeter großes, gallertartiges Gehäuse, als taste es dieses von außen ab und schlüpft hinein. Phronima sedentaria, ein parasitisch lebender, etwa drei Zentimeter großer Flohkrebs. Eigentlich ist er ein friedlicher Zeitgenosse. Es sei denn, er trifft auf Salpen, das sind gallertartige Manteltiere, oder auf Staatsquallen. Die überfällt er und räumt deren Innenleben aus, um sich des leeren Mantels als Behausung oder Brutstätte für seine Jungen zu bemächtigen.
Ein wahres Tiefseemonster in Miniaturform. Kein Wunder, dass Phronima als Vorbild für das Leinwandmonster Alien diente, wie mir die Wissenschaftler versichern.
Dienstag, 13. November: Äquatortaufe
Wir haben die Nulllinie erreicht. In der Morgendämmerung, zwei Minuten vor 6.00 Uhr, gleitet die Polarstern über den Äquator.
Zwar hat sich der Ozean nicht verändert, wohl aber die Lage an Bord. Heute ist Äquatortaufe. Dieser Seemannsbrauch verlangt, dass "unreines Gesocks", das zum ersten Mal den Äquator überquert, sich einer rituellen Waschung durch die Gefolgsleute Neptuns unterziehen muss. Das trifft auf die meisten von uns zu. Die Äquatortaufe ist eine in selbem Maße unterhaltsame wie widerliche Angelegenheit. Zuerst lässt man uns versammelt auf dem Helikopterdeck antreten, spritzt uns mit Salzwasser aus der Löschkanone ab, um uns anschließend mit einer Brühe einzureiben, deren Bestandteile nicht im Entferntesten mehr zu erahnen sind. Vermutlich eine Mixtur aus allem, was die Küche an Überresten zu bieten hatte. Anschließend fixiert man das Ganze mit einem Schwall Mehl.
Und als ob das nicht schon unappetitlich genug gewesen wäre, gibt es danach alte Heringe, die, wer den Mut dazu hat, wohl auch essen kann. Doch das traut sich nur einer von uns: der Meterologe Matthias Zöllner. Zum Schluss gibt es für jeden noch eine Gesichtsmaske aus Senf.
Später am Abend erhält jeder von uns sein wohlverdientes Testat - ausgehändigt zum Kostenbeitrag von zehn Euro.
Am Abend feiern wir unsere erfolgreiche Taufe - unser erstes Grillfest an Deck. Kaum einen schöneren Platz kann ich mir für eine solch sonnabendliche Festivität vorstellen. Lange Tafeln sind auf dem hölzernen Arbeitsdeck gedeckt, zwischen den Windenspulen, auf denen kilometerlang Drahtseile aufgerollt sind, stehen zum Grill umfunktionierte Öltonnen, Sonnenuntergang und später ein sternenklarer Nachthimmel inklusive.
Samstag, 17. November: Fünf Kilometer unter der Meeresoberfläche
Am Morgen wird das Fangnetz für seinen dritten Tiefsee-Beutezug zu Wasser gelassen. Gegen Mittag erreicht es die Rekordtiefe von 5110 Meter - die persönliche Bestmarke für Peter Wiebe. Er ist Meeresbiologe am Woods Hole Oceanographic Institution in Massachusetts und Konstrukteur des Spezialnetzes. Der gesamte knapp zwei Zentimeter dicke Draht wird bis zur letzten Windung von der Kabeltrommel gespult: insgesamt über acht Kilometer! Der tiefste Tiefseefang dieser Überfahrt kann sich sehen lassen: Fischexperte Sutton sitzt bei drei Grad Celsius im Kühlcontainer, eingepackt in dicke Winterkleidung und ist ganz außer sich beim Anblick dessen, was sich da aus den Fangbehältern in die Sammelschale ergießt. "Das ist wirklich ein außergewöhnlicher Fang. Vermutlich sogar der beste auf der gesamten Tour. Das sind Hunderte von Arten, viele davon sehr selten." Ruderfußkrebse, Flohkrebse und Pfeilwürmer in außergewöhnlicher Größe, sowie äußerst seltene Fischarten.
Freitag, 23. November: Die Sonne wirft keine Schatten mehr
Den Äquator haben wir hinter uns gelassen, dafür durchfahren wir heute um 12.25 Uhr Ortszeit den Punkt, an dem die Sonne direkt über uns im Zenit steht. Für einen kurzen Moment ist jeder, der sich im Freien aufhält, schattenlos. Dass wir allerdings den Zenit unserer Reise längst überschritten haben, verdeutlichen nicht nur die täglich sinkenden Temperaturen. Vorbei ist es mit der tropischen Hitze. Mit zunehmendem Wind wächst auch die Dünung. Und während ich bereits der Annahme war, zumindest auf dieser Reise von weiterer Seekrankheit befreit zu sein, lerne ich, wie sehr man sich täuschen kann.
Wie Blei legt sich der Druck auf meinen Schädel, so dass es mir die Augen aus den Höhlen zu pressen scheint, und ohne dass mir schlecht wird, schwindelt es mich bei jedem Schritt. Ein schneidiger Wind hat sich eingeschlichen und jagt von den stürmischen Roaring Fourties, dem 40. Breitengrad, fünf Meter hohe Wellen herauf. Mal wieder rutschen Teller und Tassen über den Tisch, um sich in Windeseile über die Tischkante zu verabschieden. Mein Kopf fühlt sich zum Bersten an. Das Schiff hebt sich, um kurz darauf in rasanter Talfahrt auf den nächsten Wellenberg zu krachen. Tagsüber verkrafte ich das, nachts dagegen raubt mir das Geschaukel den Schlaf, weil ich mich immer wieder in die Matratze krallen muss.
Samstag. 24. November
Die Proben sind genommen, die Tiere zur späteren Analyse im heimatlichen Labor in Alkohol oder Formalin konserviert und die Daten in den Computer gespeist. Jetzt heißt es packen. Ein letztes ausgelassenes Barbeque auf dem Arbeitsdeck, das angrenzende Nasslabor fungiert als Tanzfläche. Noch einmal versinkt die Abendsonne vor unseren glühenden Grilltonnen am Horizont. Nachtbläue, Gischt schäumende Wellenberge wogen gefährlich nah an der Reling vorbei, um hin wieder einen Schwall Meereswasser aufs Deck zu spülen.
Montag, 26. November
Der allerletzte Tag auf See ist angebrochen. Eine lange Reise geht zu Ende. Vier Wochen auf hoher See. Vier Wochen, in denen die Farbe Blau mein Sehfeld dominiert hat. Vier Wochen irgendwo zeitlos im Ozean, ohne dass das Auge am Horizont Halt findet. Vier Wochen, in denen eine Orientierung ohne Hilfsmittel nicht möglich wäre. Vier Wochen auf dieser schwimmenden, schaukelnden Insel, getrennt vom Rest der Zivilisation. Vier Wochen mit all diesen Menschen, die mir, mehr oder weniger vertraut, allmählich heimatliche Gefühle vermittelt haben. Vier Wochen schwankenden Boden unter Füßen. Vier Wochen ein Bett, das mich mehr oder weniger sanft in den Schlaf geschaukelt hat. Vier Wochen Wellenspiele, die nie langweilen.
Für die Forscher war es eine äußerst erfolgreiche Expedition. Über 300 Arten haben sie bestimmt und dabei das Erbgut von mehr als 2000 einzelnen Tieren untersucht. Beim Identifizieren der Zooplanktonarten haben sie viele alte Bekannte wiedergetroffen, seltene Arten gefunden, aber auch einige völlig neue Arten entdeckt: zum Beispiel sechs bislang unbekannte Muschelkrebsarten und vier neue Tiefsee-Fischarten.
Doch für die meisten der Forscher lässt sich das Ausmaß ihrer Entdeckungen noch gar nicht absschätzen. Heimwärts reisen sie mit vielen Proben und Daten, die sicher viele von ihnen die nächsten Monate oder gar Jahre beschäftigen werden.
Für mich war diese Expedition eine unvergessliche Erfahrung, den Meeresbiologen so dicht über die Schulter geschaut zu haben. So viel über die nahezu kleinsten und wichtigsten Meeresbewohner gelernt zu haben, über ihre verschiedenen Formen und Anpassungen, ihr Verhalten und ihre wichtige Rolle im Ökosystem Ozean. Aber auch die außergewöhnliche Art des Reisens hat mich fasziniert: Mit knapp 30 Kilometer pro Stunde über 6400 Seemeilen (das sind fast 12000 Kilometer) mit so vielen Menschen auf engem Raum der Länge nach um den Globus zu reisen.
Im Morgengrauen zieht die afrikanische Küste an meinem Fenster vorüber. Ich laufe zum Arbeitsdeck runter und lehne mich weit über die Bordwand. Mir stockt der Atem. Vor mir eröffnet sich der morgendliche Blick auf ein steiles Bergmassiv, hinter dessen Kamm erhaben der Tafelberg thront. Davor eine idyllische Miniaturstadt, im Halbkreis wie an die Berghänge geheftet: Kapstadt. Wir sind am Ziel.