GEO.de: Dass Tier- und Pflanzenarten im Verlauf der Klimakrise aussterben werden, haben wir schon mal gehört. Dass sie vor hohen Temperaturen flüchten, ist weniger bekannt ...
Benjamin von Brackel: Was erstaunlich ist! Denn in der Wissenschaft wurden schon Zehntausende Fälle von Arten dokumentiert, die wandern – auf allen Kontinenten und in allen Weltmeeren, von Kieselalgen bis hin zu Elefanten. Im Schnitt bewegen sich die Arten an Land fünf Meter pro Jahr vom Äquator weg. Im Meer sind es sogar 20 Meter.
Haben Sie Beispiele?
In Kanada dringen die Grizzlybären Richtung Norden vor. Und dort treffen Sie immer öfter auf Eisbären, die ihren eisigen Lebensraum verlieren. Die beiden Arten pflanzen sich sogar miteinander fort, und es hat sich gezeigt, dass die Nachkommen dieser sogenannten Pizzlys oder Cappuccino-Bären ihrerseits auch fruchtbare Nachkommen zeugen können. So etwas wird sicher auch in anderen Regionen der Welt vorkommen, denn die Arten bewegen sich ja nicht alle im Gleichschritt. Innerhalb von Arten und auch innerhalb von Populationen verändert sich das Ausbreitungsgebiet in ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten, was zu einer völlig neuen Zusammensetzung der Artenwelt führt. Da müssen wir uns noch auf einige Überraschungen einstellen.
Ein anderes Beispiel: In der Arktis stoßen die Biber acht Kilometer pro Jahr vor, entlang von Küsten und Flüssen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie in wenigen Jahrzehnten Alaska kolonisiert haben könnten. Das hat Folgen für die Ökosysteme, denn Biber verwandeln ganze Landstriche in Seenlandschaften, was auf Satellitenaufnahmen gut zu sehen ist. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass die neu entstandenen Wasserlandschaften Lachse anlocken. Gleichzeitig führt die Bewässerung aber auch dazu, dass Böden auftauen und große Mengen CO2 freigesetzt werden. Was wiederum den Klimawandel befeuert.
Wie sieht es in Europa aus?
In unseren Breiten sind die Wälder ein eindrucksvolles Beispiel. Man kann sich zunächst nicht vorstellen, dass Bäume "wandern". Aber wenn man sich die Klimazonen der Kiefern und Fichten anschaut, wird klar, dass sie in vielen Regionen klimatisch nicht mehr die richtigen Bedingungen vorfinden. Darum brechen sie in großen Gebieten weg, etwa in Südwestdeutschland. Sie müssen sich in höhere Lagen zurückziehen, oder nach Nordeuropa.
Was ist mit Arten, die auf Inseln oder Bergen festsitzen?
Während meiner Recherche habe ich zusammen mit einem US-Ornithologen einen entlegenen Andenberg bestiegen. Dort haben Wissenschaftler beobachtet, wie sich die Vogelwelt bis zum Berggipfel hinauf verschiebt, wie auf einer Rolltreppe. Und ganz oben sind die ersten Arten auch schon verschwunden. Ähnliches ist auch im Himalaya oder in den Alpen zu erwarten. Der Biodiversitätsrat hat gewarnt, dass eine Million Arten aussterben könnten – vor allem dort, wo sie vor dem Klimawandel nicht flüchten können.
Was bedeuten die Wanderungen für den Menschen?
Am meisten betroffen sind die indigenen Völker, die teilweise ihre ganze Kultur um eine Tierart herum aufgebaut haben. Bei meinen Recherchen bin ich auf Utqia'gvik gestoßen, einen Ort in Alaska. Die Inupiat dort leben vom Grönlandwal. Der ganze Jahresrhythmus dreht sich um diese Tiere. Doch die Wale verlegen nun ihre Wanderrouten in Richtung Norden. Wenn sie gar nicht mehr auftauchten, wäre das für die Inupiat ein existenzieller Verlust.
Womit müssen wir in Deutschland rechnen?
Da gibt es zum einen harmlose Arten, die sich bei uns ausbreiten, etwa den Bienenfresser, ein hübscher Vogel mit buntem Gefieder. Beim Eichenprozessionsspinner sieht das schon etwas anders aus, weil die Raupen mit ihren giftigen Haaren allergische Reaktionen auslösen können. Noch gefährlicher sind die Mücken aus den Tropen und Subtropen, zum Beispiel die Asiatische Tigermücke, die sich in Süddeutschland ausbreitet und neue Krankheiten mitbringt, wie etwa das Zika-, das Dengue- oder das Chikungunya-Virus. Darauf sind wir nicht vorbereitet. Und es könnte uns in den nächsten Jahrzehnten noch massive Probleme bescheren.
Naturschutz bestand bislang überwiegend darin, bestimmte, ökologisch wertvolle Gebiete unter Schutz zu stellen. Reicht das in den kommenden Jahrzehnten der Klimakrise?
Das Schutzgebiets-Netz in Europa ist das größte weltweit, allein in Deutschland machen sie eine Fläche von ungefähr 37 Prozent aus. Wenn man sich die Sache aber genauer anschaut, dann sieht man, dass die Schutzgebiete meistens eher kleine, isolierte Räume sind, die meistens auch noch bewirtschaftet werden.
Eine wissenschaftliche Studie hat gezeigt, dass die meisten Wirbeltier- und Pflanzenarten bis zum Jahr 2080 in den Schutzgebieten, in denen sie heute vorkommen, ungeeignete klimatische Bedingungen haben werden. Und sie werden oft keine Möglichkeit haben, auszuwandern. Denn in Deutschland sind Schutzgebiete oft umzingelt von Ackerflächen, Straßen und Kanälen.
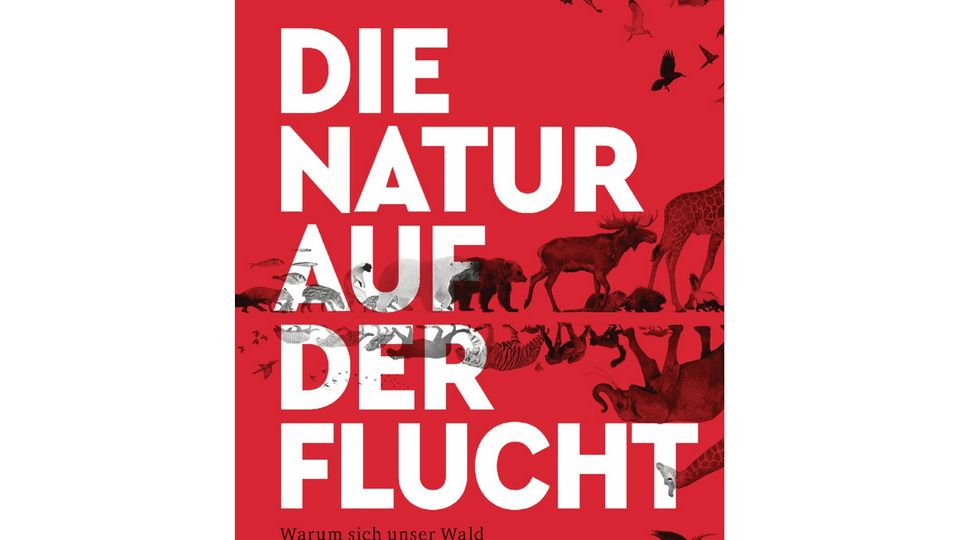
Macht es Sinn, Arten umzusiedeln, denen es in ihrem angestammten Lebensraum zu heiß wird?
Das wird unter Biologen kontrovers diskutiert. Kritiker warnen vor massiven Eingriffen in sensible Ökosysteme. Wenn man innerhalb von Kontinenten und ähnlichen Ökosystemen Arten umsiedelt, dann kann das aber – als letztes Mittel – Sinn ergeben. In Australien wurde zum Beispiel die Spitzkopfschildkröte umgesiedelt, deren Lebensraum wegen des Klimawandels nach und nach austrocknet. Also wurden einzelne Exemplare 350 Kilometer weiter südlich umgesiedelt. Aber bevor man zu diesem Mittel greifen muss, kann man viel tun, indem man bestehende Schutzgebiete erweitert und Korridore schafft. Und am meisten kann man natürlich tun, indem man den Klimawandel abbremst.
Was ist Ihr persönliches Fazit aus der Beschäftigung mit der flüchtenden Natur?
Es gibt eine Menge Bücher über das sechste Massensterben auf der Erde. Dem wollte ich eine andere Perspektive entgegensetzen, eine, die die Natur nicht als passiv betrachtet. Viele Tier- und Pflanzenarten können reagieren und tun das auch, wenn man sie lässt. Allerdings hat die Anpassungsfähigkeit der Natur ihre Grenzen. Wenn sich die Welt zu stark erwärmt, wir sprechen von gerade mal zwei Grad, werden wahrscheinlich Hunderttausende Arten aussterben – nicht nur, aber vor allem diejenigen, die nicht mobil sind. Um die zu retten, brauchen wir ein neues Naturverständnis und einen neuen Umgang mit der Natur.























