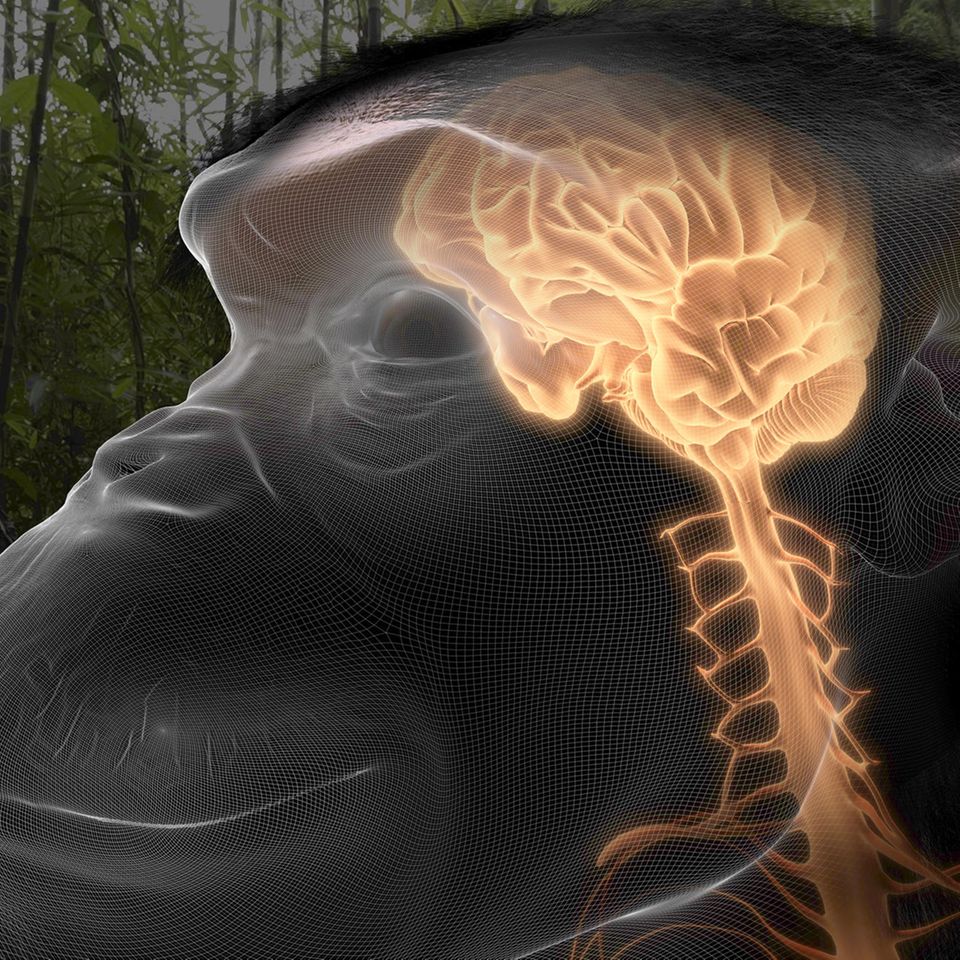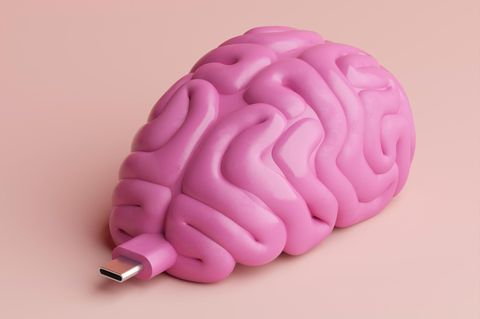Wollen Forschende ergründen, ob ein Tier über die womöglich höchste Form des Geistes – über ein Selbstbewusstsein – verfügt, bedienen sie sich nicht selten des klassischen Spiegeltests. Dabei gilt es zu beobachten, wie sich eine Spezies verhält, wenn sie ihr eigenes Antlitz erblickt. Und das kann von Art zu Art sehr unterschiedlich ausfallen. Manche Tiere schenken ihrer Reflexion denkbar wenig Beachtung, laufen und gucken am Spiegel vorbei. Andere flippen aus: In den sozialen Medien kursiert das Video eines Bären, der beim Anblick seines Spiegelbildes erschrickt, um dann wie wild darauf einzuschlagen (offenbar hält er es für einen Rivalen). Wieder andere Tiere mögen zunächst aufgebracht reagieren, beruhigen sich dann, zeigen Neugier, inspizieren ihr Abbild.
Um herauszufinden, ob sich die Kandidaten tatsächlich erkennen, kann man ihnen einen farbigen Punkt auf den Körper malen, und zwar auf eine Stelle, die sie nur im Spiegel sehen können (etwa auf die Stirn). Versuchen die Tiere, den Klecks abzureiben, ist dies ein klarer Hinweis dafür, dass sie verstehen: "Was ich im Spiegel sehe, das bin ich." Bislang haben einige wenige Arten diesen Spiegeltest bestanden, darunter Schimpansen, Bonobos und Orang-Utans, Große Tümmler, Asiatische Elefanten, Krähen und (überraschend!) Putzerlippfische.
Die so vielfach angewendete Methode offenbart etliche Schwächen
Nun hat ein Team um die Biologin Sonja Hillemacher von der Universität Bonn untersucht, inwieweit Gallus gallus domesticus zur Selbsterkenntnis fähig ist: das Huhn – oder besser gesagt der Hahn. Zwar ergaben die Untersuchungen, dass die gackernden Vögel den klassischen Spiegeltest nicht bestehen (eine Farbmarkierung scherte die Tiere wenig).
Doch in ihrer im Fachjournal PLOS ONE erschienenen Studie merken die Forschenden an, dass die Methode – so einleuchtend und simpel sie anmuten mag – durchaus ihre Schwächen hat. So gibt es, wie Versuche zeigen, innerhalb jener Spezies, die den Test prinzipiell zu meistern vermögen, immer auch etliche Individuen, die dazu nicht imstande sind. Andersherum lassen sich Tiere einer Art, die bei dem Test normalerweise durchfallen, so trainieren, dass sie die Prüfung anschließend bestehen (dazu gehören etwa Makaken).
Und obendrein kann man ja ohne Weiteres die Frage stellen, ob sich manche Tiere – zum Beispiel Hähne – zwar im Spiegel erkennen, es ihnen aber völlig egal ist, ob sie einen Punkt auf dem Körper haben oder nicht, dass sie sich also dementsprechend nicht sonderlich auffällig verhalten. Ist das Verfahren vielleicht zu sehr aus menschlicher Sicht gedacht? Wäre es nicht sinnvoll, den Test so zu modifizieren, dass er sich besser in das natürliche Verhaltensrepertoire einer Art einfügt?
Sind Artgenossen in der Nähe, warnen Hähne einander vor möglichen Gefahren
Genau einen solchen Ansatz haben die Forschenden aus Bonn verfolgt und sich dabei ein besonderes Verhalten zunutze gemacht: Sobald Gefahr droht (etwa, wenn sich ein Bussard nähert), stoßen Hähne einen typischen Alarmruf aus, mit dem sie Artgenossen warnen. Doch die Gockel krakeelen nur dann, wenn sich auch wirklich andere Hühner oder Hähne in der Nähe befinden. Sind sie allein auf weiter Flur, bleiben sie still. Man muss ja nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen.

Für ihre Experimente ließen die Wissenschaftler*innen über einem Testgehege, in dem ein Hahn herumstolzierte, die Attrappe eines Greifvogels kreisen (mittels eines Projektors warfen sie die Silhouette des potenziellen Feindes an die Decke des Versuchsraums). Konnte der Gockel durch eine Glasscheibe in einen Nebenraum schauen, in dem ein Artgenosse umherschritt, stieß er – wie zu erwarten – beim Anblick der Projektion Warnrufe aus. War der Nebenraum dagegen leer, befand sich der Hahn also allein im Stall, blieb er eher ruhig (was ebenfalls seinem natürlichen Verhalten entspricht). Überraschenderweise aber gab der einsame Gockel auch dann keine Alarmlaute von sich, wenn eine Seite des Raumes mit einem Spiegel verkleidet war, der Hahn sich also selbst sehen konnte und durch die Illusion hätte denken können, es würde sich ein weiteres Tier im Umfeld befinden. Augenscheinlich war dem Vogel also klar, dass es sich bei der Reflexion um sein eigenes Abbild handelte.
Um belastbare Daten zu erhalten, testeten die Forschenden Dutzende Hähne unterschiedlicher Rassen. "Wir können natürlich nicht ausschließen, dass die Hähne ihr Spiegelbild für einen äußerst schrägen Artgenossen halten, der alle Bewegungen nachahmt. Und dass sie sich deshalb anders als normal verhalten", sagt Erstautorin Sonja Hillemacher. "Doch der Verdacht liegt schon sehr nahe, dass sich die Tiere im Spiegel selbst erkennen."
Höheres Bewusstsein ist womöglich viel weiter im Tierreich verbreitet als angenommen
Von wegen also "dummes Huhn". Mit der Studie wäre in gewisser Weise neben Schimpansen und Delfinen eine weitere Art in das Pantheon jener (bislang wenigen) geistigen Überflieger aufgerückt, die nachweislich ein Selbstbewusstsein besitzen. Und damit weitere 19 Milliarden Individuen. Denn so viele Hühner gibt es weltweit. "Kein Nutztier ist häufiger,", sagt Hillemacher. "Umso wichtiger ist es, mehr über die Intelligenz und Bedürfnisse von Hühnern in Erfahrung zu bringen." Nicht zuletzt ergeben sich aus den Erkenntnissen über die kognitiven Fähigkeiten weitere Argumente dafür, dass die Haltungsbedingungen (die für das Gros der Hühner nach wie vor katastrophal sind) deutlich verbessert werden müssen.
Mehr noch: Die Studie legt nahe, dass ein höheres Bewusstsein, oder zumindest Übergänge dahin, viel weiter im Tierreich verbreitet ist als bisher angenommen. Und dass wir bei der Betrachtung und Beurteilung anderer Spezies, da wo es nötig und möglich ist, von unserem eigenen Standpunkt abrücken sollten. Mehr aus Sicht der Tiere zu denken, heißt schließlich auch, unsere Mitgeschöpfe besser verstehen zu können.
Eine kleine Anekdote aus der Geschichte der tierischen Intelligenztests mag das veranschaulichen. So hatte man Elefanten lange Zeit ein Selbstbewusstsein abgesprochen. Die Dickhäuter bestanden den Spiegeltest einfach nie. Doch offenbar hatte man zwei Dinge nicht bedacht: Erstens sind Elefanten keine allzu visuell orientierten Tiere. Und zweitens sind sie ziemlich groß. Erst im Jahr 2006 stellten Wissenschaftler fest, dass die bis dato benutzten Spiegel für die Elefanten schlicht zu klein waren. Konnten sich die Tiere in elefantentauglichen Riesenspiegeln betrachten, bestanden sie den Test prompt. Schauten sich von allen Seiten an – und versuchten dann ein weißes Kreuz, das man ihnen auf den Kopf gepinselt hatte, mit dem Rüssel von ihrer Stirn zu wischen.