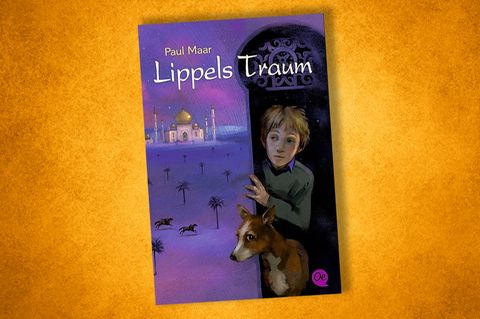Schon im Krabbelalter werden die Bildungsweichen gestellt – das zeigt eine neue Analyse des Nationalen Bildungspanels (NEPS), die das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe angefertigt hat. Die Langzeitstudie begleitet seit 2012 rund 3500 Kinder in Deutschland seit ihrem Säuglingsalter. Ihre zentrale Erkenntnis: Bereits mit zwei Jahren bestehen deutliche Unterschiede im Wortschatz und in sozialen Kompetenzen – und diese frühkindlichen Unterschiede können voraussagen, welche Kinder später in der Schule erfolgreich sein werden und welche nicht.
Die Ungleichheiten sind maßgeblich durch den sozialen und ökonomischen Hintergrund der Eltern beeinflusst: Eltern aus ressourcenreichen Haushalten geben demnach an, dass ihre Zweijährigen im Schnitt 158 Wörter aktiv nutzen – Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien dagegen nur etwa 97.
Der unsichtbare Starter-Nachteil
Der Unterschied in der Wortanzahl ist statistisch signifikant – und er verweist auf ein strukturelles Problem mit weitreichenden Folgen: Sprachliche Fähigkeiten im frühen Kindesalter sind eng mit späterem schulischen Erfolg, sozialer Kompetenz und emotionaler Selbstregulation verknüpft. Wer sprachlich schwach startet, dem fällt es bereits beim Schuleintritt schwerer, Lerninhalte zu verstehen, soziale Beziehungen aufzubauen oder schulische Anforderungen zu meistern. Die NEPS-Daten zeigen: Bildungsungleichheiten entstehen bereits weit vor der Grundschule.
Eine zentrale Rolle für die sprachliche und sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes spielen die Eltern – und zwar nicht nur durch ihr Bildungsniveau, sondern durch die Qualität der Interaktionen mit ihren Kindern. Besonders entscheidend sei, so schreiben die Autorinnen des Berichts, wie sensibel und anregend Eltern auf ihre Kinder eingehen.
Die NEPS-Analysen legen nahe, dass es Eltern mit sozio-ökonomischen Belastungen wie einer geringen Bildung oder nur wenig Einkommen häufig weniger gut gelingt, entwicklungsfördernd auf ihre Kinder einzugehen – insbesondere, wenn mehrere Stressfaktoren zusammenkommen.
Die Macht der Bücher
Ein besonders wirkungsvoller Hebel sei die gemeinsame Beschäftigung mit Bilderbüchern und das Vorlesen, bilanzieren Manja Attig vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe und Sabine Weinert von der Universität Bamberg. Schon im Säuglingsalter wirke sich das Bücherlesen positiv auf den späteren Wortschatz und das grammatische Verständnis aus. Auch die Fähigkeit, eigene Gefühle zu regulieren und sich in andere hineinzuversetzen, profitiert.
Die NEPS-Analyse fügt sich nahtlos ein in ein größeres Bild, das die Bildungsforschung seit Jahren zeichnet: Studien wie die BiKS-Erhebungen, die die sprachliche und kognitive Entwicklung von Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter untersuchten, oder die EPPE-Studie (Effective Provision of Pre-School Education) belegen, wie stark die ersten Lebensjahre über spätere Bildungslaufbahnen mitentscheiden. Insbesondere die Qualität der frühkindlichen Betreuung, das sprachliche Umfeld zu Hause und stabile emotionale Beziehungen wirken wie Verstärker oder Bremser für die Entwicklungsmöglichkeiten eines Kindes. Wie Kinder lernen, beginnt damit, wie mit ihnen gelebt wird.