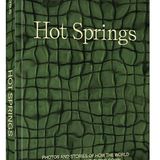Nichtschwimmen ist eine Kunst. Man kann sie zum Beispiel von zwei betagten Herren im Széchenyi-Heilbad in Budapest erlernen. In diesem Badepalast aus k. u. k. Zeiten bewegen sich die beiden gemessenen Schrittes von den Umkleiden hinein in das dampfende Thermalwasser, ohne dabei das Plaudern zu unterbrechen. Ungerührt gehen sie, bei etwa 37 Grad, in einen schwebenden Zustand über. Wir und die anderen Touristen fühlen erst mal vor, halten beim Eintauchen schreckhaft die Luft an, erörtern die Wassertemperatur und die Frage, wie heilsam dieses Bad denn wohl ist, schwimmen dann hektisch in den Nebelschwaden herum und werden nach zehn Minuten schon wieder unruhig, weil sich hier seit über hundert Jahren so gar nichts ereignet.
Dabei sollte Baden in warmem Heilwasser gerade keine Anstrengung sein, eher ein Vorgang wie Flanieren. Die älteren Herren lassen sich dann auch bald zu den berühmten Schachbrettern treiben, um neben den Spielenden genussvoll aufzuquellen.
Durch einen Riss in der Erdkruste gelangt sprudelndes Wasser an die Oberfläche
Das Wasser kommt in dieser herrlich unübersichtlichen Badeanstalt schon heiß an: aus dem Inneren der Erde. Um die 120 Quellen blubbern in Budapest. Sie speisen die zwölf Bäder der Stadt täglich mit Zehntausenden Litern Wasser. Diesen Reichtum verdankt sie ihrer Lage im Karpatenbecken und einem Riss in der Erdkruste.
Fast überall auf der Welt, wo warmes Wasser so seinen Weg nach oben findet, liegen Menschen wohlig ermattet im Sud – in domestizierten Kuranlagen oder in wilden Gumpen. Die amerikanische Fotografin Greta Rybus reiste für ihren Bildband "Hot Springs" rund um die Erde zu heißen Quellen von Island bis Japan, von Ungarn bis Mexiko. Rybus’ Bilder zeigen die unterschiedlichen Badekulturen, die sich rund um die Hotpots entwickelt haben. Und die geologischen Spektakel, die mit dem Wasser oft einhergehen.
Die Grand Prismatic Spring etwa schillert in Blau, Grün, Gelb, Orange und ist die größte der heißen Quellen im Yellowstone-Nationalpark, ein Naturdenkmal mit einem Durchmesser von etwa 80 Metern und einer Tiefe von fast 40. Zwei riesige Magmakammern im Untergrund des Yellowstone-Plateaus sorgen für die Hitze. Regen versickert und wird zu Grundwasser, das heizt sich unterirdisch auf und drückt durch das poröse Gestein schließlich wieder nach oben, wo es dann als Geysir, Schlammtopf oder eben dampfender Pool zu Tage tritt.
Aktiven Vulkane erhitzen das Grundwasser nur wenige Meter unter der Erdoberfläche
Seit in Deutschland über die Energiewende debattiert wird, ist auch das Prinzip der Erdwärmebohrung ziemlich geläufig und damit letztlich das Prinzip der Thermalquellen. Voraussetzung sind ein ausreichendes Grundwasservorkommen plus ein Gestein mit Klüften. Durch sie dringt das Wasser immer tiefer in die Erde, bis es sich an einer undurchlässigen Schicht, etwa aus Ton oder Schiefer, staut. Jeder Meter näher am Erdkern macht das Wasser heißer, und je nach geologischer Beschaffenheit, hydrostatischem Druck und Gasgehalt schießt oder tröpfelt es als Thermalquelle wieder an die Oberfläche. Doch nicht immer tritt das Wasser aus. Häufig hilft der Mensch durch Bohrungen und Brunnen nach.
In Gebieten mit aktiven Vulkanen erhitzt sich das Grundwasser oft schon wenige Meter unter der Erdoberfläche. In anderen Regionen wird das Wasser erst in viel größerer Tiefe auf seine Temperatur gebracht. Grundsätzlich gilt alles, was mit über 20 Grad Celsius aus der Erde kommt, als Thermalwasser.
Wer eine Thermalquelle besucht, steht im Dialog mit den Elementen
Den europäischen Hitzerekord hält die Gemeinde Bad Blumau in der Steiermark, wo das Thermalwasser mit 104 Grad aus der Erde kocht und mit seiner Energie nebenbei auch ein Erdwärmekraftwerk speist. Baden kann man dort in einer Therme, die der Künstler Friedensreich Hundertwasser sehenswert gestaltet hat – kurvig, mit bewachsenen Dächern und tanzenden Fenstern –, die aber trotzdem nicht an die Dramatik natürlicher Becken heranreicht: aus mineralischen Ablagerungen erwachsene Naturwunder wie die Kalkterrassen im türkischen Pamukkale (Baden verboten!). Oder die heißen Quellen nahe Saturnia in der Toskana. Wer in eine solche Thermalquelle steigt, betritt eine Zwischenwelt und steht im Dialog mit den Elementen. Dazu kommen die Nebelschwaden, die einer Thermal-Szenerie etwas Mystisches geben und den Heilaspekt glaubhaft illustrieren.
Auf seinem Weg durch die Erdschichten wird das Wasser nämlich meist gepimpt: Es nimmt – je nach Gestein – Natrium, Schwefel, Jod, Kalzium, Magnesium, Fluorid oder das Edelgas Radon auf. Kurgäste versprechen sich von einem Thermalbad Heilung oder Linderung ihrer Leiden. Offenbar nicht vergeblich. Die Forschung geht davon aus, dass sich die kurierende Wirkung des Badens aus mehreren Effekten zusammensetzt. Eine Studie der Medizinischen Universität Graz etwa konstatierte eine Senkung des Cortisolspiegels während eines 25-minütigen Bades in 36 Grad warmem Wasser, übersetzt: Stressabbau. Außerdem werde ein Hormon ausgeschüttet, durch das die Nieren ihre Produktivität erhöhen. Das Gewebe wird besser durchblutet, der Kreislauf angeregt, und Wassereinlagerungen verschwinden.
Die Zusammensetzung des Wassers entscheidet über mögliche medizinische Effekte
Durch die Haut gelangen einige der im Wasser gelösten Substanzen in den Organismus, wirken also nicht nur äußerlich. Die Anwendungen hängen von der Zusammensetzung des Wassers ab. Sie unterscheidet jeden Kurort vom nächsten. Es gibt eine medizinische Disziplin dafür: die Balneologie, Bäderkunde. Ist zum Beispiel Kohlensäure enthalten, wie in Bad Pyrmont, hat das Bad eine antiseptische und blutdrucksenkende Wirkung. Schwefelhaltiges Wasser wird bei Rheumapatienten, aber auch bei Hautkrankheiten eingesetzt. Handelt es sich um Solequellen, werden Erkrankungen der Bronchien wie Asthma behandelt, oder das Bad unterstützt den Heilungsprozess nach Knochenbrüchen – schließlich treibt der Körper in Solebecken fast schwerelos. Viele Kurversprechen sind aber bis heute sicherlich am treffendsten mit "Wohlfühlen" umschrieben und dem verordneten Nichtsmüssen.
Wie gut es tut, wenn sich flüssige Erdwärme um Knochen und Gelenke legt, wussten die Römerinnen und Römer schon vor 2000 Jahren. Dass die warmen Wasser die Gesundheit positiv beeinflussen können, war in der Antike eine eher gefühlte als belegbare Erkenntnis. Vorrangig gingen die Menschen damals ins Badehaus, um sich zu reinigen, verwöhnen zu lassen und mit Gleichgesinnten zu plaudern. Auch ihre Legionäre schickten sie zur Erholung ins heiße Quellwasser – wohl samt ihrer Pferde.
Genussvolle Badekultur: Das lebendigste Erbe der Römer
Genussvolle Badekultur dürfte heute das lebendigste Erbe der Römer sein, die fast überall in ihrem Reich Thermalquellen erschlossen und Ortschaften darum aufgebaut haben. Die Namen erinnern noch daran: In Badenweiler im Schwarzwald etwa stand mit einer Gebäudelänge von 93 Metern einst die größte römische Therme nördlich der Alpen. Auch in Baden-Baden, in Bath, England, oder eben in Budapest legten die Römer die Grundsteine für den Kurbetrieb, installierten Wasserleitungen und Fußbodenheizungen und etablierten mit Schwitz- undDampfräumen und Behandlungen wie Massagen ziemlich genau das, was heute unter dem Oberbegriff Spa zusammengefasst wird.
Eine eher stille Andacht pflegen die Badenden in Japan, dem Land, das vulkanisch und seismisch bekanntlich sehr aktiv ist. Sie folgen in den jahrhundertealten, onsen genannten Bädern strengen Ritualen, etwa der gründlichen vorherigen Reinigung des Körpers, die mit viel Schaum, diversen Schälchen und auf einem kleinen Holzhocker zu absolvieren ist. Man soll schon äußerlich rein in das warme Wasser steigen, um dort dann in aller Achtsamkeit und Ruhe auch innerlich rein zu werden. Zu viel verlangt? Egal, ob in Bad Pyrmont oder in einem Bergdorf in der Präfektur Nagano, man steigt immer ein wenig verändert aus dem Thermalwasser. Wenn schon nicht gesünder oder spiritueller, so doch auf jeden Fall wohltemperiert.