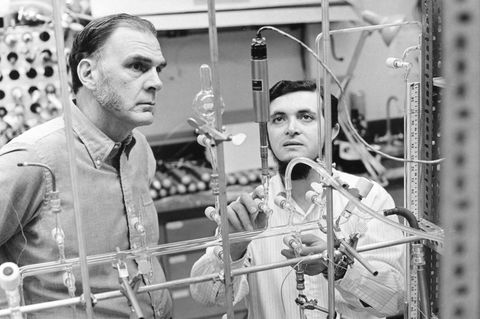Wie sieht der Baum der Zukunft aus? Die Wunschliste ist lang. Genügsam im Wasserverbrauch und tolerant gegen Hitze soll er sein. Zugleich frosthart – schließlich bringt der Klimawandel nicht nur heiße, trockene Sommer, Prognosen sagen ebenfalls zunehmend späte Kälteeinbrüche voraus. Natürlich muss so ein Zukunftsbaum auch Lebensraum für Vögel, Käfer, Pilze und Flechten bieten.
Forstwirte erhoffen sich überdies reiche Holzerträge von ihrem Zukunftsbaum.
Stadtplaner viel Schatten.
Gartendenkmalpfleger wünschen sich vor allem eines: Der Baum der Zukunft, er soll genau so aussehen wie der Baum der Vergangenheit. Gleicher Wuchs, gleiches Blattwerk, gleiche Färbung des Laubs im Herbst. Am liebsten soll das neue Gehölz eine genetisch identische Kopie des alten sein.
Das entspricht gesetzlichem Auftrag und Selbstverständnis der Denkmalpflege – sie soll das originale Erscheinungsbild von Kulturgütern bewahren. So werden selbstverständlich beim Restaurieren alter Gemälde Pigmente gewählt, die der Künstler zu Lebzeiten nutzte. Und kein Verantwortlicher käme auf die Idee, Plastik anstelle von Holzfenstern in einer jahrhundertealten, denkmalgeschützten Hofstelle zu befürworten.
Die Frage ist: Lässt sich dieses Prinzip in einer Welt, die immer wärmer wird, durchhalten? Was, wenn die Natur dabei nicht mehr mitspielt?