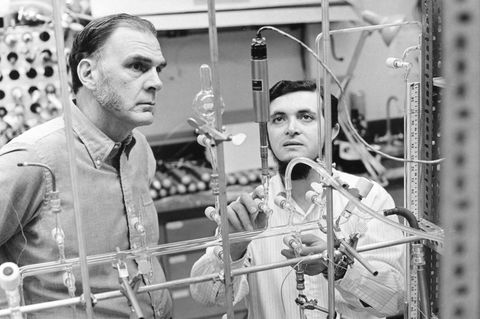Mit dem zunehmenden Schiffsverkehr in die Antarktis steigt die Gefahr, neue Tier- und Pflanzenarten in die sensiblen Ökosysteme des Südlichen Ozeans einzuschleppen. Einer Studie zufolge ist der Kontinent Antarktika mittlerweile an alle Regionen der Welt angebunden, von 58 Häfen weltweit gab es zwischen 2014 und 2018 demnach Direktverbindungen an die Küsten der entlegenen Region.
Es brauche verbesserte Schutz- und Überwachungsmaßnahmen, um die Gewässer vor dem Eindringen fremder Arten zu bewahren, insbesondere mit Blick auf die voraussichtlich weiter steigenden Wassertemperaturen in Zeiten des Klimawandels, schreiben die Forschenden in den "Proceedings" der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften ("PNAS").
Derzeit gebe es noch keine etablierten Populationen invasiver Arten in den Gewässern um Antarktika, heißt es in der Studie. Allerdings seien bereits eingeschleppte Exemplare von zehn Arten nachgewiesen worden, darunter Muscheln (Mytilus cf. platensis), Riesentang (Macrocystis pyrifera) und Moostierchen (Membranipora membranacea). "Es scheint, als stünden wir an der Schwelle zur Ansiedlung nicht-heimischer Meeresarten in der Antarktika", schreiben die Forschenden.
"Einheimische Arten waren in den letzten 15 bis 30 Millionen Jahren isoliert"
"Invasive, nicht heimische Arten sind eine der größten Bedrohungen für die biologische Vielfalt der Antarktis - die einheimischen Arten waren in den letzten 15 bis 30 Millionen Jahren isoliert", sagt Studienleiter David Aldridge von der Universität Cambridge laut einer Mitteilung.
Fremde Arten könnten prinzipiell angeheftet an Meeresalgen, Plastikmüll oder andere Lebewesen in die Region gelangen. Allerdings blockierten dicke Eisschichten, die den Kontinent umgeben, häufig den Weg. Zudem gebe es zirkulierende Meeresströmungen, die ein Eindringen weitgehend verhinderten. Es könne Monate oder Jahre dauern, bis mittreibende Arten von den subantarktischen Inseln in die antarktischen Küstenbereiche gelangten, schreiben die Wissenschaftler.
Beim Schiffsverkehr sieht die Sache gänzlich anders aus: Binnen weniger Tage können Fracht- und Forschungsschiffe, Touristen- oder Fischerboote von weit entfernten Regionen an die Küsten der Antarktis gelangen - und fremde Organismen, angeheftet am Schiffsrumpf, mitbringen. Die Forscher analysierten nun den Schiffsverkehr in der Region südlich des 60. südlichen Breitengrads und stellten so fest, von welchen Häfen wie viele Schiffe die Antarktis ansteuerten.
Insgesamt fanden sie Verbindungen von 1581 Häfen außerhalb des Südlichen Ozeans aus quasi allen Regionen der Erde in die Antarktis. Jede Region sei eine potenzielle Quelle für invasive Arten, der Kontinent sei mitnichten so isoliert wie häufig angenommen. Arten aus Nordeuropa, Südamerika und dem Nordwestpazifik stellten vermutlich den größten Anteil potenziell invasiver Arten.
Direktverbindungen an die Küsten der Antarktis von 58 Häfen in 23 Ländern
Fünf Häfen gälten formell als "Antarctic Gateway" - also Ausfahrtshäfen in die Region. Sie liegen in Ushuaia (Argentinien), Punta Arenas (Chile), Hobart (Australien), Christchurch (Neuseeland) und Kapstadt (Südafrika). Dort würden Schutzmaßnahmen bereits umgesetzt, etwa die Bootsrümpfe gereinigt.
In Wirklichkeit legen aber Schiffe von deutlich mehr Häfen in Richtung Antarktis ab, wie die Untersuchung ergab. So habe es zwischen 2014 und 2018 von 58 Häfen in 23 Ländern Direktverbindungen an die Küsten gegeben - das sind zehnmal mehr als die Gateway-Häfen allein. Die zehn häufigsten Start-Häfen liegen demnach in sieben Regionen, außer denen der Gateway-Häfen seien das Uruguay sowie die Falkland Inseln.
Die gute Nachricht: Diese Länder gehörten sämtlich zu den wesentlichen Partnern des Antarktis-Vertrages, dessen Ziel es unter anderem ist, das ökologische Gleichgewicht der Region zu erhalten. Es gebe damit schon Kooperationen zwischen den Ländern, mit geeigneter Unterstützung dürften sie wichtige Biosicherheits- und Umweltinspektionen in ihren Häfen etablieren können, meinen die Wissenschaftler.
Am gefährdetesten für eine Einschleppung sind der Untersuchung zufolge die Antarktische Halbinsel sowie die nördlich davon liegenden Südlichen Shetlandinseln. Sie würden mehr als sieben Mal so häufig besucht wie alle restlichen Regionen zusammen. Forschungsschiffe und Versorgungsschiffe stellen die größte Gefahr dar, obwohl Touristenschiffe den weitaus größeren Anteil an allen Antarktis-Reisen haben, schreiben die Forscher weiter. Der Grund: Diese Schiffe verweilten häufig länger, Forschungsschiffe hätten zudem als einziger Schiffstyp Verbindungen in alle Gegenden des Kontinents.
Besonders besorgt äußern sich die Forscher mit Blick auf Schiffe, die an beiden Polen im Einsatz seien. Sie könnten bereits an Kälte angepasste Arten von der Arktis in die antarktische Region transportieren.
Für einen erfolgreichen Erhalt der antarktischen Arten und Lebenswelten sei es notwendig, sowohl das Problem des Klimawandels als auch das direkter, lokaler Einflüsse des Menschen anzugehen. "Es gibt strenge Vorschriften, um zu verhindern, dass nicht-heimische Arten in die Antarktis gelangen, aber der Erfolg dieser Vorschriften hängt davon ab, dass wir über Informationen verfügen, die uns bei Managemententscheidungen unterstützen", sagt Arlie McCarthy von der Universität Cambridge. "Wir hoffen, dass unsere Ergebnisse dazu beitragen, invasive Arten zu erkennen, bevor sie zu einem Problem werden."