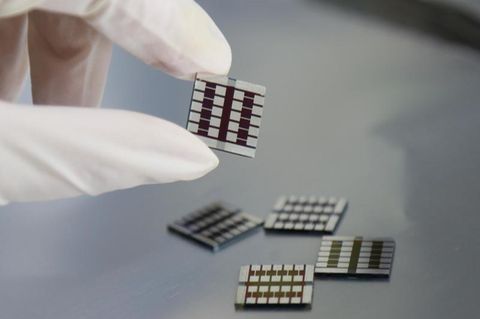Am 28. September wird die Bundesregierung ihr neues Energiekonzept beschließen. Doch schon jetzt regt sich Widerstand. Umweltexperten kritisieren vor allem die vorgesehenen Laufzeitverlängerungen für Kernkraftwerke. Um durchschnittlich zwölf Jahre länger sollen die Betreiber ihre alten Kernkraftwerke nutzen dürfen - entgegen dem vor zehn Jahren beschlossenen Atomkonsens über den Ausstieg aus der Atomkraft.
Begründet wird das mit der "Brückenfunktion" der Kernkraft auf dem Weg ins Zeitalter der erneuerbaren Energien. Doch die Experten des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU), der die Regierung berät, warnen in einem gestern veröffentlichten Kommentar: Die Laufzeitverlängerungen sind nicht nur unnötig. Sie bremsen den Ausbau der erneuerbaren Energien aus.
Grund dafür sei ein "technisch-ökonomischer Systemkonflikt", so die Experten. Das Problem: Die erneuerbaren Energien, die laut dem Konzept bis zum Jahr 2050 einen Anteil von 80 Prozent an der Stromversorgung haben sollen, können ihren Strom nicht gleichmäßig über den Tag verteilt liefern wie konventionelle Kraftwerke. Sonneneinstrahlung und Wind lassen sich nun einmal schlecht berechnen.
Bei dem geplanten Ausbau der Erneuerbaren werden in den kommenden Jahren also immer öfter Kern- und Kohlekraftwerke zeitweise abgeschaltet werden müssen. Dafür sind sie aber technisch nicht ausgelegt. Schon ab 2020 müsse mit rund 120 Abschaltungen pro Jahr gerechnet werden. Erhebliche Mehrkosten wären die Folge.
Paradoxerweise könne es sogar dazu kommen, dass die Betreiber Geld dafür zahlen, dass sie ihren Strom ins Netz einspeisen. Nämlich dann, wenn der Strom wegen des Überangebots so billig ist, dass die Betreiber ihre Produktionskosten nicht decken können. Doch bei der Stromeinspeisung draufzuzahlen wäre dann immer noch günstiger, als ein Kraftwerk komplett herunterzufahren.
So könnte das zu erwartende Überangebot sogar dazu führen, dass die Strompreise für Endverbraucher steigen.

"Marktorientierter" Ausbau der Erneuerbaren Energien
Mit Blick auf das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht das Energiekonzept eine stärkere "Marktorientierung" vor. Unklar ist bislang, ob damit auch eine Flexibilisierung oder gar Abschaffung der Einspeisevergütung gemeint ist. Die Experten des SRU befürchten, dass die Bundesregierung den Vorrang der Erneuerbaren bei der Einspeisung ins Stromnetz oder die garantierte Einspeisevergütung aufgeben will. Damit entfiele aber auch der Druck auf die Betreiber, die technische Ausstattung ihrer konventionellen Kraftwerke an die Erfordernisse einer steigenden und flexiblen Einspeisung anzupassen.
Besonders brisant: Sollte die Einspeisevergütung entfallen, würden Investitionen in diese Branche unattraktiv. Vor allem für kapitalintensive Projekte wie Offshore-Windparks. Denn für solche Investitionen sind zuverlässige Erträge Voraussetzung.
Nicht belegbare Vorteile
Die klimapolitischen und gesamtwirtschaftlichen Vorteile der Laufzeitverlängerung, die das Energiekonzept der Bundesregierung herausstellt, können die Experten des SRU nicht nachvollziehen. So sei die Reduktion der Klimagasemissionen um 85 Prozent bis zum Jahr 2050 auch ohne Laufzeitverlängerung erreichbar. Zwar könne es im Jahr 2030 zu höheren Emissionen kommen, da die erforderlichen Strommengen durch Gaskraft und zusätzliche Auslastung von Kohlekraftwerken gedeckt werden müsse. Das lasse sich aber durch einen "etwas stärkeren" Ausbau der Erneuerbaren kompensieren.
Mit Blick auf die Endverbraucherpreise bemängeln die Experten, dass die Kosten der Endlagerung nicht in die Berechnung der Bundesregierung eingeflossen seien.
Das Resümee der Sachverständigen: Schon ohne die Bremswirkung der Laufzeitverlängerung sind die Klimaschutzziele des Energiekonzepts am "unteren Rand des Erforderlichen" angesiedelt. Sollten ihre Befürchtungen zutreffen, dürften sie bei weitem verfehlt werden.