Die Protagonisten der Ausrottung nehmen kein Blatt vor den Mund: Die Fremden, sagen sie, sind ein riesiges Problem. Für Einheimische und Wirtschaft. Sie kosten Geld, verderben das vertraute Bild und bergen die Gefahr der Ansteckung. Ihrem Vormarsch muss Einhalt geboten werden. Am besten wäre es, sie wieder ganz auszurotten und den alten Zustand, den guten, wiederherzustellen. Für dieses edle Ziel sind Übertreibungen erlaubt. Sonst wird die Gefahr womöglich zu spät erkannt, und die "Aliens", die "Invasiven", die "gebietsfremden Arten" haben sich unausrottbar bei uns eingenistet - neben dem Klimawandel die größte Bedrohung für die Lebensvielfalt im 21. Jahrhundert. Sie gehören einfach nicht hierher, weil ihr Platz anderswo ist; im Fernen Osten, Westen oder Süden. Wir wollen sie nicht, weil sie sich auf unsere Kosten "wie ein Krebsgeschwür ausbreiten, infiltrierend, metastasierend!". So war es in der Zeitschrift "Nationalpark" vor über 20 Jahren zu lesen. Kaum weniger zurückhaltend äußern sich die Autoren im soeben erschienenen Buch "Unheimliche Eroberer" über invasive Pflanzen und Tiere in Europa und treffen damit die Grundstimmung breiter Kreise in Naturschutzorganisationen und -behörden.
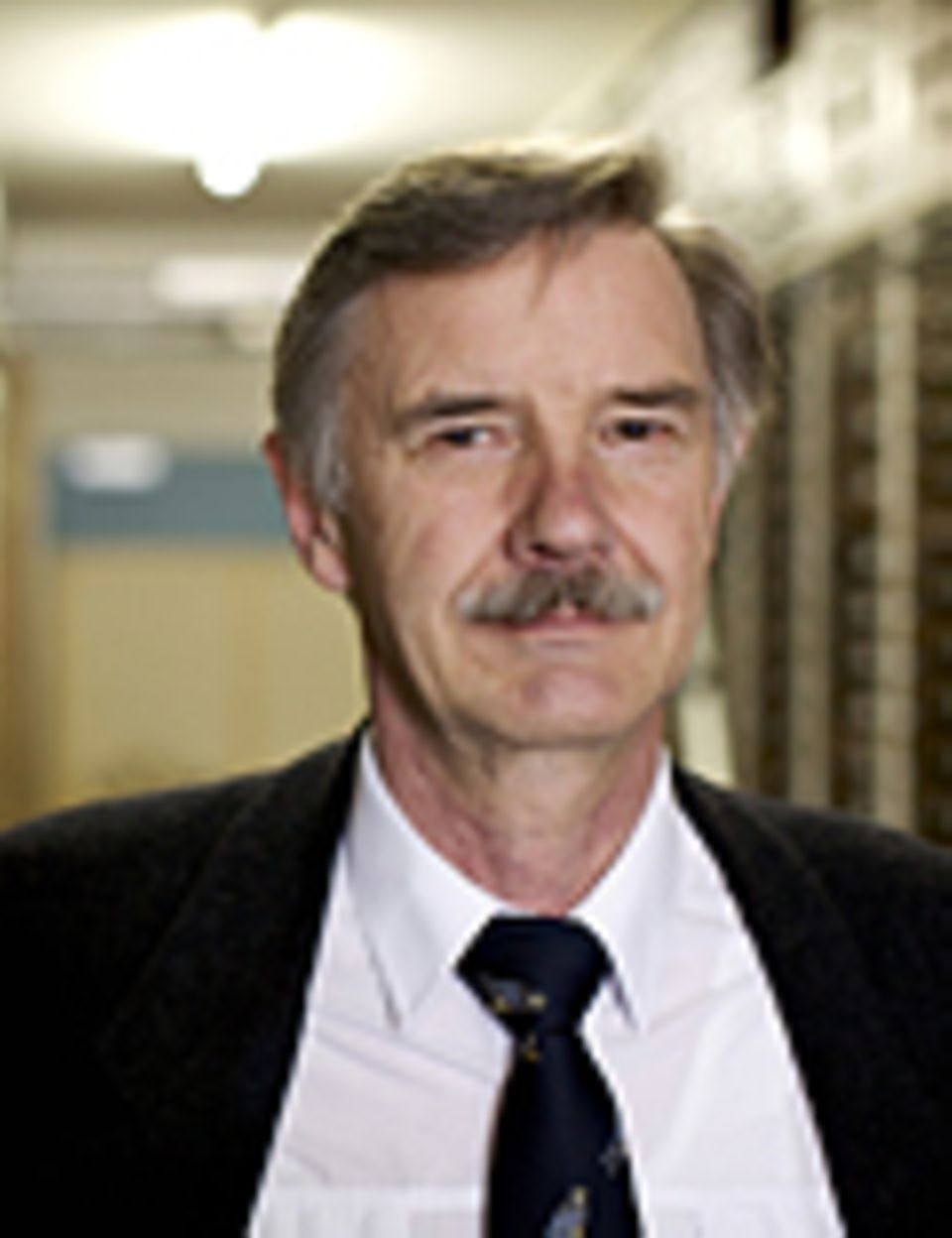

Harte Fakten sind bei dieser Wertung allerdings kaum im Spiel. So mahnten denn auch im Wissenschaftsmagazin "Nature" kürzlich der Biologe Mark Davis und 18 weitere international führende Ökologen zu weniger Emotion und mehr Vernunft: "Beurteilt die Arten nicht nach ihrer Herkunft". Die Annahme einer geradezu apokalyptischen Bedrohung der Biodiversität durch eingeführte Spezies sei überhaupt nicht durch entsprechende Befunde gestützt. Die hohen Kosten der versuchten Wiederausrottung, wie etwa der Kaninchen in Australien oder der Ziegen auf Galapagos, hätten nicht gelohnt. Die Aktionen waren, abgesehen von den speziellen Fällen auf kleinen ozeanischen Inseln mit besonderen Arten, letztlich nutzlos - und unnötig.
So mancher Naturschützer mag das vielleicht nicht begreifen wollen, aber gebietsfremde Arten haben auch Vorzüge. So ernähren sich Zigtausende von Tauchenten von vorderasiatischen Wandermuscheln, die sich im vergangenen Jahrhundert stark in Europa ausgebreitet haben. Die einst in den Südbuchenwäldern Patagoniens für den Pelzhandel ausgesetzten kanadischen Biber schufen mit ihren Dämmen neue Brutgewässer für seltene Wasservögel. In den fischfreien Bächen des Bayerischen Waldes überlebten die letzten Fischotter nur dank einer neuen Beute, der Bisamratte - einem Fremdling aus Nordamerika. Und derzeit geht es den ansonsten global in Bedrängnis gekommenen Honigbienen gut in den Städten, weil dort im Gegensatz zur öden Flur fast das ganze Jahr jede Menge ausländischer Blumen blühen.
Ein Umdenken ist nötig Die Feinde, die unsere Vielfalt wirklich bedrohen, sind nicht die fremden Arten, sondern vielmehr höchst erfolgreiche "Einheimische" und die Hochleistungslandwirtschaft. Erst der industrielle Ackerbau hat einige wenige fremde Spezies "invasiv" gemacht, weil er ihnen im wahrsten Sinne des Wortes den Nährboden bereitet hat. So wuchern etwa Riesenbärenklau, Drüsiges Springkraut und Riesenknöterich nicht, weil sie "böse Arten" sind, sondern weil sie Unmengen von Nährstoffen serviert bekamen, die sie zum prächtigen Wachstum verleiten. Mehr als dreieinhalb Meter hoch wird der Riesenbärenklau, entfaltet halbmetergroße Blütenteller und bildet schier undurchdringliche Wälder. Im 19. Jahrhundert zur Verbesserung der Bienenweide aus Asien eingeführt, locken seine Blütenstände viele Insekten. Naturschützer, die ihn nun wieder bekämpfen wollen, brauchen Schutzanzüge, weil die Pflanzen bei Sonnenschein und Berührung mit nackter Haut heftige phototoxische Reaktionen mit schlecht heilenden "Brandwunden" hervorrufen.
So rücken manche Rodungstrupps wie in Science-Fiction-Filmen dem Riesen mit Flammenwerfern zu Leibe. Vergleichsweise harmlos sind dagegen das aus Asien stammende Drüsige Springkraut und der Riesenknöterich. Sie wuchern nur. Das Springkraut galt mit seinen schönen weißen, rosafarbenen und roten Blüten Anfang des 20. Jahrhunderts als die "Orchidee des Kleingärtners".
Die Knöteriche, die übermannshohe, dichte Gebüsche bilden, pflanzte man im 19. Jahrhundert, um dem Wild Nahrung und Deckung zu bieten. Es gab damals also gute Gründe, diese Pflanzen einzuführen. Rund 100 Jahre lebten sie in Eintracht mit der heimischen Natur. So lange Nährstoffe knapp waren, reichte es nicht für störenden Riesenwuchs. Das änderte sich erst in den 1970er Jahren durch Kunstdünger und extreme Güllewirtschaft. Bereits vor 20 Jahren überstiegen die Mengen an Stickstoffdünger die Entnahme durch die Ernte um mehr als 100 Kilogramm Reinstickstoff pro Hektar und Jahr. Hinzu kam "Düngung aus der Luft", zusätzliche 30 bis 60 Kilogramm, verursacht von Autos und Heizanlagen. Noch nie stand Pflanzen so viel Stickstoff zur Verfügung.
Die meisten Arten vertragen dieses Zuviel nicht, so etwa die Ackerwildkräuter, die immer weiter verschwinden. Einige Arten profitieren aber besonders stark: nämlich diejenigen, die ihrer Natur nach auf besonders nährstoffreiche Verhältnisse eingestellt sind. Das müssen keineswegs nur fremde Arten sein. Brennnessel und Löwenzahn gehören auch zu den Gewinnern der Überdüngung. Dies also, nicht die Invasion, ist der bedeutendste Grund für das Schwinden von Biodiversität.
Die extreme Vermehrung mancher Spezies zeigt an, dass etwas im Hintergrund geschieht. Das gilt auch für die fremden Tierarten wie etwa die bereits erwähnte Bisamratte. Sie hat sich um die 1950er und 1960er Jahre dramatisch vermehrt, weil ihr in den damals stark überdüngten, ungeklärten Abwässern Wasserpflanzen und Muschelbestände als Nahrung in Hülle und Fülle zur Verfügung standen. Erst nach der Inbetriebnahme moderner Kläranlagen ging die Bisampopulation stark zurück - und nicht etwa dank des behördlichen Bekämpfungsdienstes. Wer die Massenvermehrung der Pazifischen Auster an den europäischen Küsten untersucht, kommt ebenfalls an der Überdüngung der Küstengewässer nicht vorbei.
Es gibt keinen richtigen Zustand der Natur. Ihr Wesen ist Veränderung Und so ist der Nutzen und Schaden des Fremden eine reine Frage der Definition: Dass Maiswurzelbohrer und Kartoffelkäfer schädlich werden können, steht außer Frage. Allerdings sind Mais und Kartoffel ebenfalls Fremdlinge. Wären sie so unerwünscht wie andere Einwanderer, würde man die Käfer als nützliche biologische Schädlingsbekämpfer betrachten. Als solche gelten ja auch die Asiatischen Marienkäfer, die als erwünschte Fremdlinge Blattläuse attackieren. So wird sortiert, wie es gerade passt: Schädliches als fremd gestempelt, bei Nützlichem die Herkunft aus der Ferne lieber nicht betont. Mit wissenschaftlicher Redlichkeit hat das nichts zu tun. Wenn schon werten, dann alle Arten ohne Ansehen der Herkunft!
Wo es begründete Schäden gibt, sind Gegenmaßnahmen ja durchaus angebracht. Aber Natürlichkeit ist ein schwaches Argument. Ein "richtiger Zustand" der Natur lässt sich nicht festlegen. In Deutschland gibt es, wie in allen dicht von Menschen besiedelten Regionen, das wirklich Heimische ohnehin nur noch in Resten. Gebietsfremde Arten prägen seit vielen Jahrhunderten auf mehr als 95 Prozent der Fläche unsere Landschaften. Weizen und Gerste stammen aus dem Vorderen Orient. Wälder sind gepflanzte Forste, Fischbestände nach den Vorstellungen der (Angel-) Fischerei zusammengesetzt.
Die heile Welt besteht eben nicht aus guten, weil heimischen Lebewesen. Diese Haltung ist zu simpel. Natur verharrt nicht statisch. Veränderung ist ihr Wesen. Vernünftiger Artenschutz gebietet es daher vor allem, gegen Überdüngung anzugehen, gegen Gleichmacherei der Fluren und Degradierung der Kulturlandschaft zur Erzeugung "grüner" Energie. Und Naturschützer, die nur die Einheimischen schützen wollen, sollten darauf achten, dass ihr Jargon nicht in allgemeine Fremdenfeindlichkeit abgleitet. Davor sollten wir uns hüten.

























