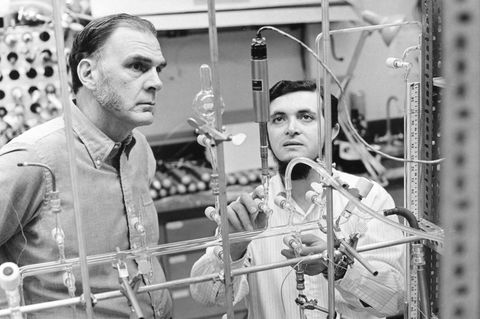Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Das ist, kurz gesagt, die Einschätzung des obersten deutschen Gerichts. Es bestätigt damit, was Klimaschützer und Umweltverbände seit seinem Inkrafttreten im Jahr 2019 immer wieder kritisiert haben: Es reicht bei weitem nicht aus. Von einem "unfassbar großen Tag für viele" sprach Klimaaktivistin Luisa Neubauer, eine der Klägerinnen. Ist es auch ein großer Tag für den Klimaschutz?
Zunächst einmal ist der Beschluss eine höchstrichterliche Entlarvung. Die Bundesregierung kann sich nun nicht länger als ambitionierte Klimaschützerin inszenieren. Das Gesetz tut nämlich genau das nicht, was es soll: "die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten." Die Hauptlast der erforderlichen Reduktion werde, so die Richter, wegen zu schwacher Vorgaben bis 2030 auf die Zeit danach verschoben.
Genau hier sehen die Richter die grundgesetzlich verbrieften Freiheitsrechte der jungen Klägerinnen und Kläger verletzt: Die nach 2030 erforderlichen Emissionsminderungen bis zur Klimaneutralität müssten dann nämlich "immer dringender und kurzfristiger erbracht werden". Und davon sei "praktisch jegliche Freiheit potenziell betroffen". Nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens seien mit der Emission von Treibhausgasen verbunden – und nach 2030 von drastischen Einschränkungen bedroht, so die Einschätzung der Richter. So gesehen, ist der Beschluss auch ein Stärkung der Generationengerechtigkeit. Das ist nicht wenig.
Welche Folgen hat der BVG-Beschluss?
Aber ist die Entscheidung nun auch der Durchbruch für den Klimaschutz? Hier ist Vorsicht geboten. Denn das Gericht verpflichtet die Bundesregierung nicht etwa zu einer sofortigen Überarbeitung des Klimagesetzes. Ins Aufgabenheft des Gesetzgebers schreiben die Richter lediglich, dass bis Ende 2022 die Minderungsziele der Treibhausgasemissionen "näher geregelt" werden müssen. Auch können die Richter nicht feststellen, dass die Bundesregierung mit dem Klimagesetz gegen grundrechtliche Schutzpflichten oder gegen das Klimaschutzgebot verstoßen habe, das sich aus dem Artikel 20a des Grundgesetzes ergibt.
Die Aufgabe, die Minderungsziele zu präzisieren – und vor allem: zu erklären, wie es konkret gehen soll – lastet schon jetzt schwer auf der nächsten, vielleicht schwarz-grünen Bundesregierung.
Denn ein Grund für zu zaghaften Klimaschutz war bislang auch die Angst vieler Politikerinnen und Politiker vor besorgten Bürgern und Wählern, die sich ihrerseits gegen Eingriffe in vermeintliche Grundrechte verwahren. Wie glatt das politische Parkett ist, demonstrieren immer wieder überhitzte, zunehmend schrill geführte Debatten, etwa über den Fleischkonsum, über Eigenheime oder ein generelles Tempolimit auf Autobahnen.
Die entscheidende Frage wird also nicht sein, was zukünftig vor Gerichten Bestand hat. Sondern, ob ein gesellschaftlicher Konsens darüber erreicht werden kann, dass Klimaschutz (und übrigens auch Artenschutz) unumgänglich ist. Und zwar auch dann, wenn er uns dazu zwingt, unseren Konsum von Tieren, Dingen und Kilometern drastisch zu reduzieren.