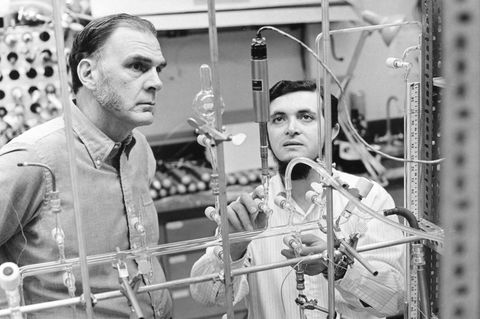Nun also Klimt. Nachdem Aktivisten schon einen Monet, einen Van Gogh und andere Gemälde von Weltrang mit Tomatensaft oder Kartoffelbrei bekleckert hatten, traf es nun "Tod und Leben" von Gustav Klimt. Ein Aktivist beschmierte das Werk mit "Öl", ein anderer klebte sich an das schützende Glas. Nicht etwa, um eine Debatte über Kunst anzustoßen. Sondern um auf die Klimakrise hinzuweisen. Das ist auf eine verdrehte Weise kreativ und provokativ zugleich. Und leider sinnlos.
Dass Aktionen in Museen auch nur indirekt der Sache – dem Schutz des Klimas – dienen, ist unwahrscheinlich: Niemand wird zu Hause die Heizung drosseln, weil irgendwo jemand ein Bild mit irgendwas beschmiert hat. Niemand wird deswegen langsamer fahren. Keine Politikerin wird deswegen die Streichung von umweltschädlichen Subventionen anordnen. Keine Klimakonferenz wird das Reißen der 1,5-Grad-Latte unter Strafe stellen.
Sie nützen nicht nur nichts, diese Aktionen, sie sind auch nicht gerechtfertigt. Weder die Kunstwerke noch die Künstler haben einen nennenswerten Anteil am Aufstieg der fossilen Energien und am Niedergang des Klimas. Auch die Kunsthallen und ihre Direktor*innen nicht. Ebenso wenig die Besucher*innen. Wer sonntags durch die Sammlungen pilgert, ist nicht notwendigerweise ein besonders tadelnswerter Klimasünder.
Museen sind immer auch Orte der kritischen Reflexion
Ganz im Gegenteil: Kunsthallen und Museen beleuchten schon seit Jahren mit Sonderausstellungen das Spannungsverhältnis von Mensch und Natur, das Kunstschaffende zu allen Zeiten wie Seismografen aufgezeichnet haben. Sie geben damit Raum für Selbstreflexion – und befördern den gesellschaftlichen Diskurs über die Mechanismen der Ausplünderung des Planeten Erde durch Homo sapiens.
Statt Museen als wichtige gesellschaftliche Multiplikatoren in dieser Rolle zu stärken, könnten die Angriffe auf Kunstwerke nun das Gegenteil bewirken: Weitere Bilder werden hinter schützendem Glas verschwinden, vielleicht gar im Magazin, wo sie sicherer sind. Möglicherweise wird es schwieriger, Werke zu schützen, sie zu versichern und auf Reisen zu schicken. Was soll damit gewonnen sein?
Hinzu kommt: Die Angriffe mögen bislang symbolischen Charakter haben. Doch eine Beschädigung der Kunstwerke selbst wird zumindest suggeriert. Und in dieser Andeutung liegt auch eine Drohung. Wann wird das erste Werk in seiner Substanz unwiederbringlich beschädigt?
Man muss den Wiener Aktivisten zugutehalten, dass sie mit ihrer Aktion auch das Greenwashing fossiler Player kritisiert haben. Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV hatte einen Tag freien Eintritt ins Leopold Museum gesponsert, das auch Klimts "Tod und Leben" zeigt. Solche Finanzierungsmodelle müssen zumindest hinterfragt werden. Es darf nicht egal sein, woher das Geld für die Kunstförderung kommt. Doch weder die kollektive Gleichgültigkeit im Angesicht der Klimakrise noch öliges Kultursponsoring rechtfertigen Attacken auf die Werke Constables, Van Goghs oder Klimts. Sie sind einzigartig, unschuldig und wehrlos.
Schlimmer noch: Mit der krassen Unangemessenheit ihrer Aktionen lenken die Aktivist*innen von der Debatte ab, die eigentlich geführt werden müsste. Und manövrieren den Protest ins Abseits.