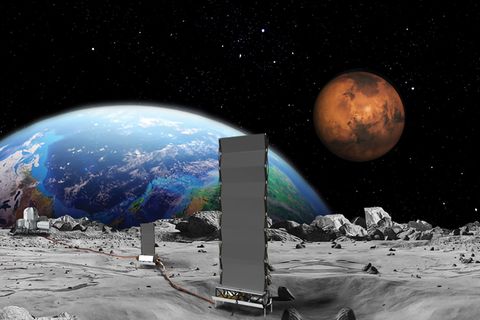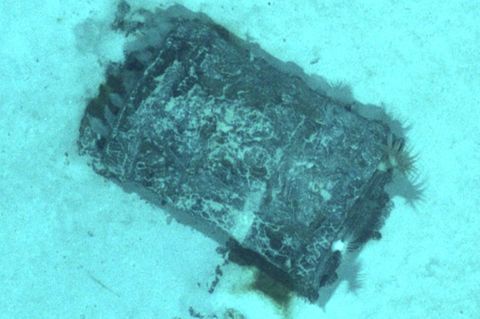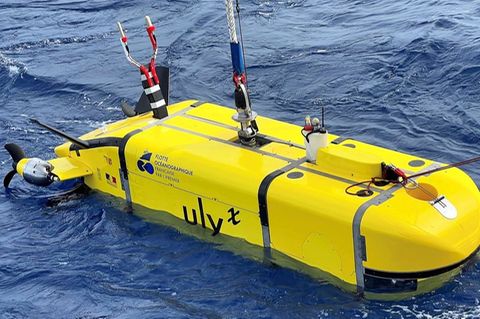Wenn am kommenden Samstag in den Kraftwerken Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2 der Schalter umgelegt wird, geht eine Epoche zu Ende: eine Epoche, die 1957 mit dem ersten Forschungsreaktor in Deutschland und Verheißungen billig sprudelnder Energie begann – und nun mit der bitteren Erkenntnis endet, dass die Kosten und Risiken dieser Energieerzeugungsform ihren Nutzen weit überwiegen. Angesichts aktueller, rückwärtsgewandter Debatten ist es ratsam, sich die Gründe für den 2011 beschlossenen Ausstieg in Erinnerung zu rufen:
Atomenergie ist – anders als oft behauptet – immens teuer. Der Rechentrick besteht darin, alle Risiken und Folgekosten zu externalisieren, also aus der Gesamtaufstellung der Kosten zu entfernen. Allein Zwischen- und Endlagerung (die Suche nach einem geeigneten Standort wird erst 2031 abgeschlossen sein) werden die Steuerzahler am Ende fast 170 Milliarden Euro kosten: fast ein Doppelwumms.
Atomenergie ist riskant, wie nicht nur Tschernobyl und Fukushima, sondern auch das aktuelle Beispiel des Kraftwerks Saporischschja in der Ukraine zeigen. Riskant ist auch, dass sie problematische Abhängigkeiten zementiert: Fast 40 Prozent des in der EU verwendeten Urans stammen aus Russland und der Ex-Sowjetrepublik Kasachstan.
Ebenso problematisch: Atomenergie bremst den Ausbau der Erneuerbaren. Der (Weiter-)Betrieb von Atomkraftwerken, jetzt oft gefordert als Maßnahme gegen hohe Energiepreise und angebliche Stromlücken, bremst die Energiewende aus. Doch gerade die muss jetzt, nach einem verschlafenen und verschenkten Jahrzehnt, Fahrt aufnehmen: Es gibt keine sichere Energieversorgung, die nicht dezentral und erneuerbar ist.
Atomenergie ist unverantwortbar – und kann deshalb nicht nachhaltig sein
Wer jetzt fordert, die noch vorhandenen AKW sollten auf Kosten der Steuerzahler in Reserve gehalten werden, um eine angebliche Stromlücke zu vermeiden, überschätzt die Bedeutung der drei verbliebenen Kraftwerke – knapp fünf Prozent – für die deutsche Stromerzeugung. Und bagatellisiert die offensichtlichen Nachteile dieser Energiegewinnung.
Atomkraft ist nicht nachhaltig. Sie ist es nicht, weil der Brennstoff Uran endlich ist, weil kaum kalkulierbare Risiken an Tausende Generationen weitergegeben werden – und weil sie die dringend erforderliche "Deutschlandtempo" bei der Energiewende drosselt. Sie schließt keine Stromlücke, sondern verhindert, dass eine geschlossen wird. Die bei den Erneuerbaren nämlich.
Man kann nun darüber streiten, ob es unter Klimagesichtspunkten nicht sinnvoller gewesen wäre, zuerst aus der Kohleverstromung und danach aus der Atomkraft auszusteigen. Eine Frage, die auch hartgesottene Umweltaktivisten in einen Zwiespalt stürzt. Aber sie ist müßig: Der geringe Anteil der verbliebenen AKW an der deutschen Stromerzeugung bringt nur einen marginalen Klimavorteil (dem unversicherbare und damit letztlich unverantwortbare Risiken sowie gigantische Kosten gegenüberstehen). Und auch der Ausstieg aus der Kohle ist beschlossene Sache. Er muss, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, vorgezogen werden. Entscheidend dafür wird sein, wie gut Deutschland mit der Energiewende vorankommt.
Am Samstag werden in den Kraftwerken Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2 die Lichter nicht ausgehen: Dann beginnt der jahrzehntelange Rückbau von Anlagen einer hoch problematischen Technologie. Die in Deutschland hoffentlich Geschichte ist.