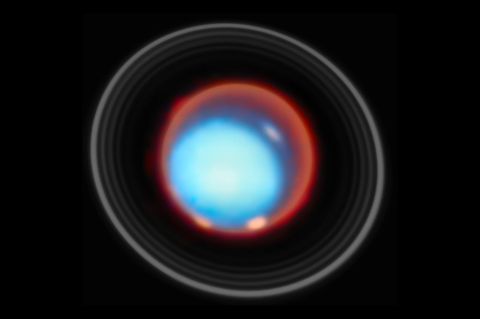Weberameisen erschaffen Großes: zum Beispiel, wenn sie ihre Nester bauen. Das gelingt ihnen auf erstaunliche Weise im Kollektiv. Zunächst fangen sie klein an. Mit ihren Mundwerkzeugen zupfen die in den Tropen lebenden Ameisen an den Rändern von Blättern. So überprüfen die Insekten das Baumaterial ihres neuen Unterschlupfs. Dann bewerkstelligen sie es, die Blätter zu verbiegen oder gar zusammenzurollen. Am Ende nutzen sie die Seide ihrer Larven, um die Elemente ihrer Konstruktion miteinander zu verkleben. So erschaffen sie Behausungen, die einen halben Meter Länge erreichen können.
Für das Gelingen solcher Großprojekte spielt eine Eigenschaft eine besondere Rolle: Die Tiere steigern ihre individuelle Leistung, je größer das Team wird, wie Forschende kürzlich herausfanden. Bei Menschen ist eher das Gegenteil der Fall: In großen Gruppen lässt die Leistung des Einzelnen in der Regel nach. Dieses Phänomen, das als Ringelmann-Effekt bezeichnet wird, kennt die Verhaltensforschung seit mehr als 100 Jahren. Im Jahr 1913 zeigte der französische Ingenieur und Agrarwissenschaftler Max Ringelmann in einem inzwischen berühmten Experiment, dass Studierende beim Seilziehen ein bisschen weniger kraftvoll mitwirkten, wenn mehrere Personen mitzogen – ganz anders, wenn sie als Solisten gefragt waren.
Weberameisen übertreffen die Effizienz menschlicher Teams
Weberameisen hingegen verhalten sich beim Teamwork genau umgekehrt. Sie arbeiten härter. Die neue Studie zeigt: Sie bilden hocheffiziente Gruppen, in denen jedes Individuum seinen Beitrag steigert, sobald die Schar der Mitwirkenden wächst. Die winzigen Architekten verdoppeln beispielsweise ihre Zugkraft, wenn weitere Ameisen dazukommen. Mithilfe eines Kraft-Ratschen-Systems, bei dem einige ziehen und andere als Anker fungieren, übertreffen sie die Wirkung menschlicher Teams.
Die baumbewohnenden Ameisen der Art Oecophylla smaragdina kommen in Asien und dem Norden Australiens vor und sind für ihre spezielle Kooperation bekannt: Sie verbiegen und rollen nicht nur Blätter und kleben sie mit Larvenspinnseide zu Nestern im Kollektiv zusammen, sie bilden dabei vor allem auch Ketten, die als "lebende Seile" dienen. Mit der Kraft der Vielen ziehen sie so an den für ihre Größe gewaltigen Blättern.
Die Biologin Madelyne Stewardson und der Verhaltensökologe Chris Reid von der Macquarie University arbeiteten mit einer internationalen Forschungsequipe zusammen, um die Kräfte zu messen, die unterschiedlich große Ameisenteams mit solchen Ketten aufbringen.
Ameisen teilen ihre Arbeit in zwei Disziplinen auf: Einige ziehen aktiv, während andere als Anker wirken
Dazu verlockten die Forschenden, darunter auch der Konstanzer Biologe Daniele Carlesso, Ameisen dazu, an künstlichen Blättern zu ziehen – die mit einem Kraftmesser verbunden waren. Die Ameisen teilten ihre Arbeit in zwei Disziplinen auf: Einige zogen aktiv, während andere als Anker wirkten – und als eine Art Speicher. Die Ameisen am Ende einer Kette ließen ihre Körper langsam langziehen und speicherten so die Zugkraft, während die vorderen Ameisen unermüdlich zogen. Längere Ketten aus Sechsbeinern erwiesen sich dabei insgesamt als widerstandsfähiger und als einzelne Tiere. Jedes Individuum in der Gruppe verstärkte zudem seinen Beitrag. Jede einzelne Ameise verdoppelte ihren Einsatz nahezu – so konnten sie der Gegenkraft des Blattes besser trotzen.
Die Entdeckung könnte entscheidend für Roboter sein, die in Teams zusammenwirken sollen. Bisher sind sie in solchen Fällen meist nicht so programmiert, dass jeder von ihnen im Kollektiv mehr Kraft aufbringt. Das könnte beispielsweise autonome Schwärme von Drohnen deutlich effizienter machen. Den Weberameisen sei Dank.