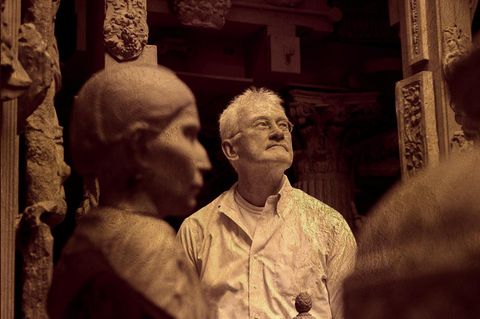163 Quadratkilometer Eiland inmitten des endlosen Pazifiks: Wenige Orte auf der Welt sind so abgelegen wie Rapa Nui, die Osterinsel. 1900 Kilometer sind es gen Westen bis zur nächsten bewohnten Insel, 3700 Kilometer gen Osten bis zur chilenischen Küste. Berühmt ist die Insel vor allem für ihre gut tausend gigantischen Steinstatuen, Moai genannt. Eine rätselhafte Kultur schuf sie vor hunderten Jahren. Der starre Blick der grauen Riesen fällt auf grasbedeckte Hänge, an denen einst Paschalococos disperta gedieh, eine Verwandte der chilenischen Honigpalme. Doch die dichten Wälder sind schon lange verschwunden.
Die Osterinsel fasziniert Archäologen und Archäologinnen seit langem. Ihre Geschichte wirft zahllose Fragen auf. Wie gelangten die ersten Menschen an diesen abgelegenen Ort? Woher kamen sie, und wann? Blieben sie unter sich, bis 1722 die ersten Europäer eintrafen, oder hatten sie Kontakt zu anderen Seefahrern? Welche Wendungen nahm ihr Schicksal, von dem nur mündliche Überlieferungen existieren? Warum hörten sie nach Jahrhunderten auf, riesige Steinhäupter als Abbilder ihrer Ahnen zu schaffen, und wandten sich einer neuen Religion zu? Und was geschah bloß mit den 20 Millionen Palmen, die einst auf der Insel wuchsen?
Die Antworten, die Archäolog*innen im Laufe der Zeit gegeben haben, spiegeln nicht nur den Wissensstand ihrer Zeit wider, sondern auch das Weltbild ihrer Schöpfer. Der Evolutionspsychologe Jared Diamond etwa prägte die berühmte These des "ökologischen Suizids". Sie erzählt davon, wie eine explodierende Bevölkerung die natürlichen Ressourcen der Insel ausbeutete, bis zum unvermeidlichen Kollaps. 1995 schrieb Diamond im Magazin "Discover": "Innerhalb weniger Jahrhunderte holzten die Bewohner der Osterinsel ihre Wälder ab, rotteten ihre Pflanzen und Tiere aus und erlebten, wie ihre komplexe Gesellschaft in Chaos und Kannibalismus versank. Sind wir dabei, ihrem Beispiel zu folgen?"
Ein verlockend eindringliches Narrativ
Das aufrüttelnde Narrativ wurde schnell berühmt. Doch je mehr Erkenntnisse die Forschung zu Tage fördert, desto klarer wird: Es ist kompliziert. Die Geschichte der Osterinsel taugt nicht zur simplen Parabel darüber, wie sich der Mensch durch Raubbau an der Natur ins Verderben stürzt. Auch andere Thesen entpuppten sich als Irrtum – oder als grobe Vereinfachung. Viele Fragen sind nach wie vor offen. Trotz eines wachsenden Arsenals technisch anspruchsvoller Analysemethoden bleibt die Rekonstruktion der Vergangenheit ein Detektivspiel voller fehlender Puzzlestücke und falscher Fährten.
Der wohl berühmteste Archäologe, der sich der Osterinsel widmete, war der Norweger Thor Heyerdahl. 1947 war er mit einem Floß aus Balsaholz namens Kon-Tiki von Peru aus über den Pazifik bis nach Polynesien gesegelt, um zu beweisen, dass Menschen die pazifischen Archipele auf diesem Weg hätten besiedeln können. Er war überzeugt, dass auch die ersten Bewohner Rapa Nuis vom amerikanischen Kontinent kamen. Die moderne Genetik widerlegte diese Theorie: DNA-Analysen zufolge stammt die indigene Bevölkerung von polynesischen Seefahrern ab. Doch Erbgutspuren belegen auch, dass zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert Besuch vom amerikanischen Festland eintraf und auf Rapa Nui Kinder zeugte.
Wann die ersten Menschen auf der Osterinsel eintrafen, musste inzwischen ebenfalls revidiert werden. Die frühesten Belege waren zunächst auf 800 n. Chr. datiert worden. Demnach hätte eine kleine Bevölkerung gut 400 Jahre im Einklang mit der Natur gelebt, bevor die Rodung der Palmwälder begann. Doch es mehren sich die Hinweise darauf, dass die polynesischen Seefahrer frühestens ab dem Jahr 1200 eintrafen – und zügig begannen, die Palmen als Brennmaterial zu fällen, sie als Baustoff für Häuser und Boote zu nutzen und sie niederzubrennen, um Raum für Ackerfläche zu schaffen.
Terry Hunt von der University of Arizona, einer der prominentesten Fachleute für die Osterinsel, betont außerdem, dass die Polynesier nicht allein kamen. Sie hatten pazifische Ratten im Schlepptau, vielleicht als blinde Passagiere, vielleicht als Nahrungsquelle für die lange Fahrt. Eben diese Ratten, glaubt Terry, trieben die Entwaldung der Insel entscheidend voran.
Weil sie keine natürlichen Feinde besaßen, vermehrten sie sich rasend schnell. "Eine ökologische Modellierung zeigt, dass die eingeschleppten Ratten innerhalb von 47 Jahren eine Populationsgröße von 11,2 Millionen Exemplaren erreicht haben könnten", schreiben Hunt und sein Kollege Carl Lipo in einer aktuellen Veröffentlichung im "Journal of Archaeological Science". Als Nahrung dienten ihnen unter anderem die Samen der Honigpalmen, wie zahlreiche Bissspuren an alten Fruchtgehäusen beweisen. Hätten die Heerscharen der Nagetiere 95 Prozent aller Samen angenagt, rechnen die Forscher vor, hätte sich der Palmenbestand nicht von natürlichen Verlusten und menschlichen Eingriffen erholen können. Mit der Zahl der Pflanzen sank schließlich auch die Zahl der Ratten.

Der Beitrag der Nager zur Entwaldung der Insel wird heiß diskutiert. War die eingeschleppte Spezies ein entscheidender Faktor, wie Hunt glaubt? Auf anderen Inseln im Pazifik ist ihr Kriegszug gegen die heimische Flora gut dokumentiert. Oder war der einzig relevante Feind der Palme der Mensch, wie insbesondere Hans-Rudolf Bork und Andreas Mieth von der Universität Kiel argumentieren?
Klar ist nur: Der Verlust der Palmen zog keinen gesellschaftlichen Kollaps nach sich. Ein explosives Bevölkerungswachstum, gefolgt von einem dramatischen Einbruch, gab es auf Rapa Nui nicht. Sowohl genetische Untersuchungen als auch Satellitenbilder historischer Steingärten deuten darauf hin, dass nie mehr als 3000 Menschen auf der Insel lebten – in etwa so viele wie beim Eintreffen der Europäer, die sich als wahrer Fluch von Rapa Nui entpuppten. Sie töteten Indigene bei gewaltsamen Zusammenstößen und trugen tödliche Krankheiten wie die Pocken in die Abgeschiedenheit. Rund ein Drittel der Bevölkerung wurde von peruanischen Sklavenhändlern verschleppt.
Schon davor machten die Rapanui harte Zeiten durch, wie eine aktuelle Veröffentlichung in "Nature Communications Earth and Environment" zeigt. Sie rekonstruierte die Regenfälle der letzten 800 Jahre anhand von Pflanzenrückständen, die Forschende aus Sedimenten in zwei Feuchtgebieten gewannen. Süßwasser ist auf Rapa Nui ein rares Gut: Es sammelt sich nur in drei Vulkankratern auf der Insel. Andernorts versickert es zügig im porösen Gestein. Das Team der Columbia University fand ab Mitte des 16. Jahrhunderts Hinweise auf einen "anhaltenden, mehrere Jahrhunderte andauernden Rückgang der jährlichen Niederschlagsmenge um rund 600 bis 800 Millimeter, der stärker ausfiel als die in den letzten Jahrzehnten beobachtete Austrocknung."

"Der Zeitpunkt unserer vermuteten Dürre fällt mit einigen bedeutenden kulturellen Veränderungen zusammen", erklärt Studienautor Redmond Stein. Die Rapanui bauten weniger zeremonielle Plattformen, "Ahu" genannt, auf denen die Moai ruhten. Der Rano Kao-See stieg zu einem wichtigen rituellen Ort auf. Und eine neue Form der sozialen Hierarchie entstand, in der Macht nicht mehr durch Abstammung gegeben war, sondern durch Wettkämpfe erlangt wurde.
Resilienz statt Selbstzerstörung
Ob und wie gesellschaftliche und klimatische Veränderungen ursächlich zusammenhingen, können die Daten jedoch nicht beantworten. "Für Archäolog*innen ist es schwierig, den genauen Zeitpunkt dieser Ereignisse zu bestimmen, und es gibt immer noch viele Diskussionen darüber, wie sich die Gesellschaft auf Rapa Nui im 16. bis 18. Jahrhundert verändert hat", sagt Redmond Stein. "Aber zumindest wissen wir, dass die menschliche Geografie der Insel ganz anders aussah als in den Jahrhunderten zuvor." Die Forschungsergebnisse zeichnen nicht das Bild einer Gesellschaft, die durch ökologischen Raubbau ihr Ende besiegelte. Im Gegenteil: Auf der Osterinsel lebten offenbar Menschen, die Widrigkeiten zu trotzen vermochten.
"Ich glaube, dass die Welt heute vor einer beispiellosen globalen Umweltkrise steht, und ich sehe den Nutzen historischer Beispiele für die Fallstricke der Umweltzerstörung", schrieb Terry Hunt kürzlich in dem Magazin "Scientific American". "Daher kam ich mit einem gewissen Unbehagen zu dem Schluss, dass Rapa Nui kein solches Modell darstellt. Aber als Wissenschaftler kann ich die Probleme mit der akzeptierten Darstellung der Vorgeschichte der Insel nicht ignorieren. Fehler oder Übertreibungen in Argumenten für den Umweltschutz führen nur zu vereinfachten Antworten und schaden der Sache."
Gehör sollten vor allem die heutigen Bewohner der Pazifikinseln finden, die bereits mit den Auswirkungen der Klimakrise zu kämpfen haben, betont Redmond Stein in einer Veröffentlichung der Columbia University. "Ihre Perspektiven und Erkenntnisse sind für die Bewältigung der heutigen Probleme weitaus relevanter als alles, was wir aus [unserer] Studie gewinnen könnten. Unsere Forschung zielt nicht darauf ab, eine neue Parabel für die moderne Zeit zu schaffen, sondern vielmehr darauf, die alte Parabel zu hinterfragen."