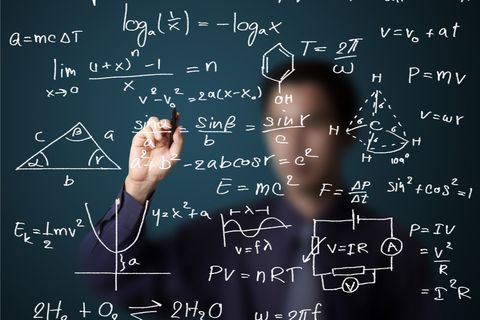Kein anderer Sinn ist so sehr auf unsere Mitwirkung angewiesen wie dieser: Damit der Geschmackssinn aktiv wird, damit sich etwa das Aroma einer Mahlzeit voll entfalten kann, muss abgebissen und gekaut werden, getrunken und geknabbert, gestopft, geschlürft, geschluckt. In aller Regel braucht es unser Zutun, damit Speisen und Getränke in unsere Mundhöhle gelangen – jenen Ort, an dem der Geschmackssinn tätig wird.
Was dort geschieht, ist ein überaus essenzieller Vorgang: Haben es Lebensmittel bis hierher geschafft, verleiben wir sie uns meist kurz darauf ein – wir lassen also zu, dass etwas Fremdes in uns hineingelangt. Der Geschmack ist der letzte bewusste Kontrollposten vor dem Körperinneren, der letzte Sensor, der meldet: "schmackhaft" oder "ungenießbar". Ihm vertrauen wir, dass er lebenswichtige Nährstoffe von Verdorbenem unterscheidet, Essbares von Giftigem. Ihm vertrauen wir, dass er uns veranlasst, Schädliches augenblicklich wieder auszuspucken.
So überlebenswichtig der Geschmack aber ist, so viele Missverständnisse sind mit diesem Sinn verbunden. Allem voran die Annahme, wir würden sämtliche Nuancen feiner Speisen über die Zunge erspüren. Denn was Menschen gewöhnlich unter "schmecken" verstehen, hat nur zu einem kleinen Teil mit der Sinneswahrnehmung der Zunge zu tun.
Es ist vielmehr eine komplexe Komposition, an der unter anderem die Nase beteiligt ist, an der aber auch Augen, Ohren und Lippen mitwirken.

Die Zunge allein kann keinen Fruchtsaft von einer Limonade unterscheiden, keine Birne von einem Apfel. Sie teilt die Nahrung vielmehr nur grob in Grundkategorien ein, etwa süß oder sauer, bitter oder salzig. Diese Zuordnung übernehmen Tausende Geschmacksknospen – mikroskopisch kleine Trichter, die sich in den zahlreichen Furchen der Zunge verbergen.
Werden Nahrungsbestandteile, etwa Zuckermoleküle, Mineralstoffe oder Eiweiße, mit dem Speichel in diese winzigen Trichter gespült, können sie dort an spezielle Zellen andocken: an Rezeptoren, die jeweils bestimmte Geschmackskategorien identifizieren und diese Grundinformationen über Nervenbahnen in Sekundenbruchteilen zum Gehirn weiterleiten.
Die Rezeptoren für die verschiedenen Geschmäcker sind auf der Zungenoberfläche im Großen und Ganzen gleichmäßig verteilt. Die noch immer in vielen Lehrbüchern abgedruckte Abbildung der Zunge, auf der unterschiedliche Zonen für süß, sauer, bitter und salzig verzeichnet sind, ist eindeutig widerlegt worden.
Memo: Schmecken
- Fünf Geschmacksrichtungen kann unsere Zunge unterscheiden: süß, sauer, salzig, bitter und umami (herzhaft, würzig).
- Dies hilft uns, nahrhafte Kohlenhydrate, Eiweiße, Mineralstoffe sowie Verdorbenes zu erkennen.
- Weitaus mehr Nuancen, komplexe Aromen also, nehmen wir mit der Nase wahr.
- Zum vollen Geschmackserlebnis tragen auch Farbe und Konsistenz einer Speise bei – mitunter gar der Klang beim Kauen.
Vor etwa zehn Jahren konnten Wissenschaftler zudem belegen, dass es neben den vier klassischen Geschmacksrichtungen noch eine weitere gibt: umami, benannt nach dem japanischen Wort für "köstlich". Dieser Geschmack, den man am ehesten als herzhaft oder würzig umschreiben kann, wird aktiviert, wenn sich im Mund die Aminosäure Glutamat befindet, die zum Beispiel in Tomaten, Fleisch oder Käse vorkommt.
Ob es noch weitere Kategorien gibt, die entsprechende Rezeptoren erspüren können, wird derzeit erforscht: Möglicherweise erkennt die Zunge auch Eigenschaften wie "fettig" und "metallisch".
Sinnesforscher vermuten, dass wir diese Grundkategorien erschmecken können, weil der Körper auf diese Weise sehr rasch den Nährgehalt von Lebensmitteln erkennen und notfalls Gefahren abwehren kann. So signalisiert die Süße eines Stoffes, dass wir offenbar etwas Nahrhaftes im Mund haben; meist sind dies kalorienreiche Kohlenhydrate (Zucker) – also Substanzen, die dem Körper Energie zuführen. Schon Babys haben eine Vorliebe für Süßes: Die Muttermilch schmeckt zuckrig.
Demgegenüber deutet die Geschmacksempfindung "sauer" auf Stoffe hin, die wir eher mit Vorsicht, eher in Maßen genießen sollten, etwa unreife Früchte oder verdorbene Speisen.
Eine ähnliche Funktion hat der Salzgeschmack: Darüber identifizieren wir Minerale, die zwar in geringen Mengen für unseren Stoffwechsel unverzichtbar sind, aber dem Körper schaden, wenn sie im Übermaß verzehrt werden. Umami wiederum signalisiert: Die Speise enthält Glutamat, es handelt sich also mit hoher Wahrscheinlichkeit um eiweißreiche, nahrhafte Kost.
Bitterstoffe spielen eine besondere Rolle
Eine besondere Stellung unter den Grundkategorien des Geschmacks nehmen die Bitterstoffe ein. Auf sie reagieren Menschen sehr ausgeprägt. Während wir nur eine überschaubare Anzahl chemischer Stoffe als süß zuordnen können, vermag die Zunge mit etwa 25 verschiedenen Rezeptoren Tausende Stoffe als bitter zu erschmecken.
Weshalb wir gerade bei bitteren Substanzen so sensibel sind, erklären Wissenschaftler damit, dass viele Bitterstoffe toxisch sind. Die entsprechenden Rezeptoren warnen uns also vor Giften – etwa Strychnin oder Bittermandel.
Dass wir dennoch manchmal gern zu bitteren Speisen greifen, hat vermutlich damit zu tun, dass etliche dieser Stoffe (zumindest in geringer Dosierung) auch gesundheitsfördernde Wirkung haben, etwa die Verdauung unterstützen. Damit ließe sich möglicherweise auch erklären, weshalb mit zunehmendem Alter unsere Abneigung gegen bittere Nahrung mehr und mehr sinkt.
In einem ersten Schritt entscheidet also der Geschmackssinn der Zunge darüber, ob wir einen Stoff als gefährlich oder nahrhaft wahrnehmen. Damit sich aber in unserem Kopf das Gesamterlebnis abspielt, das wir etwa beim Genuss eines Menüs in einem Restaurant erfahren, müssen wir all unsere Sinnesorgane einsetzen.
Denn ob uns ein Essen schmeckt oder nicht – ob es uns vielleicht sogar höchst vorzüglich mundet –, entscheiden wir nicht zuletzt mithilfe des Geruchs-, Hör- und Sehsinns.
So erfahren wir vor allem über die Nase, ob wir zum Beispiel gerade an einem weihnachtlich gewürzten Spekulatius oder einem gewöhnlichen Butterkeks knabbern, ob die Bratkartoffeln eher ein wenig ölig oder speckig zubereitet sind.
Dabei erschnüffelt die Nase die komplexen Aromen der Speisen weniger über den Geruch, der von unserem Teller oder der Gabel aufsteigt (also über Duftstoffe aus der Außenwelt), sondern registriert vielmehr zahlreiche flüchtige Substanzen, die aus der Mundhöhle durch den Rachentrakt – also gleichsam von hinten – in die Nase gelangen. Wissenschaftler sprechen vom "retronasalen Riechen".
Wer schon mal mit verschnupfter Nase ein delikat zubereitetes Mahl genießen wollte, weiß: Ohne funktionierendes Riechorgan schmeckt fast alles gleich, ein raffinierter Wein mundet allenfalls leicht süßlich oder säuerlich, ein saftiges Steak wirkt fad, vielleicht ein wenig salzig. Dem Essen fehlt es an Aroma.
Ob wir ein kunstvoll komponiertes Gericht in all seinen Facetten genießen können, hängt jedoch auch von unserer Tagesform ab – genauer: von der Menge an Serotonin in unserem Gehirn. Je höher der Gehalt dieses "Glückshormons" (dessen Konzentration etwa bei depressiven Menschen vermindert ist), umso intensiver nehmen wir süße oder bittere Bestandteile des Essens wahr. Sind wir gut gelaunt, können wir im Allgemeinen besser schmecken.
Das Auge isst mit
Eine häufig unterschätzte Rolle beim Geschmack spielt auch, wie die Mahlzeit aussieht, und zwar jenseits der – naheliegenden – Frage, wie appetitlich oder lieblos Speisen auf einem Teller angerichtet werden.
So scheint unter anderem die Farbe eines Lebensmittels einen wichtigen Einfluss auf unser Geschmacksempfinden zu haben: In einer Studie sollten Probanden ein Getränk kosten und erkennen, welchen Geschmacksstoff die Wissenschaftler ihm zugesetzt hatten. War die Probe mit Himbeeraroma rot gefärbt, lagen rund 90 Prozent der Teilnehmer mit ihrer Antwort richtig. Hatte die völlig identisch schmeckende Probe jedoch eine grüne oder gar keine Farbe, sank der Anteil der richtigen Antworten auf etwa 50 Prozent – und das, obwohl die Probanden wussten, dass Farbe und Geschmack unabhängig voneinander künstlich erzeugt worden waren.

Eine andere Studie kam zu dem Ergebnis, dass nicht einmal die Farbe des Getränks selbst verändert werden muss. Testpersonen verkosteten den exakt gleichen Wein bei unterschiedlich farbiger Beleuchtung – dabei stellte sich heraus, dass sie ihn bei rotem Licht bedeutend süßer fanden als bei weißem und bereit waren, mehr dafür zu bezahlen.
Und selbst Sommeliers, Menschen also, deren Beruf es ist, feinste Nuancen eines Weines zu erkennen und zu bewerten, kommen in Schwierigkeiten, wenn ihnen die optischen Informationen fehlen. Bei einem Blindtest verwechseln sie mitunter sogar Rot- und Weißweine.
Gutes Essen muss sich auch gut anhören
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Konsistenz der Nahrung, die wir über den Tastsinn wahrnehmen. Nicht zufällig gehören Zunge und Lippen (neben den Fingerkuppen) zu den berührungsempfindlichsten Zonen des Körpers. Pudding schmeckt uns, wenn er leicht fest, aber nicht klumpig ist; ein Steak, wenn es bissfest ist, aber nicht zäh; Espresso muss leicht sämig sein.
Und: Gutes Essen muss sich auch gut anhören. In zahlreichen Labors arbeiten Fooddesigner an den Geräuschen von Lebensmitteln. Sie perfektionieren etwa das sonore Knacken von Schokoladentafeln oder das zart raschelnde Knuspern von Paprikachips. Je verheißungsvoller es tönt, desto eher glauben wir, einen leckeren Snack vor uns zu haben.
Erstaunlich ist, dass viele Menschen auch eine gewisse Schärfe als wohlschmeckend empfinden. Denn eigentlich reagiert der Körper auf scharfe Speisen zunächst mit nichts anderem als Schmerz.
So sind es nicht etwa Geschmackszellen, die auf den in Chili enthaltenen Stoff Capsaicin reagieren, sondern Sensoren des Trigeminus-Nerves. Dieser Nerv meldet Schmerzen in Gesicht und Mundhöhle an unser Gehirn. Seine Ausläufer sind im gesamten Mundraum verteilt, auf der Zunge, in den Schleimhäuten, in den Zähnen. Reizen Stoffe wie Capsaicin jene Nervenenden, führt dies zu einer ganz bestimmten Schmerzwahrnehmung, die wir als Schärfe empfinden.
Wird der Reiz zu stark, sorgt dies dafür, dass wir mehr und mehr Speichel produzieren, uns mitunter Tränen in die Augen schießen. Eine Abwehrreaktion: Der scharfe Stoff soll möglichst schnell wieder aus dem Körper gespült werden.

Dass wir dennoch mit Absicht Chilischoten, Tabasco-Soße oder Cayennepfeffer in unser Essen geben, liegt daran, dass wir damit erfolgreich unseren Körper täuschen. Wir bringen ihn dazu, ein Schutzprogramm zu starten: Wird der Schmerzreiz ausgelöst, hilft sich der Organismus, indem er Endorphine ausschüttet. Das sind Glückshormone, die nicht nur den Schmerz erträglicher machen – sondern auch die Laune heben. Und nicht nur das: Manche der in Chili enthaltenen Stoffe können, wie Forscher herausgefunden haben, schädliche Bakterien abtöten.
Die wohl größte Täuschung beim Schmecken aber erlebt, wer von der afrikanischen Wunderbeere kostet. Die hagebuttengroße Frucht ist völlig unscheinbar, sie hat keinen eigenen Geschmack, sie ist weder giftig noch berauschend, noch besitzt sie irgendeinen nennenswerten Nährwert.
Die Beere hat nur eine einzige bekannte Wirkung, die allerdings Wissenschaftler seit Jahren beschäftigt und für die noch niemand eine eindeutige Erklärung gefunden hat: Bereits kurz nach dem Genuss der rötlichen Frucht verändert sich das Geschmackserleben radikal – plötzlich schmeckt alles Saure zuckrig-süß.
Etwa eine Stunde hält die Wirkung an, in dieser Zeit lässt sich Essig gläserweise trinken, und Zitronen munden wie süße Orangen. Danach gelten freilich wieder die vertrauten Geschmacksempfindungen – und man sollte die Essigflasche wieder wegstellen.