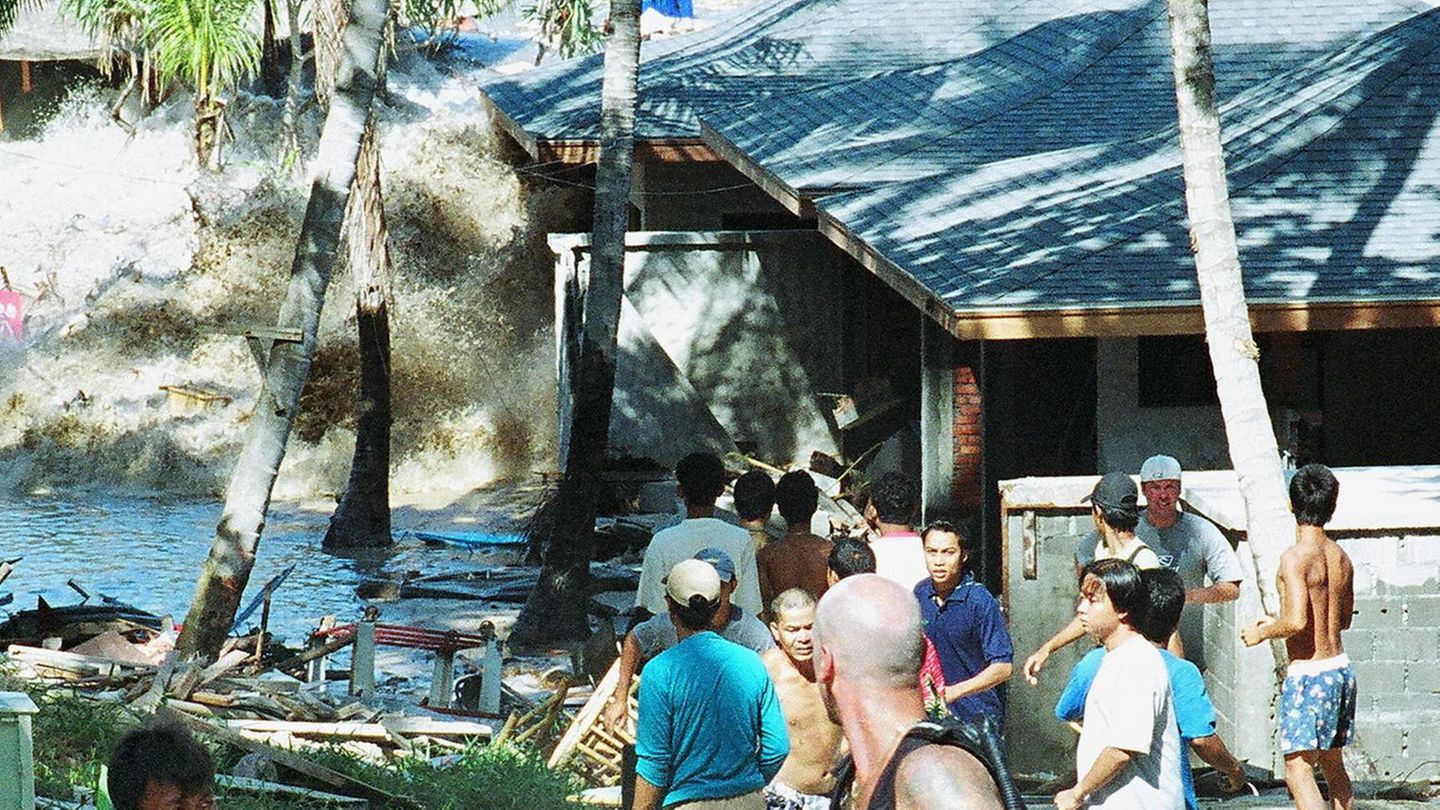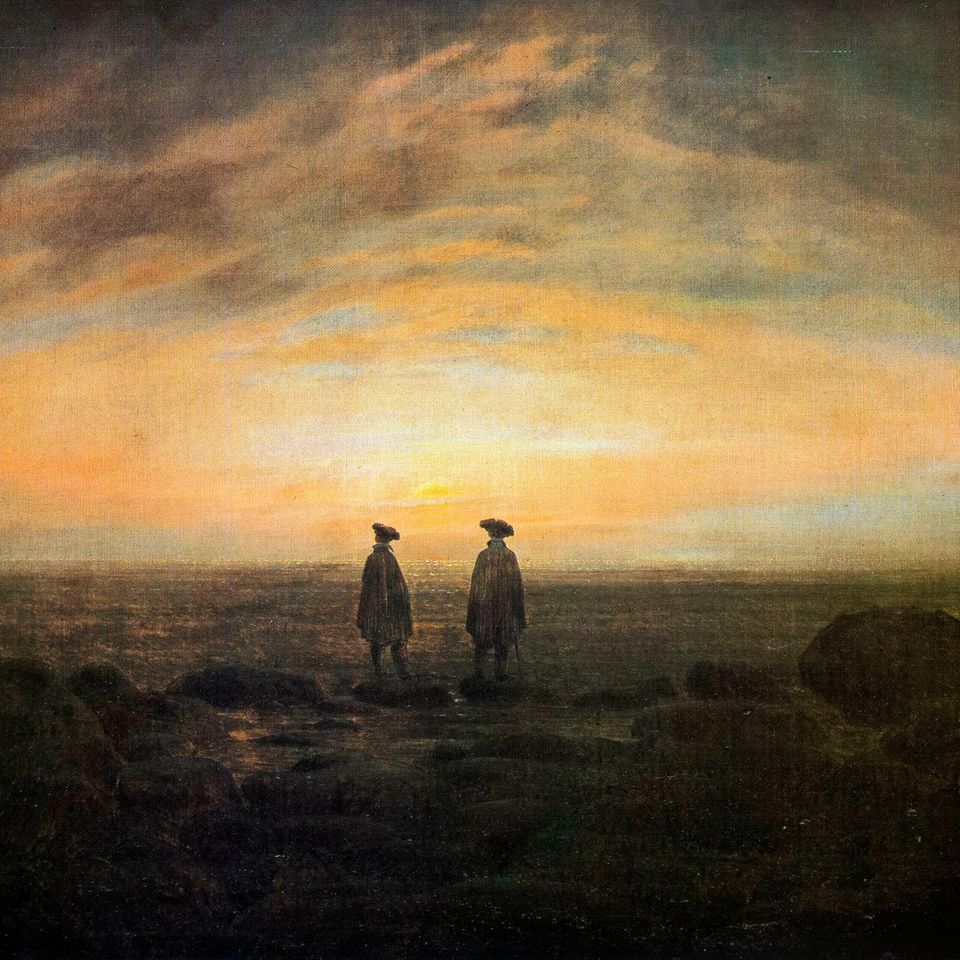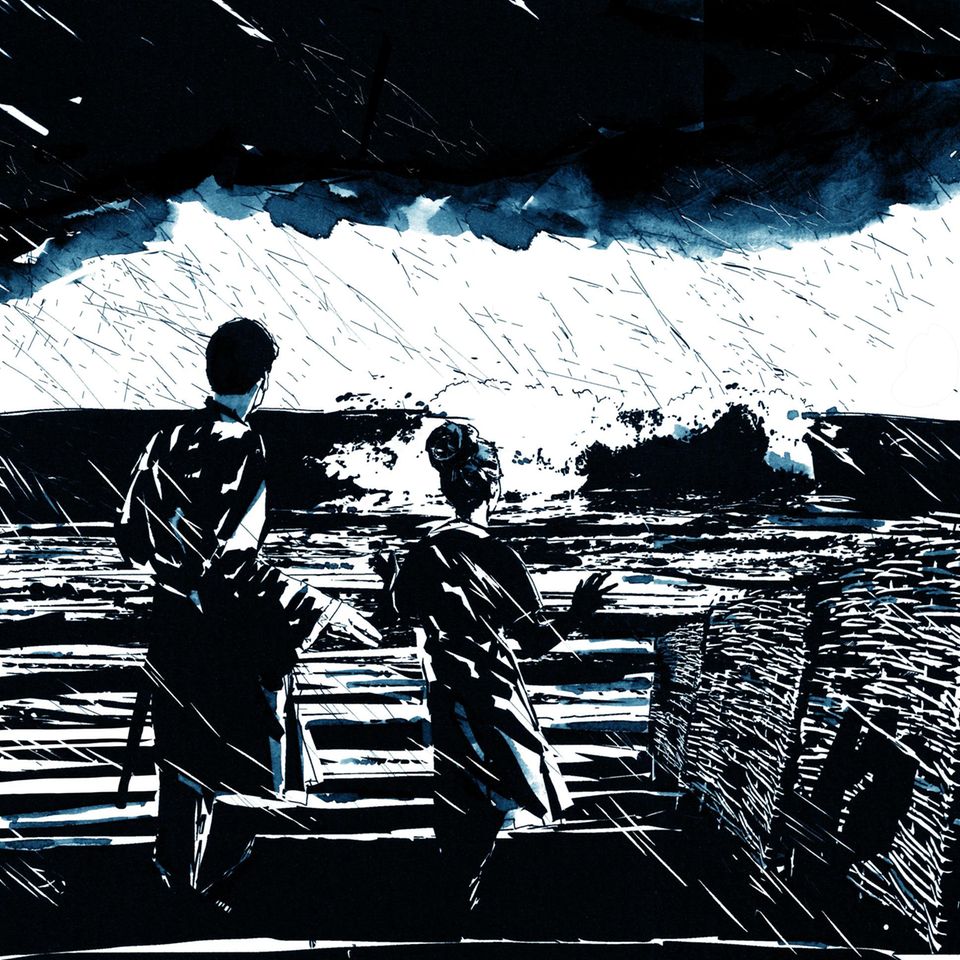Als sich der Seeboden vor der Insel Sumatra am Morgen des zweiten Weihnachtstages 2004 in einem Beben verwirft, entsteht ein Tsunami, der sich schon bald vor den Küsten des Indischen Ozeans zu einer bis zu 20 Meter hohen Wasserwand aufsteilt.
Insgesamt dauert es acht Stunden, bis die Riesenwelle ihre letzten Opfer in den Tod gerissen hat - acht Stunden, in denen Hunderttausende Menschen an den Küsten Asiens und Afrikas um ihr Leben kämpfen. Und in denen Tausende Kilometer entfernt verzweifelte Wissenschaftler den Wettlauf mit der Woge aufnehmen, um noch zu retten, was zu retten ist.
Acht Stunden eines Dramas, das sich zu einer der größten Naturkatastrophen unserer Zeit ausweitet.
Plötzlich wird es still
Vielleicht hat Thomas Elmerhaus der Stille sein Leben zu verdanken. Jener Ruhe, die so ungewöhnlich ist für einen belebten Strand im Südwesten Sri Lankas. Der Ruhe vor der Welle.
Thomas Elmerhaus ist 33, seit drei Jahren mit einer Autowerkstatt selbstständig und das erste Mal in den Tropen. Seine Frau Anna hat ihn mitgenommen auf diese Insel im Indischen Ozean: ins Barberyn-Reef-Hotel in Beruwala, das auf Ayurveda-Kuren spezialisiert ist.
Die beiden Hamburger sollen an diesem Morgen um 9.45 Uhr massiert werden. Während seine Frau sich noch umzieht - ihr Bungalow liegt in der ersten Reihe unter Palmen, kaum zehn Meter entfernt vom Meer -, schlendert Elmerhaus an den Strand, um noch ein paar Minuten in einem Buch zu lesen.
Es ist ungefähr 9.30 Uhr am 26. Dezember 2004.

Ein Riff schützt den kleinen, geschwungenen Strand; weiter draußen liegt eine Insel mit einem kleinen Tempel, in dem jeden Morgen zwei buddhistische Mönche meditieren. Thomas Elmerhaus liest - im Ohr die Geräusche von Meer und Menschen: wie ein fernes, eher beruhigendes Rauschen. Plötzlich aber ist es still.
Erstaunt lässt Elmerhaus das Buch sinken: Die Bewegungen der Menschen am Strand sind eingefroren. Alle starren stumm auf das Meer. Er folgt ihren Blicken. Und dann sieht er das Wasser.
"Tsunami" heißt übersetzt "Hafenwellen"
Wohl kein anderes Naturphänomen hat einen derart verharmlosenden Namen erhalten wie die zerstörerischste Meereswelle des Planeten. Er stammt aus dem Japanischen: tsu heißt "Hafen", nami "Welle". Doch die damit beschriebenen "Hafenwellen" gab es auf der Erde schon, lange bevor es Häfen gab. Bereits in urgeschichtlicher Zeit, das zeigen Spuren in Sedimenten oder Korallenblöcken, haben gewaltige "Fluten" (ein irreführender Begriff, denn diese Wellen haben nichts mit den Gezeiten zu tun) Küsten heimgesucht.
Seit Menschen am Wasser wohnen, leben sie in der Furcht, dass es außer Kontrolle geraten könnte. In der Bibel, im sumerischen Gilgamesch-Epos, in den Mythen vieler Völker wird von verheerenden Sintfluten berichtet.
"Und das Gewässer nahm überhand und wuchs so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden", heißt es im Alten Testament. "15 Ellen hoch ging das Gewässer über die Berge, die bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das auf Erden kriecht, an Vögeln, an Vieh, an Tieren und an allem, was sich regt auf Erden, und alle Menschen. Alles, was einen lebendigen Odem hatte auf dem Trockenen, das starb."
So ist die Welle, die zu Weihnachten 2004 im Indischen Ozean losbricht, nur das vorläufig letzte Ereignis eines seit Millennien immer wieder vorkommenden Naturphänomens. Doch nie zuvor hat ein Tsunami so viele Menschen um ihr Leben, um ihre Familien, um ihren Besitz gebracht wie dieser.
Eine Naturkatastrophe wird zur Apokalypse
Er trifft Menschen, die noch nie ihr Heimatdorf verlassen haben, ebenso wie jene, die um den halben Globus in den Urlaub geflogen sind. Er erschütterte ein wenige Köpfe zählendes Steinzeitvolk ebenso wie eine Atommacht mit einer Milliarde Bürgern.
In jenen acht Stunden am 26. Dezember 2004 entfaltet sich über Tausende Quadratkilometer eine Geschichte von Leid und unwahrscheinlichem Glück, von Heroismus und Egoismus, von rettender Vorsorge und tödlichem Leichtsinn.
Es ist zwar eine von der Natur ausgelöste Katastrophe - doch zur Apokalypse biblischen Ausmaßes gerät sie erst durch das Versagen, den Hochmut, die Sorglosigkeit, aber auch die schiere materielle Not unzähliger Menschen.
In jenen acht Stunden werden mehr als 300 000 Kinder, Frauen und Männer getötet und ganze Inseln verschoben. Und es wird vielleicht die Weltgeschichte um eine Winzigkeit neu ausgerichtet.
Tektonische Spannungen entladen sich
Sunda-Graben, 3,316° Nord, 95,854° Ost, 7.58.53 Uhr Ortszeit: Jahrzehntelang haben sich in der Erdkruste tief unter dem Indischen Ozean vor der Westküste Sumatras ungeheure tektonische Spannungen aufgebaut, die sich nun - um 1.58.53 Uhr mitteleuropäischer Zeit - in einem der gewaltigsten Erdbeben aller Zeiten entladen.
Der Sunda-Graben ist Teil eines mehrere tausend Kilometer langen Risses in der Erdplatte, der sich von Burma im Norden bis zu den Kleinen Sunda-Inseln im Süden erstreckt. Der bis zu 7500 Meter unter den Meeresspiegel reichende Tiefseegraben ist entstanden, weil sich hier die indische und die australische Erdkrustenplatte langsam unter die der Eurasischen Platte vorgelagerten Birma- Mikroplatte drücken.
Zugleich verschieben sich beide Platten entlang einer Nordwest-Südost- Achse um rund sechs Zentimeter pro Jahr (etwa halb so viel, wie ein Fingernagel in der gleichen Zeit wächst). Da sich die beiden Platten ständig irgendwo verhaken, bauen sich durch die in Höhe und Seiten versetzenden Bewegungen große Spannungen auf - bis sich die Verhakungen lösen und die beiden Platten ruckartig bewegen: So entsteht ein Erdbeben.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag schließlich entladen sich binnen 400 Sekunden die aufgestauten Energien.
Das Zentrum des Bebens liegt zehn Kilometer tief
Rund zehn Kilometer tief im Erdinneren, nördlich der Insel Simeulue, liegt das Hypozentrum des Bebens. Es hat, werden japanische Seismologen später berechnen, zwei Phasen: Zunächst wird der Boden rund 100 Sekunden lang in einem bis zu gut 100 Kilometer breiten und rund 300 Kilometer langen Streifen erschüttert, der sich vom Epizentrum Richtung Nordwesten erstreckt.
Dann folgt Phase 2: Etwa 300 Sekunden lang bebt nun die Erde von einem Punkt 400 bis 500 Kilometer nordwestlich des Epizentrums bis zu 1200 Kilometer nordwestlich davon. Vor allem in dieser zweiten Phase zeichnen die Instrumente ultralange seismische Wellen auf - Indikatoren dafür, dass nun langsame, große Bodenbewegungen stattfinden.
Das Beben hat die Stärke 9,0 auf der Richter-Skala und ist damit das viertstärkste jemals gemessene und das stärkste der letzten 40 Jahre. Die dabei in wenigen Sekunden freigesetzte Energie entspricht der Sprengkraft von mehr als 32 000 Hiroshima-Bomben.
Inseln werden meterweit verschoben
Ein Teil dieser ungeheuren Energiemenge verformt den Boden: Manche Inseln vor der Westküste Sumatras werden binnen weniger Sekunden um mehrere Meter in Richtung Südwesten verschoben. Der Meeresgrund hebt oder senkt sich an einigen Stellen im gleichen Zeitraum um fünf Meter. Noch im über 10 000 Kilometer entfernten Deutschland bewegt sich der Boden: allerdings so langsam, dass Menschen dies nicht spüren.
Ein weiterer Teil dieser Energien wird jedoch ans Wasser abgegeben. Das schlagartige Heben und Senken des Meeresbodens löst Wellen aus, die gefährlicher sind als alles, was Orkane oder Gezeiten je erzeugen könnten: Tsunamis.
Vom Beben im Sunda-Graben gehen vier Wellen aus, die im Abstand von zunächst wenigen Minuten durch das Meer rauschen. (An den Küsten werden später vor allem die ersten beiden Verwüstungen anrichten.) Die Wogen gleichen nicht den konzentrischen Kreisen, die entstehen, wenn man einen Stein in einen ruhigen Tümpel wirft, sondern eher Wasserwänden, die sich nach Westen und Osten wälzen. Dagegen bewegen sich nördlich der lang gestreckten Bebenzone - also in Richtung Bangladesch - und südlich davon, Richtung Australien, nur kleine Wellen fort.
Tsunamis können lange unsichtbar sein
Auf hoher See sind die Tsunamis fast unsichtbar: Denn in tiefen Gewässern sind sie höchstens einen Meter hoch und können eine Länge von weit über 500 Kilometern erreichen. Eine Schiffsbesatzung, selbst ein Schwimmer oder Taucher, bemerkt dort nichts von ihr. Doch je flacher das Gelände, desto höher die Welle.
Am Ufer können Tsunamis von 20, 30 Meter Höhe über die Küste spülen, in Alaska soll 1958 gar eine 500 Meter hohe Welle aufs Land gebrandet sein. (Daher auch ihr japanischer Name: Fischer, die auf hoher See nichts bemerkt hatten, fanden bei der Rückkehr ihren Heimathafen von einer unerklärlichen Gewalt verwüstet vor - einer "Hafenwelle".)
Tsunamis mögen auf hoher See unsichtbar sein - unbemerkbar sind sie jedoch nicht. Im tiefen Wasser rasen sie fast so schnell dahin wie Verkehrsflugzeuge: bei fünf Kilometer Wassertiefe etwa mit 800 km/h.
Die seismischen Wellen aber, die von dem voraufgegangenen Beben durch den Erdboden gejagt werden, sind noch zehn- oder zwanzigmal schneller. Mit bis zu 25 000 km/h eilen diese Erschütterungen um den Planeten. Ein Erdbeben ist also, je nach Entfernung eines Beobachters vom Epizentrum, Minuten, oft gar Stunden vor einem Tsunami messbar. Es ist das deutlichste Warnzeichen, das einer Monsterwelle vorausgeht. Man muss es nur zu lesen verstehen.
Acht Minuten nach dem Beben
Pacific Tsunami Warning Center, Ewa Beach, Hawaii, 15.07 Uhr Ortszeit, acht Minuten nach dem Erdbeben: Die ruhige Weihnachtszeit endet für Stuart Weinstein mit einer blauen Messlinie auf Papier und ein paar Computeranzeigen.
Der 43-jährige Seismologe ist in diesem Moment der einzige Wissenschaftler im PTWC. Das flache, mit sandfarbenem Stein verkleidete Gebäude ist das Zentrum eines ozeanumspannenden Warnsystems. Die US-Regierung hat es 1949 eingerichtet, nachdem ein Tsunami Hawaiis Küste getroffen hatte.
Seit 1965 koordiniert das PTWC nicht nur die US-amerikanischen, sondern auch die Warnsysteme vieler Anrainerstaaten des Pazifiks. Insgesamt 26 Nationen an den Küsten des Stillen Ozeans sind auf diese Weise miteinander vernetzt - von Großmächten wie den USA und Russland bis zu Zwergstaaten wie Fidschi und Samoa. "Stiller Ozean" - für Tsunami-Forscher klingt dies wie Hohn. 80 bis 90 Prozent dieser Monsterwellen sind bisher hier registriert worden. Immer wieder werden die Küstenregionen heimgesucht, in Alaska und auf Hawaii ebenso wie in Japan.
Im PTWC laufen die Messwerte von Seismographen aus der ganzen Welt zusammen, sodass hier binnen Minuten jedes Erdbeben auf dem Globus registriert wird. Über die Weiten des Pazifiks sind insgesamt mehr als 100 Messbojen verteilt, die Wellenhöhen und andere Daten nach Hawaii senden.
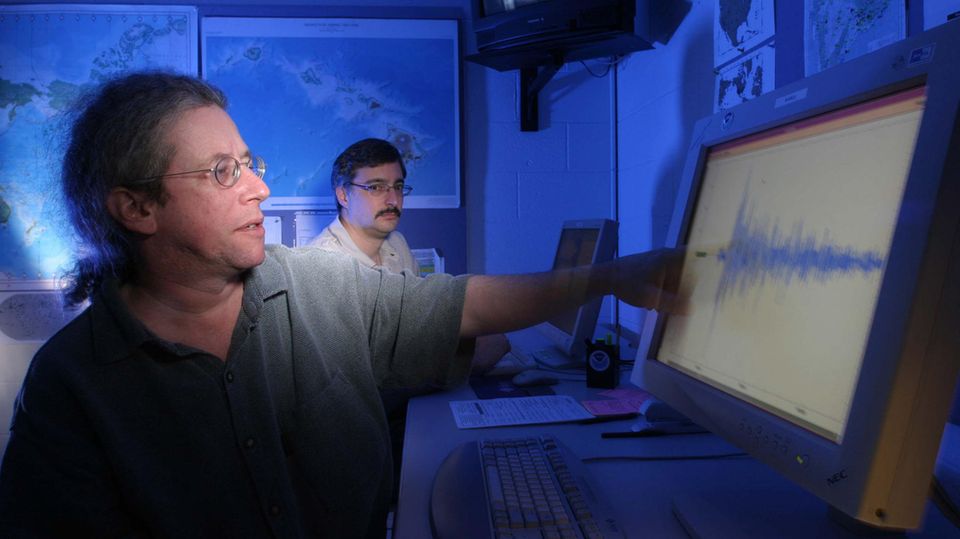
Zu dem Warnsystem gehören auch sechs jeweils 250 000 Dollar teure "Tsunameter": auf dem Tiefseemeeresgrund angebrachte Sensoren, die bereits auf hoher See Tsunamis erkennen können und diese Messwerte an eine Boje und von dort wiederum via Satellit nach Hawaii übermitteln.
Die meisten Erdbeben sind so schwach oder finden so tief im Erdinneren statt, dass sie keinen Tsunami auslösen. Deshalb werden im PTWC alle Messwerte analysiert und Computersimulationen erstellt, welche die Stärke des Bebens, Erdbewegungen und die Beschaffenheit des Meeresgrundes berücksichtigen.
Man kann Tsunamis nicht vorhersagen
Nur dann, wenn den Wissenschaftlern auf Hawaii ein Tsunami wahrscheinlich erscheint, lösen sie via Internet, Telefon, Fax und Telex Alarm in den Anrainerstaaten aus. Dort wiederum werden - etwa durch Radiodurchsagen oder Sirenen am Strand - die Menschen vor den herannahenden Wellen gewarnt.
Da man Tsunamis weder verhindern noch vorhersagen kann, ist das Ziel des PTWC, nach der Auslösung einer Riesenwelle möglichst schnell Alarm zu geben, sodass sich Menschen an allen Ufern des Stillen Ozeans in Sicherheit bringen können. Es ist ein Schadensbegrenzungssystem, das sich seit vier Jahrzehnten bewährt hat.
An diesem Weihnachtssonntag nutzt Weinstein, einer von fünf Wissenschaftlern am PTWC, den verregneten Nachmittag, um ungestört an einem Forschungsprojekt zu arbeiten. Um 15.07 Uhr jedoch melden sich mehrere Messstationen. "Ein schweres Erdbeben, mindestens Stärke 7", vermutet Weinstein, als er die Daten analysiert.
Sein Kollege Andrew Hirshorn hat an diesem Tag frei, doch wird er nun bei sich daheim durch die Messinstrumente automatisch alarmiert. Der 48 Jahre alte Tsunami-Forscher hat zwei Beeper in der Tasche, falls einer versagen sollte. Beide Beeper geben Alarm - und zeigen an, dass zwei weit entfernte Messstationen Daten aufgefangen haben. Hirshorn wohnt nur ein paar hundert Meter vom PTWC entfernt, wirft sich ein Hemd über und fährt mit dem Fahrrad dorthin.
Die beiden Wissenschaftler überschlagen die Daten und geben binnen Minuten ihre erste Einschätzung ab: Stärke 8,0. Das ist stark genug, um einen lokalen Tsunami auszulösen - eine Welle, die an einer nahe gelegenen Küste Schäden verursachen kann, nicht aber an den Gestaden eines ganzen Ozeans. Das PTWC würde in so einem Fall sofort eine Warnung aussenden - wenn das Beben den Pazifik erschüttert hätte.
Wissenschaftler fordern ein Tsunami-Warnsystem für den Indischen Ozean
Doch das Epizentrum liegt im Indischen Ozean. Dort gibt es kein Warnsystem, ja nicht einmal gesichertes Wissen darüber, wie sich Tsunamis in diesem Meer ausbreiten.
Dabei hat es nicht an Warnungen gemangelt. Zwar sind Tsunamis im Indischen Ozean weitaus seltener als im Pazifik - doch "selten" bedeutet nicht "nie". 1883 explodierte in Indonesien der Vulkan Krakatau in der Sunda-Straße und löste einen Tsunami aus, der fast 36 000 Menschen tötete. 1945 traf eine Welle Mumbai (Bombay) und verschlang Hunderte.
Ozeanforscher fordern deshalb schon lange, dass auch für den Indischen Ozean ein Warnsystem eingerichtet werden müsse. Nur zwei Tsunameter wären dazu notwendig, daneben einige Bojen an der Meeresoberfläche und ein international vernetztes Kommunikationsund Alarmsystem, um die Bevölkerung zu warnen. 20 Millionen Dollar würde dies kosten, schätzen die Forscher.
Noch im Juni 2004 hat ein Experte auf einem Treffen der Intergovernmental Oceanographic Commission der Unesco vor "einer signifikanten Bedrohung durch lokale und entfernt verursachte Tsunamis" im Indischen Ozean gewarnt. Doch er wurde abgekanzelt: "Tsunamis sind ein Pazifik-Problem." Bis zum 26. Dezember 2004.
Eine Computerpanne in Neu-Delhi
Die Forscher auf Hawaii sind nicht die Einzigen, die das Beben registrieren. Nur Sekunden nach dem Ereignis melden Messstationen dem Institut für Geophysik in Jakarta das Ereignis. Wohl nirgendwo sind Experten zum Zeitpunkt des Erdbebens näher am Ort der Erschütterung als die Forscher in der indonesischen Hauptstadt - doch genau dies ist ihre Tragödie.
Denn das Beben ist so gewaltig, dass die nahe dem Epizentrum installierten Messinstrumente die Werte nicht mehr korrekt aufzeichnen: Sie melden "nur" Stärke 6,4 auf der Richter-Skala - nichts Ungewöhnliches in einer erdbebenreichen Region wie Indonesien. Und zu wenig, um einen Tsunami auszulösen.
Der für die Datensammlung verantwortliche Abteilungsleiter Prih Harjadi ist jedoch so beunruhigt, dass er sich von daheim auf den Weg ins Büro macht: Ein Neffe hat ihn aus der Stadt Medan auf Sumatra angerufen. Dort sei das Beben deutlich zu spüren gewesen.
Auch dem Meteorologischen Büro Indiens in Neu-Delhi liegen nach wenigen Minuten die ersten Daten vor - doch können sie dort wegen einer Computerpanne nicht analysiert werden.
In Wien laufen Erdbebendaten ein
Die einzige Institution, die über ein den gesamten Indischen Ozean umfassendes und fehlerfrei funktionierendes Messsystem verfügt, ist die Test Ban Treaty Organization, eine internationale Vereinigung mit Sitz in Wien, die weltweit heimliche Atombombentests aufspüren soll.
Zu diesem Zweck laufen in der Zentrale die Messwerte von rund 175 über den Globus verteilten Sensoren ein, welche die typischen Wellen einer Kernexplosion, aber auch von Erdbeben registrieren können. Acht Stationen der Organisation liegen im Indischen Ozean, in Indonesien, Thailand und Sri Lanka.
Außerdem verfügt die Wiener Organisation im Pazifik über drei hydroakustische Sensoren (einen nahe der Insel Diego Garcia, einen bei Cape Leeuwin in Australien und einen bei den Crozet-Inseln), die registrieren, wenn unter Wasser gewaltige Energien freigesetzt werden.
Dies ist kein funktionstüchtiges Tsunami-Warnsystem - allein schon, weil die Messinstrumente nicht darauf ausgelegt sind, die Entstehung und die Richtung möglicher Monsterwellen aufzuzeichnen. Aber es ist das umfassendste Sensorium, mit dem der Indische Ozean kontrolliert wird.
Doch über die Weihnachtsferien ist von den rund 100 Mitarbeitern in Wien niemand anwesend. Die Erdbebenwerte werden zwar aufgezeichnet, aber in der menschenleeren Zentrale ist keiner da, der sie wahrnimmt. So sind, von allen Spezialisten auf der Welt, Stuart Weinstein und Andrew Hirshorn die Einzigen, die in diesem Moment zumindest schon ahnen, dass sich im Indischen Ozean etwas ganz und gar Außergewöhnliches ereignet hat.
Um 15.10 Ortszeit, nur drei Minuten nach dem ersten Alarm, schickt das PTWC eine Benachrichtigung an andere pazifische Tsunami-Observatorien und übermittelt darin die vorläufigen geschätzten Erdbebenwerte.
Elf MInuten nach dem Beben
Das sind elf Minuten nach dem Erdbeben. Der Tsunami hat da bereits rund 70 Kilometer zurückgelegt. Noch wenige Minuten, dann werden die ersten Menschen sterben.
Ayurveda auf Sri Lanka
Elf Minuten nach dem Beben: Es ist 7.10 Uhr morgens in Sri Lanka, die Sonne geht gerade auf. Anna Lechner und Thomas Elmerhaus, die sich im Ayurveda-Hotel an der Südwestküste erholen, sind schon vor einer Stunde geweckt worden, weil die Kur täglich mit einer Tasse "scheußlich schmeckenden kalten Tees" beginnt, so Elmerhaus. Jetzt genießt das Ehepaar das frühe Licht und die relative Kühle.
An der Nordostküste Sri Lankas - 310 Kilometer entfernt - hat Anqusauy Parameswaran zu diesem Zeitpunkt bereits den Fang der Nacht verkauft. Der 45 Jahre alte Fischer hat sich aus der Armut hochgearbeitet. Er lebt in der Stadt Mullaitivu, die im Tamilengebiet liegt. Seit über 20 Jahren kämpfen dort die "Tigers", die Guerrilleros der Tamilischen Befreiungsbewegung, für einen eigenen Staat. Erst vor drei Jahren haben norwegische Diplomaten den Bürgerkrieg beendet und einen Waffenstillstand ausgehandelt.
Das ist noch kein Friede, doch immerhin: Parameswaran ist vor zwei Jahren in seine zerstörte Stadt zurückgekehrt und hat seither geschuftet. Gemeinsam mit einem Nachbarn hat er sich ein weiß-blau gestrichenes Fischerboot gekauft, die "Blue Marine Star". Auch in der vergangenen Nacht hat er, wie schon oft zuvor, große, schwere Krabben mit Netzen gefischt und sie am frühen Morgen an Händler aus der Hauptstadt Colombo verkauft.
Fünf Kinder haben er und seine Frau: zwei Töchter, drei Söhne. Die Älteste ist 18, der Jüngste neun Jahre alt.
Die Familie lebt in einem kleinen, gemauerten Haus, nur ein paar Meter entfernt vom Meer. Sie ist wohlhabend, der Vater hofft, genug Geld sparen zu können, um seinen 14-jährigen Sohn Philip Rajkumar - "der ist klug wie ein Doktor" - zur Universität schicken zu können.
Hunde bellen am Strand
Elf Minuten nach dem Beben bellen die Hunde am Strand von Kamala in Thailand ohne ersichtlichen Grund wie wild. Phra Ajarn Toy wundert sich, weiß dies aber nicht zu deuten. Der 57-jährige Buddhist ist Abt des kleinen Klosters von Kamala. Er und seine vier Mönche sind bereits seit dreieinhalb Stunden auf den Beinen. Sie haben am frühen Morgen gebetet und sind danach mit Blechschüsseln in den Händen durch den Ort gezogen, um ihr Frühstück zu erbetteln.
Nun sitzen die Mönche wieder im Kloster. Das Gebäude ist mit Wandmalereien geschmückt. Auf einem Bild ist der böse König Payamán zu sehen, der einst mit seinen Kriegselefanten gegen Buddha, den Vollkommenen, auszog. Doch Mutter Erde kam dem meditierenden Buddha zu Hilfe, wrang ihre Haare aus - und ertränkte so Payamáns Armee in einer großen Flut.
Elf Minuten nach dem Beben ist auf den Andamanen und Nikobaren etwas ganz und gar Ungewöhnliches im Gange: Die Tiere fliehen in den Dschungel.
Die 572 Inseln und winzigen Eilande erstrecken sich über rund 700 Kilometer von Norden nach Süden im Golf von Bengalen. Sie gehören politisch zu Indien, das auf der südlichen Insel Car Nicobar einen Militärstützpunkt unterhält.
Die indische Luftwaffe nutzt ihn als Basis, von hier aus wird der Schiffsverkehr im Ozean überwacht und Chinas Funkverkehr belauscht. Mehr als 300 000 indische Siedler haben sich auf insgesamt 36 bewohnten Inseln niedergelassen.
Einmalig aber sind die entlegenen Eilande wegen ihrer einheimischen Bevölkerung: vier negrider und zweier mongolider urzeitlicher Völker.
Forscher vermuten, dass einige dieser Völker seit 30 000 Jahren auf den Inseln ansässig sind - möglicherweise sogar seit 60 000 Jahren. Sie sind damit lebende Relikte aus der Frühgeschichte des Menschen: die einzigen Volksgruppen der Welt, die sich über die Millennien fast unverändert vom Paläolithikum bis ins Atomzeitalter erhalten haben.
Viel mehr weiß man nicht über die meisten dieser Völker: Zu abgeschieden ist ihr Lebensraum, zu feindselig sind sie gegenüber allen Fremden. Ihr abstammungsgeschichtliches Alter etwa haben Wissenschaftler aus DNS-Analysen erschlossen - doch die mussten sie Haarproben entnehmen, die britische Kolonialoffiziere im 19. Jahrhundert Einheimischen abgenommen hatten.
An diesem Morgen nun rennen die Elefanten auf den Andamanen und Nikobaren tief ins Innere der Inseln, auf Anhöhen und Hügel. Ihr Trompeten tönt aus dem Wald. Affen fliehen, Eidechsen kriechen auf Bäume oder Felsen.
Niemandem fällt das seltsame Verhalten der Tiere auf - außer den steinzeitlichen Jägern und Fischern der Inseln.
Ein Wohnhaus an Sumatras Küste bricht zusammen
Elf Minuten nach dem Beben ist der morgendliche Alltag für Agus Maidi bereits abrupt beendet worden. Der Indonesier ist Aufseher bei der Plantagengesellschaft KTS Inc. und lebt in Meulaboh an der Nordwestküste Sumatras.
Die quirlige Stadt, auf einer Halbinsel gelegen, ist bekannt für ihre Parfümerien und umgeben von Reisfeldern und Plantagen, auf denen Palmöl gewonnen wird. Etwa 40 000 Menschen leben hier.
Die großen Häuser sind gemauert, eine kuppelbekrönte Moschee überragt den Ort. Meulaboh bedeutet "ans Ufer gesetzt" - und so ist der kleine Hafen auch das Herz der Stadt, deren Zentrum nur wenige Meter vom Meer entfernt liegt.
Maidi ist zusammen mit seiner Frau auf dem Motorrad Richtung Markt gefahren, um einzukaufen. Das Beben auf dem nahen Meeresgrund hat nur Sekunden nach seiner Abfahrt die Insel Sumatra durchgeschüttelt. Maidi stoppte sein Motorrad. Vor ihm fiel ein Wohn- und Geschäftshaus in sich zusammen. In den Cafés ging das Porzellan zu Bruch.
Motorradfahrer stürzten von ihren Maschinen. Menschen schrien hysterisch und rannten auf die Straße. Maidis Frau warf sich zu Boden und erbrach sich.
Als das Beben endlich aufhörte - Maidi kam es so vor, als dauere es zehn Minuten -, stiegen beide auf das Motorrad und rasten zurück zu ihrem Haus. Sie haben Glück: Ihre Eltern und ihre Kinder leben, das Gebäude ist unbeschädigt. Doch Maidi und seine Frau machen sich Sorgen um Freunde im Zentrum.
Wieder schwingen sie sich aufs Motorrad und fahren wenige Minuten durch die von schon halb zerstörten Häusern gesäumten Straßen. In Richtung Meer. Da rauscht ihnen eine mehr als zehn Meter hohe Wand aus Wasser entgegen.
15 Minuten nach dem Beben, Provin Aceh, Indonesien
15 Minuten nach dem Beben: Meulaboh liegt in der Provinz Aceh und nur rund 100 Kilometer vom Epizentrum entfernt.
Es ist die erste größere Stadt im Weg der Welle. Die Küsten hier sind flach, erst anderthalb bis drei Kilometer im Hinterland steigen Berge steil an.
Indonesien ist, mit 210 Millionen Gläubigen, das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt - und Aceh die älteste muslimische Region des Inselstaates.
Die Gegend im Norden Sumatras wurde bereits im 13. Jahrhundert durch arabische und indische Händler zum Islam bekehrt. Später segelten von hier aus die Schiffe zur Pilgerfahrt nach Mekka die "Veranda von Mekka" wurde Aceh genannt. Die Menschen in der teilweise autonomen Region sind fundamentalistischer als anderswo in Indonesien.
Seit 1976 tobt in der Provinz ein Bürgerkrieg, weil sich die Einheimischen von der Regierung auf der Insel Java ausgebeutet fühlen. Die Provinz ist potenziell reich: Der Energiekonzern Exxon etwa betreibt hier eine große Erdgasverflüssigungsanlage.
Die Provinz Aceh: isoliert, ungeschützt, ahnungslos
Seit Mai 2003 herrscht in der Region, in der rund vier Millionen Menschen leben, das Kriegsrecht; Ausländern ist die Provinz so gut wie verschlossen, der Bürgerkrieg der Regierungssoldaten gegen Kämpfer der Befreiungsbewegung GAM hat Tausende das Leben gekostet und rund 100 000 Menschen obdachlos gemacht. Im Jahr 2003 wurden bei Kämpfen 600 Schulen zerstört. Die Hälfte aller Haushalte wird von Witwen geführt.
Aus der "Veranda von Mekka" ist ein schwer bewachter, abgeriegelter Hinterhof Indonesiens geworden. Isoliert, ungeschützt, ahnungslos: So ist die Provinz Aceh am Morgen des 26. Dezember 2004.
Agus Maidi sieht die Wand aus Wasser, die sich die Straße entlangwälzt. Sie ist hoch wie ein mehrstöckiges Haus und schwarz und schnell. Sie grollt und donnert wie ein Gewitter. Zuvor, aber das hat er nicht mitbekommen, hat sich das Meer für einige Augenblicke weit zurückgezogen.
Nun aber attackiert es die Hafenstadt. Panisch rennen die Menschen davon.

Je weiter die Welle in die Stadt eindringt, desto niedriger wird sie. Ihrer Gewalt jedoch vermag auch dann niemand standzuhalten. Maidi sieht, wie einige der Fliehenden stolpern. Kinder werden von Nachdrängenden niedergetrampelt.
In manchen Straßen rasen Autofahrer davon; Motorräder sind mit vier, fünf Menschen besetzt. Doch Maidi hat keine Chance mehr, sein Motorrad zu wenden. Zu voll ist die Straße, zu schnell das Wasser. Seine Frau und er lassen die Maschine stehen und rennen los. Sie kommen nur einige Meter weit, dann erblicken sie einen schweren Militärlastwagen. Die beiden springen hinein, Dutzende mit ihnen. Dann ist das Wasser da.
Die Schwächsten und Langsamsten sterben zuerst
Die Menschen klettern höher, drängen sich auf das Dach des schon halb gefluteten Lastwagens. Im wirbelnden Wasser auf der Teuku-Umar-Straße, einer der Hauptstraßen der Stadt, erblickt Maidi Tote und Ertrinkende, vor allem Alte, Frauen und Kinder - die Langsamsten und Schwächsten, die als Erste vom Wasser eingeholt und mitgerissen werden.
Doch auch die Kräftigen haben oft keine Chance. Viele der bereits vom Erdbeben beschädigten Häuser fallen unter dem Anprall der Fluten in sich zusammen.
Die Menschen darin werden erschlagen, in die Wellen gerissen - oder eingeklemmt, bis das Wasser über sie steigt. Ein Mann mit kleinen Kindern reißt die Tür eines vorbeifahrenden Krankenwagens auf, wirft die Kinder und sich ins Fahrzeug. Doch das Wasser holt die Ambulanz ein und nimmt sie mit hinaus auf die See.
In manchen Stadtvierteln Meulabohs reicht das Meer so hoch, dass es Verzweifelte von den Veranden im Obergeschoss großer Häuser reißt. Telefonmasten werden umgerissen. Die massiven Mauern des nahe am Meer erbauten Gefängnisses, in dem viele separatistische Kämpfer einsitzen, werden eingedrückt. Rund 100 Häftlinge ertrinken. Nur einige Häuser bleiben stehen.
Ganze Häuser werden mitgerissen
Wer Glück hat, kann sich auf ihre Dächer retten. Andere klammern sich verzweifelt an dem Minarett einer Moschee fest, das wie ein Pfeiler im Wasser steht. Manche Menschen sind nackt - der Sog des Wassers hat ihnen alle Kleider vom Leib gerissen. Ein neunjähriger Junge krallt sich an eine Matratze. Die Flut hat ihn aus seinem Elternhaus gespült.
Maidi und seine Frau haben Glück.
Zunächst. Obwohl selbst massige Geländewagen, Kleinbusse, Fischerboote, ja ganze Häuser durch die Fluten gewirbelt werden, bleibt der schwere Armeelastwagen stehen. Doch auf seinem Dach drängen sich immer mehr Männer, Frauen und Kinder. Es wird gefährlich eng.
Also entschließen sich einige Männer, den Frauen und Kindern Platz zu machen. Sie stürzen sich in die Fluten, um zu einem noch stehen gebliebenen Dach oder einem anderen sicher wirkenden Punkt zu schwimmen. Auch Maidi wirft sich ins Wasser.
Einige Männer werden schnell fortgetrieben oder von herumwirbelnden Holzbalken getroffen. Sie ertrinken. Maidi jedoch kämpft sich bis zum Dach des Tunggal-Menara-Ladens durch, rund 50 Meter entfernt vom gefluteten Lastwagen.
Das Ende der Welt
In diesem Augenblick erklingt von überall her: "Allahu akbar, Gott ist größer" - gerufen von Menschen auf den Dächern. "Das ist das Ende der Welt", denkt Maidi. Binnen weniger Minuten reißt der Tsunami 80 bis 90 Prozent aller Gebäude der Stadt mit sich oder beschädigt sie irreparabel.
Die Welle ergießt sich mehr als drei Kilometer weit ins Land. Zwei Tage lang steht ein großer Teil der Stadt unter Wasser. Von den rund 40 000 Einwohnern Meulabohs sterben etwa 10 000.
Banda Aceh, die rund 150 000 Einwohner zählende Provinzhauptstadt, fünf Autostunden von Meulaboh entfernt, wird kaum weniger hart getroffen. Sie ist berühmt für ihre große Baiturrahman- Moschee und den Gunongan - eine Promenade aus Bädern und Lustgärten am Ufer eines Flusses.
Seit Jahrhunderten schon fertigen Schmiede in Banda Aceh kunstvollen Goldschmuck, seit 46 Jahren beherbergt die Stadt auch die Syiah-Kuala-Universität. Doch längst ist die Infrastruktur an ihre Belastungsgrenze gelangt. Immer wieder fällt der Strom aus, das Telefonnetz ist unzuverlässig.
Vielleicht ist Mohammed Kadir hier der erste Mensch, der die Welle kommen sieht. Der 76-Jährige ist der stellvertretende Bürgermeister der Stadt. Nach dem Beben eilt er zum Markt, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Da bemerkt er, wie das Meer zu beiden Seiten der Bucht weit zurückweicht - und in der Mitte auf die Stadt zuschießt.
"Das Wasser kommt! Nur weg von hier!"
Niemals zuvor hat er so etwas gesehen, doch instinktiv dreht er sich um, rennt durch die Straßen, schlägt an Haustüren, hastet in eine Moschee. Immer wieder ruft er das Gleiche: Das Wasser kommt! Nur weg von hier!
Durch die Welle versinkt die Stadt binnen Sekunden im Chaos. An der palmengesäumten Bucht von Banda Aceh gibt es nicht einmal eine Anhöhe, auf die man fliehen könnte. Ein Mann, der unter der Dusche stand, als die Erde bebte, rennt aus seinem Haus. Als ihm auf der Straße bewusst wird, dass seine Familie noch im Gebäude ist, dreht er sich um, weil er zurückeilen möchte.
In diesem Augenblick schon erreicht ihn der Tsunami. Sein Haus verschwindet in den Fluten - und in ihm seine Frau, seine fünf Kinder, seine Schwester und zwei Brüder. Eine Medizinstudentin der örtlichen Universität ist gerade im Krankenhaus. Da drängt Wasser durch den Eingang.
In Panik eilt sie zum Hinterausgang und klettert über eine stacheldrahtbewehrte Mauer, die den Komplex abschließt, und bringt sich so in Sicherheit. Doch für die Patienten, die nicht rennen können, wird das Krankenhaus zur Falle.
Frau, Tochter und Sohn werden vom Wasser mitgerissen
"Halt mich, Bang, halt mich!", hört Yusmadi Sulaiman seine Frau rufen. "Bang" ist eine indonesische Anrede unter Ehepaaren, doch in dem Ruf liegt keine Zärtlichkeit, sondern Angst. Der 60 Jahre alte Lastwagenfahrer steht bereits in den Wellen und klammert sich verzweifelt an eine Palme. In einem Arm hält er seinen vierjährigen Sohn. Seine Frau, nur ein paar Schritte entfernt, hält die achtmonatige Tochter fest.
Ihr Hilfeschrei ist das letzte Lebenszeichen, das Sulaiman von seiner Familie hört. Die Welle reißt ihm Augenblicke später Frau und Tochter weg, dann zerrt sie den Sohn aus seinen Armen.
Manchmal entscheiden nur wenige Meter über Leben und Tod. Wer die Baiturrahman-Moschee erreicht, der hat es geschafft, denn das massive Bauwerk widersteht den Wellen. Doch die Gebäude direkt neben dem Gotteshaus kollabieren. Noch Tage nach der Flut findet man unter ihren Trümmern Tote.
Wundersame Rettungen
Banda Aceh wird, später, zur Stadt der mirakulösen Rettungen. In den Tagen des Jahreswechsels 2004 auf 2005, da das Wasser langsam die verwüstete Provinz wieder freigeben wird, werden hier Geschichten erzählt von Gnade, Wunder, Rettung, von der Hoffnung im Angesicht des Massensterbens.
Die Geschichte von der 21-jährigen Kasmidar etwa (viele Menschen in der Region führen nur einen Namen), die, im achten Monat schwanger, von der Welle auf eine Palme gespült wird und dort das Desaster übersteht. Von Ichsan Azmil, der unter einem einstürzenden Haus gefangen wird, aber nicht ertrinkt und nach sechs Tagen lebend aus den Trümmern gezogen wird.

Von Ari Afrizal, einem Bauarbeiter, den die Welle ins Meer spült. Er klammert sich an ein Stück Treibholz, später rettet er sich auf einen zerbrochenen Kahn, schließlich auf ein vorbeitreibendes Fischerfloß. Dort findet er einige Flaschen Mineralwasser. Außerdem holt er sich Kokosnüsse aus dem Meer und beißt sie mit den Zähnen auf. Endlich entdeckt ihn die Besatzung eines Containerschiffes mitten auf dem Ozean - zwei Wochen nach der Katastrophe.
Doch die Geschichten von wunderbaren Rettungen sind eben genau dies: Wunder in einer Zeit, in welcher der Tod die Regel ist.
Stadtviertel, Dörfer, Militärbasen - verschwunden
Mehr als 30 000 Menschen sterben in Banda Aceh, die Stadt wird zu rund zwei Dritteln eingeebnet, ihr Fährhafen verschwindet fast spurlos im Meer. Rund 85 Prozent der Provinzküste, etwa 250 Kilometer, sind ein bis fünf Kilometer tief verwüstet. Mancherorts sind die Wellen 15 Meter hoch. Wo zuvor Ortschaften standen, erstrecken sich nun Lagunen.
25 von 35 Dörfern um die Kleinstadt Keude Teunom, etwa 60 Kilometer nördlich von Meulaboh, sind verschwunden. In der 10 000-Einwohner-Stadt Calang sterben mehr als zwei Drittel der Einwohner. Die Überlebenden werden den Ort später für immer aufgeben.
Am Raba-Lhoknga-Fluss, nahe der Nordspitze Sumatras, ist von den zwei Militärbasen an beiden Ufern nur ein Wachhäuschen aus Beton geblieben. Von den 300 Soldaten und ihren Familienangehörigen retten sich sechs. In der Stadt Lambada ertrinken 2000 Menschen, nur 105 Einwohner überleben, unter ihnen bloß fünf Frauen.
Fischer auf hoher See bemerken nichts
Die meisten der davongekommenen Männer sind Fischer, die auf hoher See waren und nicht einmal bemerkt haben, wie ihre Heimat vernichtet wurde. An einem anderen Ort wird ein Fischer am Strand unter seinem gekenterten Boot gefangen und kann sich nicht mehr befreien. Nach einer Woche erst kommt er, dehydriert, verletzt und psychisch angeschlagen, aus seinem Gefängnis frei.
Und auf der vor der Küste gelegenen Insel Malinggei hat sich die Welle wahrscheinlich sogar 20 Meter hoch aufgerichtet. Zumindest werden das später Rettungsteams anhand der Verwüstungsspuren an wenigen stehen gebliebenen Palmen schätzen. Berichten kann davon niemand mehr: Von den 500 Einwohnern des Eilands fehlt jede Spur.
Seit Menschen ihre Geschichte aufschreiben, haben sie niemals über eine Region berichtet, die von einem Tsunami so schrecklich verwüstet worden ist wie Aceh auf Sumatra am Morgen des 26. Dezember 2004 - am Morgen des "Schwarzen Sonntags", wie ihn Überlebende bald nennen.
In den Minuten, da der Tsunami zuschlägt, und den wenigen Stunden, in denen das Wasser im flachen Küstenstreifen stehen bleibt, sterben in dieser Provinz mehr als 200 000 Menschen.
Doch jenseits von Aceh ist die Welt noch immer ahnungslos.
15 Minuten nach dem Beben, Hawaii
Pacific Tsunami Warning Center, 15.14 Uhr Ortszeit, 15 Minuten nach dem Erdbeben: Ungefähr in dem Augenblick, da in Sumatra die ersten Menschen ertrinken, geben Stuart Weinstein und Andrew Hirshorn, so scheint es, Entwarnung.
Die beiden Forscher haben neue Daten durch ihre Rechner gejagt. Noch immer vermuten sie, dass das Beben die Stärke 8,0 hat.
Nun geben sie, mit diesem Wert, mit Uhrzeit und Ort des Bebens, das "Tsunami Information Bulletin Number 001" heraus. "Diese Nachricht dient nur der Information", schreiben die Forscher.
Bulletins werden vom PTWC dann erstellt, wenn im Pazifik oder in dessen Nähe Erdbeben stattgefunden haben, die Forscher aber nicht erwarten, dass sie Tsunamis auslösen werden. "Es ist kein Tsunami-Alarm und keine Warnung eingetreten", schreiben Weinstein und Hirshorn. "Dieses Erdbeben liegt außerhalb des Pazifiks. Keine zerstörerische Tsunami-Bedrohung existiert, basierend auf historischen Erdbeben- und Tsunami-Daten." Es ist, streng genommen, keine Fehleinschätzung - denn dem Pazifik droht ja tatsächlich keine Gefahr. Und es ist immerhin die erste Nachricht, die an alle 26 Staaten des pazifischen Warnsystems geht. Zu diesem Warnsystem gehören, wegen ihrer am Stillen Ozean gelegenen Ostküsten, auch Indonesien und Thailand.
15 Minuten nach dem Erdbeben also erfahren Indonesiens Geophysiker, dass ihre gemessenen Werte falsch sind - doch da ist es schon zu spät, noch irgendjemanden in ihrem Land zu warnen.
Niemand will die Touristen in Thailand verunsichern
Thailand dagegen ist noch unversehrt. Kann ein schweres Erdbeben, über 700 Kilometer vor der eigenen Südwestküste, eine Bedrohung sein? Vor den Provinzen Phuket, Phang Nga und Krabi, wo viele der zwölf Millionen Touristen, die dieses Jahr Thailand besuchten, Urlaub gemacht haben? Wo in den letzten Jahren große Strandhotels oft nur wenige Zentimeter über der Hochwassermarke errichtet worden sind?
Genau da liegt das Problem: Kein Mitarbeiter im thailändischen Meteorologischen Dienst, der für Erdbebenwarnungen zuständig ist, will die devisenbringenden Touristen verunsichern. Oder genauer: will die mächtigen Beamten der Tourismusbehörde in Bangkok gegen sich aufbringen.

Als 1998 die Erde nach einem Beben der Stärke 7,1 bei Papua-Neuguinea ins Rutschen kam und einen lokalen Tsunami auslöste, warnte Thailands Meteorologischer Dienst vor der Gefahr einer Welle - doch die richtete in Thailand keinen Schaden an. Samith Dhamasaroj, der Generaldirektor der Behörde, forderte dennoch, dass in Thailands Südwestprovinzen in einem Uferstreifen von gut 250 Meter Breite aus Sicherheitsgründen keine Gebäude mehr errichtet werden dürften - also auch keine Hotels. Die Verantwortlichen in der Tourismusbehörde waren außer sich. Kurz darauf wurde Dhamasaroj von seinem Posten abgelöst.
Wenn ein Beben der Stärke 7,1 vor Papua-Neuguinea dazu geführt hat, dass der Generaldirektor seinen Posten verliert - wer würde da bei einem Beben von gemeldeter Stärke 8,0 vor Sumatra seinen Job riskieren wollen?
Wurde ein Fischer als erster vor dem Tsunami gewarnt?
Kein Angehöriger von Thailands Meteorologischem Dienst gibt eine Warnung heraus. Zumindest nicht offiziell. Allerdings bringt eine thailändische Zeitung einige Tage nach der Katastrophe die Meldung, dass eine Mitarbeiterin des Meteorologischen Dienstes ihren Vater angerufen habe. Der Fischer Prayoon Damrongsiri aus dem Distrikt Takua Pa bereitet am frühen Morgen gemeinsam mit seinem Sohn sein Boot für die Ausfahrt vor, als ihn ein Anruf der Tochter erreicht. Seismische Messgeräte, sagt sie, hätten ungewöhnliche Bewegungen des Meeresbodens registriert.
Diese könnten große Wellen auslösen. Damrongsiri möchte daraufhin erst gar nicht auslaufen - doch sein Sohn schlägt die Warnung in den Wind. Noch nie habe es im Indischen Ozean Tsunamis gegeben. Die beiden fahren hinaus.
Das Einzige, was die Mitarbeiterin des Meteorologischen Dienstes erreichen kann, ist das Versprechen ihres Vaters, beim ersten Anzeichen einer ungewöhnlichen Welle nicht zur Küste, sondern hinaus aufs Meer zu fahren, um sich in Sicherheit zu bringen.

Die Meldung in der Zeitung wirkt dubios: Der Fischer will, wird er später berichten, schon gegen 5.30 Uhr von seiner Tochter gewarnt worden sein, und damit rund zweieinhalb Stunden, bevor die Erde bebte.
Tatsächlich kann die Tochter ihren Vater erst gegen 8.15 Uhr gewarnt haben. Zu einem Zeitpunkt, da die meisten Fischer längst den Hafen verlassen haben.
Sollte es sich aber tatsächlich doch so zugetragen haben (vielleicht hat sich der Fischer in seinen Erinnerungen nach dem Drama nur in der Zeit des Anrufes seiner Tochter geirrt), dann ist Prayoon Damrongsiri der erste Mensch, der vor dem Tsunami gewarnt worden ist.
30 Minuten nach dem Beben
30 Minuten nach dem Beben: Die Schockwellen im Erdboden erreichen Indien, Sri Lanka und die Malediven. Überall wackeln die Wände der Häuser.
In einem Regierungsbüro in Chennai (Madras) an Indiens Ostküste studieren P. Chandrashekhar Rao und zwei Kollegen die mächtigen Ausschläge, die der Stift eines Seismographen auf eine Rolle weißes Papier schreibt. Die indischen Forscher haben das Beben rasch registriert und lokalsiert. Rao befürchtet, dass es einen Tsunami auslösen könnte - doch er hat kaum Kenntnisse über dieses Phänomen und weiß nicht, was er tun soll. Er ruft die Zentrale des Meteorologischen Dienstes in Neu-Delhi an und meldet die Werte. Sonst unternimmt er nichts.
Sri Lankas Wetteramt ist in Colombo in einem ehrwürdigen alten Haus untergebracht. Doch für moderne Ausrüstung fehlt das Geld. Es verfügt nicht über einen Seismographen. Als - kurz nachdem das Erdbeben auf der Insel spürbar war - die ersten Anrufe besorgter Bürger dort eingehen, setzt sich Sarath Premalal an den Computer und surft im Internet. Er ist der einzige diensttuende Meteorologe; an diesem Sonntagmorgen steht er am Ende einer 24-Stunden-Schicht.
"Machen Sie sich keine Sorgen!"
Mit einer Hand hält er den Telefonhörer, mit der anderen bedient er die Computermaus. Schließlich landet er auf der Internetseite des US-amerikanischen Geologischen Dienstes. Dort sind inzwischen die Daten des PTWC und anderer Messstationen veröffentlicht worden. So erhält, rund 15 Minuten nachdem Weinstein und Hirshorn das erste Bulletin versendet haben, auch der diensthabende Meteorologe Sri Lankas die vorläufigen Ergebnisse der US-Forscher.
"Machen Sie sich keine Sorgen", beruhigt Premalal eine Anruferin, "es ist weit weg. Wir wissen bereits davon." Kurz darauf aber bespricht er mit seinem inzwischen eingetroffenen Chef Jayatilaka Banda, dem stellvertretenden Direktor des Wetterdienstes, die Möglichkeit, ob das Beben einen Tsunami ausgelöst haben könnte.
Banda denkt kurz daran, Fernseh- und Radiostationen zu informieren. Doch dann entscheidet er sich dagegen, denn er fühlt sich dazu nicht autorisiert. Stattdessen weist er seinen Mitarbeiter an, im Internet nach weiteren Informationen zu suchen. Für die nächsten 105 Minuten werden sie über ihre Vermutungen diskutieren und nach aktuelleren Fakten fahnden. Sie informieren niemanden.
35 Minuten nach dem Beben
Car Nicobar, indischer Luftwaffenstützpunkt, 35 Minuten nach dem Beben.
Eine mindestens zehn Meter hohe Welle fegt über die Militärbasis. Der Tower des Flughafens stürzt um, das Hauptquartier und andere Gebäude werden von der Welle verwüstet, der Beton der Landebahn bricht und reißt. 1700 Soldaten und deren Angehörige sind hier stationiert, mindestens 102 von ihnen ertrinken.
Die Nikobaren und Andamanen sind die Gipfel eines versunkenen Gebirges. Manche Inseln ragen mehrere hundert Meter hoch über den Wasserspiegel auf, doch die meisten sind flach, umgeben von Korallenriffen, Stränden und Mangrovenwäldern. Das indische Mutterland liegt 1500 Kilometer weiter westlich, das Epizentrum des Bebens ungefähr 700 Kilometer südöstlich.
Die 20 000 Nikobaresen sind eines der beiden urzeitlichen Völker mongolider Abstammung und das bei weitem größte eingeborene Volk der Inselgruppe. Viele von ihnen arbeiten in der indischen Verwaltung oder in den Städten der gut 300 000 indischen Kolonisten auf den Eilanden. Die meisten Nikobaresen sind Christen.
Durch Risse im Boden steigt das Wasser auf
Moses Reuben ist einer von ihnen und an diesem Sonntagmorgen in der Kirche. Gerade hat ein Gebet begonnen, als die Welle zuschlägt. Plötzlich steigt das Wasser an der Küste rasend schnell an. Es ist der Lärm, der viele Einwohner von Car Nicobar alarmiert: ein schreckenerregendes Rollen. Ausgerissene Bäume wirbeln in der Woge.
Doch die Flut steigt nicht nur aus dem Meer: Nach dem Erdbeben, das die Insel nur Minuten zuvor erschüttert hat, haben sich Risse im felsigen Boden aufgetan. Durch die drückt nun ebenfalls Wasser hoch und überflutet das Eiland. Reuben eilt zum Haus der Familie.
Sein Sohn Paul will den Enkel Melchior retten, einen zweijährigen Jungen, der noch schläft. Der Vater kann ihn nicht wecken, also hebt er ihn hoch. Doch das Wasser ist schneller: Zunächst wird ihm das Kind aus den Armen gerissen, dann verschwinden Vater und Sohn vor den Augen des Großvaters im zusammenstürzenden Haus. Auch der andere Enkel ertrinkt. Er ist neun Monate alt.
Giftschlangen und Krokodile treiben landeinwärts
Moses Reuben und andere Überlebende retten sich auf höher gelegene Teile der Insel - hinein in den Dschungel. Die verängstigten Menschen müssen sich vor Pythons in Acht nehmen und vor grünen Giftschlangen. Außerdem treibt die Welle Krokodile aus den Mangroven tief ins Binnenland.
15 Dörfer liegen auf Car Nicobar - alle an der Küste. Zwölf werden von dem Tsunami ausgelöscht, die Welle lässt kein Gebäude stehen, die Holzhütten nicht und auch nicht die modernen Bauten aus Beton. Alle Anlegestellen und Häfen werden binnen Sekunden zerschmettert.
In der Stadt Malacca lagert die Welle eine dicke Sandschicht ab, aus der nur noch die Arme einiger Toter herausragen.

Auf einigen anderen Inseln ist es ähnlich (manche dagegen werden durch vorgelagerte Eilande oder Riffe vor der Wucht der Welle bewahrt). Indira Point etwa, der südlichste Landflecken der Inselkette und somit zugleich der südlichste Punkt des indischen Staates, ist Heimat einer Population großer Lederschildkröten - und von sechs Wissenschaftlern, welche die Tiere studieren, sowie deren Familien. Von den Menschen fehlt seit dem Tsunami jede Spur.
Elf Tage hockt ein Junge im einem Baum
Andere Einwohner dagegen haben unwahrscheinliches Glück. Wie der 14 Jahre alte Murlidharan, der am Strand vor dem Dorf Tapomming mit Freunden Kricket spielt, als das Wasser kommt. Der Junge kann nicht schwimmen, was seine Angst ins Unermessliche steigert.
Seine Freunde verschwinden in Strudeln, er aber rettet sich auf einen Baum. Elf Tage und Nächte bleibt er dort hocken, denn das Meer fließt nicht wieder ab und er, der Nichtschwimmer, will nicht riskieren, im nur noch brusttiefen Wasser unterzugehen. Am Ende jedoch sinkt er entkräftet vom Baum. Retter finden ihn und sprechen von einem medizinischen Wunder: Murlidharan, knapp 1,50 Meter groß, wiegt nur noch 21 Kilo.
Oder wie die 13-jährige Meghan Rajashekhar, die sich im Chaos an einer ausgerissenen Tür festklammert und auf das Meer hinausgezogen wird. Zwei Tage treibt sie dort, nachts sieht sie Schlangen im Wasser. Dann erst kann sie wieder an Land schwimmen - wo andere Überlebende sie finden und mit Kokosmilch und Essen versorgen. Doch mehr als 1000 Menschen auf Car Nicobar sterben oder sind seither verschollen.
Isoliert lebende Völker erkennen das Unheil früh
Niemand weiss genau, was die anderen Urvölker auf den Inseln in jenen Katastrophenminuten getan, was sie gedacht haben. Doch eines ist sicher: Sie haben gewusst, was auf sie zukommt.
Denn diese Völker haben sich, anders als die Nikobaresen, nie an die moderne Welt angepasst - und dafür einen hohen Preis bezahlt. Ethnologen und Anthropologen sehen sie schon seit Jahren "auf dem Weg in die Ausrottung". Die Naturvölker leiden unter den Siedlern, die in ihr Land eingedrungen sind, vor allem aber unter den Seuchen, welche Inder und, im 19. Jahrhundert, als sie die Eilande als Strafkolonie nutzten, Briten eingeschleppt haben.
Die Schompen etwa, neben den Nikobaresen das zweite mongolide Volk der Eilande, leben in dem Dschungel auf Great Nicobar und zählen vielleicht noch 150 Angehörige. Die negriden Gruppen auf den Andamanen - Abkömmlinge der urtümlichsten Menschen Asiens - sind ähnlich klein: 266 Jarawa auf South und Middle Andaman, 98 Onge auf Little Andaman, 45 Großandamanesen auf den Strait Inseln - und eine unbekannte Zahl, vielleicht 200, von Sentinelesen auf der gleichnamigen Insel.
Die Sentinelesen: Mit Pfeilschüssen und Steinwürfen überschütten sie jeden, der es wagt, an ihrem Eiland zu landen, ja, sie beschießen sogar Hubschrauber, die sich zu tief hinabwagen.
Einige Forscher, die sich zu ihnen begeben wollten, haben dieses Unternehmen noch vor wenigen Jahren mit dem Leben bezahlt. Seit 1991 hat die indische Regierung nicht nur jeden Versuch aufgegeben, Kontakt mit ihnen herzustellen, sie hat ihre Insel auch vollständig gegenüber allen Fremden abgeriegelt.
Niemand weiß bis heute, welche Sprache die Sentinelesen sprechen, welche Mythen sie sich erzählen, an welche Götter sie glauben, wann und wie sie das abgelegene Eiland besiedelt haben.
Das aber ist sicher: Die Onge und die Sentinelesen und wahrscheinlich auch die anderen drei kleinen Völker haben das Menetekel erkannt. Sie müssen gewusst haben, dass eine Riesenwelle droht, wenn sich nervöse Tiere plötzlich ins Land zurückziehen und zugleich das Meer ungewöhnlich weit zurückweicht. Vielleicht haben die Tiere mit ihren feineren Sinnen den Lärm des Tsunami schon von weitem gehört. Vielleicht haben sie das Zittern des Bodens gespürt oder winzigste Änderungen des Luftdrucks.
Die Sentinelesen und die anderen steinzeitlichen Jäger, Sammler und Fischer jedenfalls, die, um überleben zu können, die Zeichen der Natur genauestens beachten müssen, haben die Warnsignale erkannt und sind tief in den Dschungel geeilt, weit weg vom Meer.
Mythische Geschichten von Riesenwellen
Die Völker müssen ihre Lager in Küstennähe irgendwann in den Minuten nach dem Erdbeben verlassen haben. Im Urwald haben sie sich versteckt - noch mehrere Tage nach dem Unglück, als indische Retter mit Hubschraubern und Booten die Inseln absuchen, werden sie keine Spur von ihnen finden.
Gut möglich, dass im kollektiven Gedächtnis der Sentinelesen und der anderen Völker Erinnerungen an frühere Tsunamis gespeichert sind: halb mythische Geschichten von Riesenwellen, die von einer Generation der nächsten weitererzählt werden. Die Polynesier jedenfalls, auf ihren pazifischen Eilanden jahrhundertelang ähnlich weltabgeschieden wie die Eingeborenen der Andamanen und Nikobaren, haben die Geschichte der Besiedlung einer jeden Insel über 500, ja manchmal fast 1000 Jahre hin in legendenhafter Form weitergegeben. Der Ausbruch des Krakatau und der anschließende Tsunami dagegen sind erst gut 120 Jahre her - vier Generationen. Ein Augenblick nur in der Geschichte von Völkern, die seit Jahrzehntausenden am gleichen Ort durchhalten.
So vollbringen die Menschen des Paläolithikums das, was den Menschen des Atomzeitalters nicht gelingen will: Sie retten sich vor der Apokalypse. Vorerst zumindest. Denn auch die Sentinelesen und die anderen Völker können zwar sich selbst, nicht aber ihre Inseln vor der zerstörerischen Kraft des Tsunamibewahren.
Inseln werden in mehrere Teile zerrissen
Viele Strände werden von der Welle weggerissen. Korallenriffe sind zerschmettert, oder erstickt unter dem hinausgeschwemmten Sand, oder durch das Beben aus dem schützenden Wasser hinausgehoben. Mangrovenwälder sind zerschlagen, Böden und Quellen an vielen Stellen versalzen. Manche Eilande stehen tagelang unter Wasser, einige von ihnen werden vielleicht nie wieder aus dem Ozean auftauchen. Die Insel Teressa ist durch die Gewalten in zwei, Trinkat gar in drei Teile zerrissen worden.
Wälder, in denen die steinzeitlichen Jäger bis vor kurzem Wildschweinen nachstellten, sind verschwunden; durch Korallenriffe geschützte Lagunen, in denen sie Schildkröten harpunierten, sind verwüstet; Wasserstellen verschwunden oder versalzen.

So schlagen sich etwa 73 der 98 Onge nach der Welle bis zu einem indischen Flüchtlingscamp durch. Dort allerdings werden sie nicht nur versorgt, sondern lernen innerhalb von Tagen auch Alkohol und Tabak kennen.
Keiner kann sagen, ob die Naturvölker den nun erzwungenen Kontakt zur modernen Zivilisation und die Verwüstung eines Teils ihrer Jagd- und Fischgründe auf Dauer zu überstehen vermögen. Oder ob diese "entferntesten Cousins des heutigen Menschen", wie sie ein Forscher einmal genannt hat, durch die Folgen des Tsunami doch noch kulturell, vielleicht gar physisch ausgelöscht werden.
Endlich ein Warnruf an die Welt
Die Siedler und Soldaten auf den Inseln werden, zumindest in den ersten Stunden der Katastrophe, viel härter getroffen als die indigenen Völker. Doch immerhin gelingt einem von ihnen, was bis dahin noch keiner vermocht hat: Er schickt einen Warnruf in die Welt.
Es ist ungefähr 7.20 Uhr in Indien, als ein Controller am Verkehrsflughafen von Chennai an Indiens Ostküste einen "Mayday"-Ruf auffängt. Ein Funker der verwüsteten Militärstation auf Car Nicobar meldet, dass ihre Basis von einem Erdbeben und einer Flutwelle schwer getroffen worden sei. Der Funkspruch ist eigentlich an eine militärische Stelle gerichtet, doch der Controller in Chennai hört ihn zufällig mit.
Per Telefon unterrichtet dieser daraufhin die Militärs der Luftwaffenbasis am Stadtrand. Den Soldaten dort gelingt es, Funkkontakt mit Car Nicobar aufzunehmen. Schnell wird klar, dass die Station verwüstet, die Start- und Landebahn aber noch benutzbar ist. Flugzeuge werden losgeschickt.
So erfahren die Militärs am Rande von Chennai von einer Flutwelle. Nur ein paar Kilometer weiter in einem Büro in derselben Stadt studiert der Forscher Chandrashekhar Rao noch immer die Bebenwerte seines Seismographen und macht sich Gedanken über die Gefahren eines Tsunami. Doch Soldaten und Experten wissen nichts voneinander. Kein Offizier denkt daran, die Regierung in Neu-Delhi oder überhaupt irgendeinen Zivilisten über die Meldung aus Car Nicobar zu informieren. "Der Job der indischen Luftwaffe ist es, Kriege zu führen und Hilfsaktionen durchzuführen - nicht, Tsunamis vorherzusagen", rechtfertigt sich später ein Offizier. Seit dem Beben sind 52 Minuten vergangen.
61 Minuten nach dem Beben
61 Minuten nach dem Beben: Es ist jetzt 8.00 Uhr morgens in Sri Lanka.
Anna Lechner und Thomas Elmerhaus schlendern zum Frühstücksraum im Erdgeschoss ihres Hotels. Die meisten Touristen allerdings wohnen, wie das Ehepaar aus Hamburg, in Bungalows direkt hinter dem Strand. Nur ein nicht einmal kniehoher Wall aus Natursteinen trennt das Areal des Resorts vom Sand ab - nicht mehr als eine Grenzmarkierung und ein eher symbolischer Wellenschutz.
Das Hotel ist gut belegt, viele Gäste kommen aus Deutschland. Anna Lechner und Thomas Elmerhaus kennen schon einige von ihnen, zumindest vom Sehen: darunter ein anderes Paar aus Hamburg - sie ist Psychologin, ihr Mann schleppt fast überall eine riesige Fotokamera und eine ebenso massige Filmtasche mit; eine stark gehbehinderte Frau, die mit einer Freundin angereist ist, und ein Mann, der 10 000 Euro in einer Plastiktüte im Hotelsafe deponiert hat. Manche Gäste munkeln, er sei ein Bauunternehmer, der das Geld seiner deutschen Familie vorenthalten und irgendwie "in Sri Lanka unter die Leute bringen" wolle.
Anna Lechner hat sich auch schon mit Einheimischen angefreundet: mit Betreuerinnen aus dem Hotel, mit Jungs, die ihre freie Zeit am Meer verbringen, mit der uralten Verkäuferin, die jeden Tag am Strand Kokosnüsse und Räucherstäbchen feilbietet.
Anqusauy Parameswaran, der Fischer, der sich an der bürgerkriegsgeplagten Ostküste eine Existenz aufgebaut hat, genießt die ruhigen Stunden nach getaner Arbeit. Seine Frau steht in der Küche und kocht, er und die 15-jährige Tochter Mary lesen Zeitung.
Die ersten thailändischen Familien aus Kamala finden sich im Kloster des Abtes Phra Ajarn Toy ein. Es liegt direkt an der Bucht, nur wenige Schritte entfernt vom Meer. Die Menschen lassen sich in einem Nebengebäude auf Matten nieder, spenden Ananas und Reis und entzünden Räucherstäbchen. Sie lauschen den Gebeten der Mönche.
Phra Ajarn Toy ruft die verstorbenen Ahnen an.
65 Minuten nach dem Beben
Pacific Tsunami Warning Center, 16.04 Ortszeit, 65 Minuten nach dem Erdbeben: Eigentlich wollte Dr. Charles McCreery an diesem Nachmittag zwei rosafarbene Fahrräder zusammenschrauben, Weihnachtsgeschenke für seine vierjährigen Zwillingstöchter. Doch vor 19 Minuten ist er von Weinstein und Hirshorn alarmiert worden: McCreery, 54, ist Direktor des PTWC. Seine beiden Mitarbeiter sind mittlerweile so besorgt, dass sie ihren Chef aus der Weihnachtsruhe aufgestört haben.
Denn inzwischen haben Weinstein und Hirshorn neue Daten durchgerechnet: Die langsameren, durch tiefere Erdschichten laufenden seismischen Wellen lassen auf ein Beben der Stärke 8,5 schließen. McCreery besieht sich die Ergebnisse. Ein lokaler Tsunami sei möglich, befindet er, aber kein "Teletsunami" - eine Welle, welche über Tausende Kilometer läuft.
Nun lässt McCreery ein zweites Bulletin versenden. Es enthält die neuen, geschätzten Erdbebenwerte und den ominösen Zusatz: "Es besteht die Möglichkeit eines Tsunami nahe dem Epizentrum." Diese Meldung geht bei Thailands Meteorologischem Dienst ein - und endlich reagieren die dortigen Mitarbeiter.
Sie informieren aber nicht etwa die Medien, die Polizei oder irgendwelche Beamten in den bedrohten Provinzen, sondern stellen um 9.20 Uhr eine Meldung auf ihre Website im Internet, in der sie vor einem "Erdbeben und gefährlichen Meeresströmungen" warnen.
2.01 Stunden nach dem Beben
Vor der Westküste Thailands, um 10.00 Uhr Ortszeit, 2.01 Stunden nach dem Beben: Prayoon Damrongsiri hat mit seinem Sohn die Netze ausgeworfen.
Das Boot des thailändischen Fischers, der möglicherweise von seiner Tochter beim Meteorologischen Dienst vor einer Riesenwelle gewarnt worden ist, dümpelt gut drei Kilometer vor der Küste.
Seit einiger Zeit verhält sich das Meer seltsam. Vor wenigen Minuten hat Damrongsiri hier die Korallen am Grund des Ozeans erblickt - zum ersten Mal in seinem Leben. Niemals zuvor ist so weit draußen das Wasser so klar gewesen.
Und nun spürt er plötzlich eine ungeheure Kraft unter sich. Er fühlt, wie sein Boot hochgehoben wird und immer höher: Eine gewaltige Welle rauscht unter ihm hindurch.
Die Rettung: Kurs aufs offene Meer
Er beherzigt den Rat seiner Tochter und nimmt eilig Kurs aufs offene Meer. Fünf andere Fischer, die ebenfalls mit ihren Booten draußen sind, machen sich dagegen sofort in panischem Schrecken auf den Weg zum Ufer. Damrongsiri wird sie nie wiedersehen.
Als die Welle unter seinem Boot durchläuft, ist sie noch einige Sekunden von Thailands Küste entfernt.
Es ist Hauptsaison in Thailand. Etliche zehntausend Touristen sind im Land, vor allem Europäer. Viele machen Urlaub an den Stränden von Phuket, Kamala, Ko Phi Phi, Phang Nga und Ko Lanta. Die Eilande und die schmale Halbinsel waren noch bis in die 1990er Jahre hinein Sumpf- und Mangrovengebiete und damit ideale Auffangregionen für Hochwasser oder Regenfluten. Doch seit gut einem Jahrzehnt sind hier große Hotelkomplexe entstanden.
Viele Bäume sind abgeholzt worden, der Boden ist stellenweise durch Beton und Asphalt versiegelt. Es ist kein Areal mehr da, an dem Wasser, ohne Schäden anzurichten, abfließen oder versickern könnte.
Manche Touristen schlafen noch in ihren Bungalows am Meer, die am Strand, bei einigen Luxusresorts sogar auf Stelzen im Wasser errichtet sind. Andere sitzen beim Frühstück. Viele aber sind schon aufgestanden und vergnügen sich im Meer. Sie gehören zu den Ersten, welche die Gewalt der Welle spüren.
So wie Luke Simmonds aus London. Der Manager einer Media-Agentur ist seit sechs Tagen im Land. Er ist ein erfahrener Taucher, doch an jenem Morgen hat er beschlossen, zusammen mit einem dänischen Freund eine Runde Wasserski zu fahren.
Eine zehn Meter hohe Wasserwand
Simmonds macht sich gerade bereit, als das Wasser aus der Lagune vor Ko Phi Phi verschwindet. Binnen Sekunden ist es so flach, dass Wasserskifahren unmöglich ist. Simmonds, der dänische Freund und ein einheimischer Steuermann hocken im Motorboot und sind ratlos.
Weiter draußen sehen sie ein Pärchen in einem Kajak. Die zwei scheinen gegen eine Strömung anzukämpfen, die sie hinauszieht. Dann werden sie plötzlich von einer klein aussehenden Welle wieder in die Lagune gespült. "Sie scheinen Spaß zu haben", denkt Simmonds noch. Dann ist der Tsunami da.

Plötzlich taumelt ihr Motorboot am Fuß einer zehn Meter hohen Wasserwand, die sich scheinbar aus dem Nichts aufgebaut hat und nun in einer Breite von mindestens einem Kilometer auf den Strand zurast. "Bring uns hier raus!", schreit Simmonds zum Steuermann. Doch obwohl der Vollgas gibt, wird das Boot zur Welle hingesogen - dann scheint die Woge direkt über ihnen zu kollabieren.
Simmonds zieht den Kopf ein, wird aus dem kenternden Boot geschleudert. Als Taucher weiß er, dass es keinen Sinn hat, gegen eine Strömung anzuschwimmen, zu groß ist die Kraft des Wassers. Er kämpft sich hoch - und hat Glück, in der Nähe eine Rettungsweste zu erblicken, die wahrscheinlich aus ihrem gekenterten Boot gefallen ist. Er kann sie greifen. Dann wird er von der Welle mitgerissen - weit hinein ins Land.
Eine Schwimmweste wird zur Rettungsboje
Die Strömung treibt ihn direkt auf die Gebäude des Cabana-Hotels zu. Er verfängt sich in einer Balkonbrüstung im ersten Obergeschoss - und steckt fest, unter Wasser. Doch Simmonds klammert sich mit aller Kraft an die Schwimmweste.
Und die zieht ihn schließlich wieder zur Oberfläche. Er wird weitergewirbelt, treibt hinter die Rückseite des Hotelkomplexes. Erst hier findet er die Kraft, bis zu einem Baum zu schwimmen und an ihm hochzuklettern. Simmonds ist gerettet.
Auch Eugene Kim, 34, und Faye Linda Wachs, 35, haben Glück. Das Ehepaar aus Santa Monica in Kalifornien taucht, einige Seemeilen Luftlinie von Simmonds entfernt, in etwa 20 Meter Tiefe zusammen mit einem Tauchlehrer, als alle drei plötzlich von einem Sog noch weiter hinuntergesaugt werden.
Sand vom Ozeanboden wird aufgewirbelt. Alles ist weiß. Kim wird von seiner Frau und dem Tauchlehrer getrennt und herumgestoßen. Er kracht in ein sieben Jahre altes Wrack am Meeresgrund, dann gerät er in die Tentakeln giftiger Quallen, die ihm Hals, Brust, Arme und Schultern verbrennen.
Mühsam kämpft er sich hoch. Andernorts vor der Küste, etwa in der berühmten Emerald Cave weiter im Süden, werden in jenen Augenblicken manche Taucher für immer in die Tiefe gezogen. Die beiden Kalifornier jedoch haben Glück: Am Boot trifft Kim seine Frau wieder. Sie umarmen sich. Noch aber wissen die beiden nicht, was wirklich geschehen ist. Vieleicht sind sie in eine seltsame, gefährliche Strömung geraten.
Im Meer treiben Tüten, Decken, Teppiche. Und Tote
An der Meeresoberfläche jedenfalls ist alles ruhig geblieben. Doch als sie mit dem Boot Richtung Ko Phi Phi fahren, erblicken sie im Meer, noch rund acht Kilometer vor der Küste, Wasserflaschen, Holzstücke, Plastiktüten, einen Stuhl auf den Wellen. Dann Bettdecken, Teppiche, einen Fußball. Dann rund 40 losgerissene Vergnügungs-, Tauch- und Fischerboote.
In diesem Augenblick erhält ein schwedischer Tourist an Bord ihres Bootes eine SMS auf seinem Handy. Seine Frau informiert ihn, es habe "eine Katastrophe" gegeben. "Was meinst du damit?", sendet er zurück.

Als Antwort kommt nur ein Wort: "Tsunami." Auf dem Wasser treiben jetzt Brieftaschen, Rucksäcke, Badelatschen, Bambusrohre. Und dann Körper. Der erste ist eine männliche Leiche mit Verletzungen an Hals, Rücken, Armen und Beinen. Den beiden Kaliforniern gelingt es, den Körper mit einem Seil am Boot zu befestigen. Dann erblicken sie den Leichnam eines Teenagers. Und dann ein totes Kleinkind.
Als sie die Tsunamiwelle sehen, ist es zu spät
Fast überall an Thailands Südwestküste ist das Wasser kurz zuvor ungewöhnlich weit zurückgegangen. Touristen und Einheimische waten in bis dahin überfluteten Riffen und sammeln exotische Fische, die sich auf Felsen und Korallen winden. Viele sehen da schon den Tsunami: eine blauschwarze Wand am Horizont. Doch es dauert mehrere Sekunden - Sekunden, in denen die Menschen plötzlich in ihren Bewegungen innehalten und schweigend hinausstarren -, bis die Ersten begreifen, dass dort eine Wasserwand auf sie zukommt. Und dass sie rasend schnell ist.
Da ist es für viele schon zu spät. Nur wenigen gelingt es, dem Wasser davonzulaufen. Christianna Savino, 20, und ihr Freund Jake Duhart, 21, etwa haben die Welle früh kommen sehen. Die beiden Amerikaner arbeiten als Lehrer in Bangkok. Sie sind begeisterte Freeclimber - und hängen in jenem Moment gerade in den Klippen am Strand von Rai Le bei Krabi, etwa 13 Meter hoch über dem Meer.
Von hier aus gleicht die Welle nicht einer dunklen, sondern einer weiß wirbelnden Wand aus Wasser. Die beiden Lehrer lassen sich eilig die Klippe hinunter und laufen vom Strand aus wieder auf höheres Land - gerade noch rechtzeitig.
Doch schon die erste von zwei Wellen, die, je nach Küstenabschnitt, 6,50 bis zehn Meter hoch sind, reißt die meisten der Fliehenden von den Beinen und spült sie tief hinein ins Land. Dort treffen die wirbelnden Wasser die Menschen gänzlich unvorbereitet.
Ein Klettergerüst für Kinder rettet zwei Männer
Patrick Green und Becky Johnson wollen gerade abreisen. Die beiden 28- jährigen Lehrer an der amerikanischen Schule in Singapur stehen mit ihrem Gepäck im Aufzug ihres Hotels, als sie ein beunruhigendes Rumpeln hören. Dann menschliche Schreie. Das Licht im Fahrstuhl flackert. Als der Lift schließlich unten zum Halten kommt und die Türen zurückgleiten, ergießt sich schmutziges Wasser in die Kabine. Die Lobby des Hotels steht bereits hüfthoch in schäumenden Fluten. Die beiden kämpfen sich ins Freie: Draußen wirbeln Bäume, Tische, Autos, Menschen vorbei.
Ein Spielplatz wird Patrick Green und Becky Johnson zur Rettungsinsel. Den beiden gelingt es, sich an ein Gerüst zu klammern und sich daran bis über den Wasserspiegel hochzuhangeln.
Phra Ajarn Toys Lebensretter ist eine massive Kabeltrommel. Der Abt betet mit seinen Mönchen und mit Gläubigen im Kloster, als er von draußen ein Grollen vernimmt. Augenblicke später stürzt eine Wand ein, niedergerissen von der anströmenden Woge. Der Abt wird herumgerissen und unter Wasser gedrückt.
Buddhastatuen, goldene Vasen und mit Perlmutt belegte Gabentische nimmt die Flut mit. Phra Ajarn Toy kommt nur für wenige Augenblicke an die Oberfläche, schnappt nach Luft, wird dann wieder hinabgesogen. Dreimal.
Dann bekommt er eine große Kabeltrommel zu fassen, auf die er sich hochziehen kann. Er ist mit seinen Kräften am Ende und erbricht Salzwasser, aber er ist den Wirbeln entkommen.
Nur das Glück entscheidet über Leben und Tod
Für Tausende an Thailands Küste, Touristen wie Einheimische, ist die Frage von Leben und Tod in diesen Minuten eine des Glücks. Wer eine herumwirbelnde Rettungsweste packen kann, ein Klettergerüst, eine Kabeltrommel, der kommt davon. Wer nichts ergreifen kann, wird unter Wasser gedrückt oder von der nach wenigen Minuten wieder zurückfließenden Welle unentrinnbar weit aufs Meer hinausgezogen. Taucher können an einer Stelle der Strömung entkommen - ein paar Seemeilen weiter dagegen nicht.
Bootsfahrer und Fischer, die genug Wasser unter dem Kiel haben, spüren fast nichts - wer nur einige Meter näher an der Küste fährt, ist verloren.
Nur wenige sind in jenen Minuten in einer Position, in der sie ihr Leben noch selbst in die Hand nehmen können und nicht der Naturgewalt gänzlich ausgeliefert sind. Sie können auf die Gefahr reagieren und sich richtig verhalten - oder fatal falsch.
"Rennt, so schnell ihr könnt!"
Das Volk der Morgan etwa gehört, vergleichbar den Völkern auf den Andamanen und Nikobaren, ebenfalls zu den Ureinwohnern Asiens. Die rund 180 Menschen leben auf der kleinen Insel Surin Tai - wenn auch längst nicht mehr so isoliert wie die Gruppen auf den indischen Eilanden. Warnsignale von Tieren haben sie nicht bemerkt. Doch als sich das Wasser zurückzieht, schreit der Dorfälteste Salaman: "Rennt, so schnell ihr könnt! Das Wasser kommt!" Die Morgan eilen aus ihren am Strand errichteten Strohhütten ins Binnenland.
Ihr Dorf und ihre Fischerboote werden zerschmettert - doch sie selbst entkommen der Welle.
Auch der Sohn des Fischers Rin Riebroy weiß das zurückweichende Wasser richtig zu deuten. Rin Riebroy und sein Sohn stehen an Bord des 20 Jahre alten Kutters "Rungsiri" im Hafen von Ban Nam Khem. Da fällt der Pegel von sieben auf zwei Meter.
Der Sohn hat vor einiger Zeit einen TV-Bericht über Tsunamis gesehen - jetzt ist es so weit, denkt er. Sein Vater wendet in aller Eile, will hinaus aufs offene Meer. Doch der alte Kutter ist zu träge. Die erste Welle erwischt die "Rungsiri" im Hafen, der 61 Jahre alte Fischer wird herumgeschleudert und schlägt sich die Schläfe blutig. Als er wieder zur Besinnung kommt, stellt er fest, dass sein Schiff noch schwimmt. Nur weiter!
Als nach einigen Minuten die zweite Welle herandonnert, wird die "Rungsiri" um neun Meter angehoben. Doch sie bleibt auf Kurs. Vater und Sohn steuern den Kutter durch den Tsunami hinaus auf die rettende hohe See.
60 Schiffe liegen an jenem Morgen im Hafen. Dank der Vorahnung des Sohnes und des gewagten Manövers des alten Fischers ist die "Rungsiri" eines von nur zweien, die nicht zerschmettert werden.
Neugier wird zum Todesurteil
Doch für manche Menschen wäre es besser gewesen, wenn die Welle ihnen keine Zeit zum Nachdenken gelassen hätte: Die 46 Jahre alte Sucharee Taolek etwa ist Lehrerin im Bezirk Suksamran.
An diesem Sonntagmorgen unterrichtet sie zwölf Schüler im Thai-Tanz; sie üben für Feierlichkeiten zum bevorstehenden Neujahrsfest. Ihre Schule liegt höher als der Strand und damit vergleichsweise sicher. Als Sucharee Taolek jedoch die Welle erblickt - "ein Vorhang aus Wasser auf dem Weg zum Ufer", wird ein Augenzeuge den Anblick des Tsunami hier später beschreiben -, ruft sie ihre Schüler zusammen, um dieses Schauspiel aus der Nähe zu betrachten.
Sie geht mit ihnen hinunter, der Welle entgegen. Die Lehrerin und neun ihrer Schüler bezahlen diesen Leichtsinn mit ihrem Leben. Sucharee Taoleks Körper wird man später rund einen Kilometer weit fortgespült von ihrer Schule finden.
Ein namenloses blondes Kind sucht seine Eltern
Andernorts haben Kinder mehr Glück. In Ban Nam Khem wird der dreijährige Wathanyu Suthipong von der Welle in den Wipfel eines Mangrovenbaumes gespült, wo er drei Tage lang überleben wird, bis ihn zufällig die Crew eines Polizeibootes entdeckt.
Der zweijährige Hannes Bergström, Sohn eines schwedischen Ehepaares, wird nach dem Tsunami allein an einer Straße bei Khao Lak aufgelesen. Seine Haut ist stellenweise abgeschürft, er hat Moskitostiche, ist aber ansonsten unverletzt. Niemand weiß, wie er dorthin gekommen ist - und zunächst ahnt auch keiner, wer der Junge ist.
Das Foto des namenlosen blonden Kindes wird im Internet veröffentlicht - und ein Onkel in Göteborg erkennt es wieder. Hannes Bergström, einmal identifiziert, kann kurz darauf von seinem Vater in die Arme geschlossen werden, der verletzt in einem Krankenhaus von Phuket liegt. Seine Mutter jedoch wird er nie wiedersehen.
Susanne Bergström gehört zu den fast 8500 Toten, die der Tsunami in Thailand fordert. Knapp ein Drittel von ihnen sind Touristen - jene devisenbringenden Fremden, deren Ruhe zuliebe niemand beim thailändischen Meteorologischen Dienst gewagt hat, vor der zerstörerischen Welle Alarm zu schlagen.
Um diese Zeit werden auch Thailands Nachbarstaaten Malaysia, Myanmar (Birma) und Bangladesch getroffen - doch weitaus weniger hart.
Ein Baby verschläft die Katastrophe
Am Batu-Ferringhi-Strand auf Pinang, einer Insel vor Malaysias Küste, spült das Meer plötzlich durch das Haus der Familie Suppiah. In wenigen Momenten steigt das Wasser anderthalb Meter hoch, die beiden Eheleute werden fortgerissen - zurück bleibt ihr 20 Tage altes Baby. Die Mutter kämpft gegen die Strömung an, dringt wieder in ihr Haus ein - und findet ihr Kind, immer noch schlafend, auf einer Matraze, die wie ein Rettungsfloß in den überspülten Räumen treibt.
Das Glück des schlafenden Babys ist Symbol für das - relative - Glück eines ganzen Landes. Denn in Malaysia kommen nur 74 Menschen ums Leben - mehr als 50 davon allein auf der Ferieninsel Pinang. Auch hier werden Menschen vom Strand gerissen oder in plötzlich überfluteten Häusern gefangen. Insgesamt aber kommt das Land vergleichsweise glimpflich davon, denn Sumatra liegt wie ein riesiger Wellenbrecher vor dem größten Teil Malaysias und fängt die Gewalt des Tsunami ab.
Myanmar wiederum liegt weiter im Norden - dort, wo die Wellenwand weniger zerstörerisch ist, weil der davor liegende Meeresboden sanft ansteigt, sodass die Welle Energie verliert. Der Staat gehört zu den am stärksten isolierten Ländern der Welt. Seit Jahrzehnten beherrscht eine Junta das Land. Tagelang berichtet Myanmars Staatsfernsehen nicht über den Tsunami, der fast alle Nachbarländer heimgesucht hat. Schließlich gibt die Regierung offiziell bekannt, dass 64 Menschen ertrunken seien, vor allem Fischer. Satellitenaufnahmen zeigen später, dass Myanmars Küste tatsächlich sehr viel weniger verwüstet ist als die vieler anderer Anrainerstaaten des Indischen Ozeans.
Bangladesch kommt glimpflich davon
In Bangladesch schließlich kommen nur noch Ausläufer des Tsunami an. Ein Boot kentert, zwei Kinder ertrinken. Diesem Land, das in seiner Geschichte immer wieder von katastrophalen Monsunregen überflutet worden ist, bleibt wenigstens die Riesenwelle erspart.
Sumatra, die Andamanen und Nikobaren, Thailand, Malaysia, Myanmar, Bangladesch: Innerhalb von rund drei Stunden hat der nach Osten drängende Tsunami ihre Küsten erreicht, sie verheert und an den Landbarrieren schließlich seine Kraft verloren. Das Meer hier ist wieder ruhig.
Doch in Richtung Westen läuft ebenfalls eine ähnlich zerstörerische Wasserwand: schnell wie ein Düsenflugzeug, bislang ungehindert von irgendeiner Landmasse - und weiterhin unentdeckt.
91 Minuten nach dem Beben
Pacific Tsunami Warning Center, etwa 16.30 Uhr Ortszeit, 91 Minuten nach dem Erdbeben: Direktor Charles McCreery und die beiden Wissenschaftler Weinstein und Hirshorn werden immer unruhiger. Irgendetwas geht im Indischen Ozean vor. Nur was? "Wir haben keine Namen in unserem Adressbuch für diesen Teil der Welt", wird sich McCreery später rechtfertigen.
Wie sollen drei Männer an einem weihnachtlichen Sonntagnachmittag, in einem fensterlosen, kleinen Zweckbau irgendwo auf Hawaii, plötzlich Millionen Menschen alarmieren? Und wovor soll man sie warnen? Viel mehr als ein ungutes Gefühl haben McCreery und seine Mitarbeiter schließlich nicht.
Einer der Forscher im PTWC hat die Telefonnummer von einem Mitarbeiter des australischen Wetterdienstes - doch der meldet sich nicht: Weihnachtsferien. Die Männer auf Hawaii finden schließlich die Telefonnummer des australischen Katastrophenschutzes heraus.
Ja, bestätigen die Australier, sie wüssten von dem Erdbeben vor Sumatra. Mehr ahnt man dort aber auch nicht.
2,31 Stunden nach dem Beben
Madras Atomic Power Station (MAPS, Kalpakkam, gegen 9.00 Uhr Ortszeit, 2.31 Stunden nach dem Beben:
Im Pumpenraum des Reaktors steigt das Wasser plötzlich alarmierend schnell an.
Die Anlage an der Küste des Bundesstaates Tamil Nadu, rund 70 Kilometer südlich der Millionenmetropole Chennai, besteht aus zwei je 170 Megawatt leistenden Atomreaktoren. Der 1986 in Dienst gestellte ältere Meiler ist zurzeit wegen Wartungsarbeiten heruntergefahren, der zwei Jahre jüngere hängt am Netz. Neben den beiden Atomreaktoren gehören sieben weitere Anlagen zum Komplex, unter anderem Zwischenlager für verbrauchte Brennstäbe. Das Meer ist rund ein Kilometer entfernt.
"In Indien gibt es keine Tsunamis."
In einer Risikostudie für das indische Atomenergieministerium haben dessen Experten 1987 apodiktisch verkündet: "In Indien gibt es keine Tsunamis." Deshalb ist die Anlage nicht gegen Flutwellen gesichert - obwohl bereits 1999 der indische Seismologe Arun Bapat in der internationalen Fachzeitschrift der Tsunami-Forscher vor genau dieser Gefahr gewarnt hat.
Mehr noch: Weiter südlich, ebenfalls im Bundesstaat Tamil Nadu, wird seit März 2002 an zwei 1000-Megawatt- Reaktoren russischen Typs gebaut; hier soll bis zum Jahr 2007 Indiens erster "Schneller Brüter" ans Netz gehen. Dieser Komplex bei Kudankulam liegt nur 5,60 Meter über dem Meeresspiegel.
Der Tsunami, der Indiens Ostküste nun trifft, bäumt sich bis zu neun Meter hoch auf.
Im Pumpenhaus der MAPS enden unterirdische Leitungen, die Meerwasser zur Kühlung der Kondensatoren heranführen. Als hier durch die herandrängende Welle das Niveau binnen Sekunden ansteigt, reagiert ein Techniker rasch: Er betätigt die Notabschaltung.
Während MAPS-2 herunterfährt, erreicht die Welle bereits den nahe gelegenen Fischerort Kalpakkam. 250 Menschen ertrinken. Dann flutet der Indische Ozean nach Sadras, einer nur sechs Kilometer neben den Meilern errichteten Siedlung, in der viele Mitarbeiter des Atomkraftwerkes leben: 30 Opfer. Und das Wasser steigt.
Später, nur Stunden nach dem Desaster, wird der Chef der indischen Atomenergiebehörde eilig versichern, dass von der überfluteten Anlage keinerlei Radioaktivität ausgetreten sei. Nicht von den Reaktoren, nicht von den Lagerstätten.
Ein Atommeiler im Bau wird getroffen
Doch die Regierung wird nicht bekannt geben, welche Schäden die Flutwelle in den Meilern und den Nuklear- Lagerstätten angerichtet hat. Unabhängigen Experten wird der Zugang zur Madras Atomic Power Station bis heute verwehrt.
Indiens Küsten sind etwa 7500 Kilometer lang. Ein gutes Zehntel wird vom Tsunami verheert. Am schlimmsten trifft es den Bundesstaat Tamil Nadu im Südosten.

Hier liegen Hunderte Fischerdörfer, meist Ortschaften aus Lehm- und Strohhütten wenige Meter hinter dem Strand. Doch hier erhebt sich auch Chennai, eine Vier-Millionen-Metropole. Die bedeutendste Stadt, die an diesem Tag von dem Tsunami getroffen wird.
Ginge es nach dem Gesetz, wären viele Menschen geschützt. Die "Coastal Regulation Zone Notifications" sehen vor, dass in einem Streifen von 500 Meter Breite entlang des Meeres gar nicht oder nur unter strengen Auflagen gebaut werden darf. Ziel dieses Gesetzeswerkes ist vor allem der Schutz des fragilen Ökosystems der Küste. Ein, wenn auch ungeplanter, Nebeneffekt wäre allerdings auch eine recht wirkungsvolle Protektion vor Tsunamis.
Die Fischer, sofern sie überhaupt je von diesem Gesetz gehört haben, scheren sich jedoch nicht darum. Und die Regierung hat nie ernsthaft versucht, diese Regeln durchzusetzen.
Das schwarze Wasser donnert
Doch selbst wenn die Autoritäten strenger gewesen wären - in Chennai würde es niemandem helfen. Hier ist der über fünf Kilometer lange Marina Beach schon seit den Morgenstunden voll: Fischer, die von nächtlicher Ausfahrt zurückkehren und nun ihre Netze flicken, Fischverkäufer, Spaziergänger, Kricketspieler, fliegende Händler, mobile Barbiere, die ihre Kunden am Wegesrand rasieren.
Der Morgen ist vergleichsweise kühl und sonnig. Plötzlich kommen einige kleine Wellen, die etwas höher am Strand auflaufen als gewöhnlich. Und dann, wie aus dem Nichts, die Wand aus Wasser.
Viele Überlebende entlang Indiens Südostküste werden später berichten, sie sei bedrohlich, donnernd und tiefschwarz gewesen. Und tatsächlich wird vielen Menschen bei ihrem verzweifelten Ringen nach Luft nicht nur Salzwasser in die Lungen dringen, sondern auch im Meer aufgewirbelter Schlamm.
In Chennai sind es zwei Wellen im Abstand von ungefähr einer Stunde, die über den langen Strand hereinbrechen. Die Boote, Motorräder und Autos durcheinander wirbeln, sie noch über den hinter dem Strand verlaufenden Prachtboulevard fegen und in die Häuser der Metropole krachen lassen. Mehr als 200 Menschen reißen sie allein hier davon: Kricketspieler, die sich nirgendwo festhalten können, Kinder, eine Touristenfamilie aus Nepal. Im Hafen der Stadt werden drei Frachter von ihren Kais losgerissen und kollidieren im Becken. Kräne und andere Einrichtungen zum Be- und Entladen der Schiffe kollabieren.
Der Tsunami lässt Flüsse rückwärts fließen
Zwei Flüsse winden sich durch die Metropole. Die Gewalt des Tsunami drückt ihr Wasser zurück. Das Schauspiel, dass die Flüsse plötzlich "rückwärts" fließen, und die Gerüchte, die sofort durch die Stadt eilen, machen Unzählige neugierig. Bald sind die Straßen verstopft von Schaulustigen, die zum Strand eilen wollen, um das Schauspiel zu sehen. Die Polizei muss Knüppel ziehen, um die Wege freizuhalten. Aber immerhin bleiben in der Metropole Infrastruktur und öffentliche Ordnung erhalten.
In Hunderten von Fischerdörfern entlang der Ostküste Indiens wiederholt sich dagegen das Drama von Sumatra: Unvermittelt reißt die Welle Menschen aus dem Leben und vernichtet Häuser fast spurlos.
In Ganagachettikullam im Unionsterritorium Pondicherry ist die 18 Jahre alte Ranjani allein mit ihrer dreijährigen Schwester Anusuya zu Hause. Die Eltern sind auf den Markt gegangen, um den Fischfang des frühen Morgens zu verkaufen.
Ranjani kocht gerade eine Mahlzeit, als die kleine Schwester plötzlich zu ihr rennt und sich an ihre Kleidung klammert. Die junge Frau sieht auf - und starrt auf die Welle. Ranjani packt die Dreijährige und steigt auf einen Stuhl.
Ein Hund hält ein Mädchen bei den Haaren
Doch das Wasser steigt und steigt, bald füllt es das ganze Haus. Ranjani klammert sich mit einer Hand an einen Balken unter dem Dach, mit der anderen hält sie Anusuya fest. Irgendwann ist die Kleine verschwunden.
Ranjani schreit um Hilfe, doch niemand kann sie erreichen. Irgendwie hält sie durch und überlebt. Ihre kleine Schwester jedoch wird man erst Stunden später finden, einen Kilometer weiter landeinwärts. Tot.
Im Dorf Tiruvanmiyur wird die 40-jährige Pankajavalli bei ihrem Strandspaziergang vom Wasser eingeholt. Als sie sich in einem Fischernetz verfängt, hat sie keine Chance mehr.
Mehr Glück hat dagegen die zehn Jahre alte Kutti aus dem Dorf Tarang Badi: Als die zurückweichende Woge sie ins Meer hinauszuziehen droht, verbeißt sich der Hund der Familie in ihren Haaren und hält sie am Strand zurück.
Auch der Fischer Pemmadi Kaya Raju von der Insel Bhairavapalem kommt noch einmal davon. Er stürzt in den Hafen, wo die Wogen losgerissene Schiffe durcheinander wirbeln. Ein anderer Fischer springt hinterher in die tosende See und zieht ihn wieder in Sicherheit: Pesangi China Govaraju.
Der 35-jährige Govaraju hat leidvolle Erfahrung mit Naturgewalten: 1996 verlor er während eines Zyklons seine 14-köpfige Familie, darunter seine Frau und seine beiden Kinder. "Ich wollte nicht noch einmal sehen, wie ein Mensch davongeschwemmt wird", wird er später seine Tat begründen.

Die Schäden jener Stunde, in welcher der Tsunami Indiens Ostküste verwüstet, belaufen sich auf viele hundert Millionen Euro - weitaus mehr, als ein Tsunami-Warnsystem gekostet hätte.
Fast 9000 Menschen kommen hier ums Leben, Zehntausende verlieren ihr Daheim. Gewarnt hat sie niemand. Fast niemand. Denn erst sechs Minuten, bevor die Welle das indische Festland treffen wird, versucht der indische Meteorologische Dienst, die Regierung zu informieren.
Doch das Fax der Forscher wird an den nicht mehr amtierenden Minister für Wissenschaft und Technik geschickt. Um 9.14 Uhr Ortszeit erreicht die Warnung der Meteorologen schließlich das Katastrophenzentrum im indischen Innenministerium in Neu-Delhi.
Sirenen warnen vor dem Tsunami
Eine Viertelstunde zu spät. Im Fischerdorf Nallavadu jedoch ist eine Warnung rechtzeitig angekommen. Vijayakumar, ein Mann, der früher eine Zeit lang als Ausbilder in dem Dorf gewirkt hat, arbeitet nun in Singapur.
Und dort sind die Tsunami-Meldungen aus Sumatra und Thailand inzwischen über die Medien an die Bevölkerung weitergegeben worden. Vijayakumar ruft in seiner ehemaligen Schule in Nallavadu an. Binnen Minuten heulen dort Sirenen, und über Lautsprecher werden die Menschen gewarnt.
Die Einwohner eilen weg vom Meer. Als die Welle kommt, ist niemand mehr am Strand. Mehr als 3600 Einwohner hat Nallavadu, keiner von ihnen stirbt. Es ist die erste Ortschaft überhaupt, die rechtzeitig gewarnt wird.
2,31 Stunden nach dem Beben, Sri Lankas Osten
2.31 Stunden nach dem Beben: Als Südindien getroffen wird, entfaltet sich im Osten Sri Lankas bereits seit über einer halben Stunde ein Drama. Der Fischer Anqusauy Parameswaran sitzt noch immer in seinem Haus und liest Zeitung.
Seine Frau Patiusnayagie, die Essen kocht, horcht plötzlich auf. "Was ist das?", fragt sie. Es ist das Letzte, was Parameswaran von ihr hören wird. Dann kracht die Welle in ihr Haus.
Sri Lanka liegt rund 1600 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Doch noch immer ist die Wasserwand fünf, sechs, vielleicht auch zehn Meter hoch. Sie trifft die Ostküste der Insel gut eine Viertelstunde früher als die Gestade Indiens, und sie richtet hier noch ungleich größere Verwüstungen an.
Der Schlag der Welle erschüttert Parameswarans Haus. Im Zimmer steigt das Wasser rasend schnell an - bis die Wände des Bauwerks unter dem Druck der Wirbel kollabieren. Der Vater greift nach seinem jüngsten Sohn. Dann wird er von einer einstürzenden Wand unter Wasser gedrückt.
Mit letzter Kraft kämpft sich Parameswaran wieder an die Oberfläche - sein Jüngster aber ist verschwunden. Die Welle nimmt den Fischer mit.
Der Tsunami zieht Menschen Richtung Meer
Auch die Tochter Mary Ranistala wird aus den Trümmern ihres Elternhauses gespült. Sie erhascht noch einen Blick auf ihre Mutter, die von einem Stück Mauer getroffen wird, bevor der Tsunami die 15-Jährige fortreißt - einen Kilometer hinein ins Landesinnere.
Einige Augenblicke später, als die Welle wieder abfließt, wird Mary Richtung Meer gezogen. Ihr gelingt es, eine der letzten am Ufer stehenden Palmen zu packen und sich an den kräftigen Blättern hochzuziehen.
Anqusauy Parameswaran kann ebenfalls eine Palme packen und sich retten, kaum 100 Meter entfernt. Doch Vater und Tochter wissen nichts voneinander.
Und die anderen fünf Familienmitglieder sind verschwunden. Auch Philip, der Sohn, der später einmal studieren soll.
Von den 20 Millionen Einwohnern Sri Lankas gehören mindestens 170 000 zu Fischerfamilien. Der Tsunami tötet in diesen Minuten fast jeden Zehnten von ihnen: Männer, Frauen, Kinder. Die zwei Wellen, die 500 bis 1500 Meter weit ins Innere vordringen, zerstören Zehntausende Häuser, Tausende von Booten und zahlreiche wichtige Häfen.
In Sri Lanka werden Landminen freigespült
72 Schulen und 85 Moscheen der muslimischen Gemeinschaft werden vom Wasser niedergerissen. Der Hindu-Tempel in Thiruchendoor stürzt ein. Im nahe gelegenen Gayathri-Sittar-Tempel, einem populären Wallfahrtsort direkt am Meer, verschwinden Betende im Wasser.
Eine unbekannte Zahl von Bunkern und Waffenlagern der tamilischen Befreiungsbewegung wird geflutet. Landminen, ausgelegt von Rebellen oder Regierungssoldaten, werden vom Meer freigespült und in andere Regionen getragen - eine noch auf Jahre tödliche Hinterlassenschaft des Tsunami.
In Kilinochchi kollabiert das Senthalir-Illam-Waisenhaus. Von den 151 Kindern dort überleben nur 38.
Etwa in diesen Minuten machen sich Thomas Elmerhaus und seine Frau Anna Lechner in ihrem Hotel auf den Weg vom Frühstücksraum zum Strandbungalow, um sich umzuziehen für die Ayurveda-Massage. Sie ahnen nichts von der Katastrophe.

Denn Sri Lanka gleicht, aus der Luft betrachtet, einem großen Regentropfen: Die Nordseite ist vergleichsweise spitz, im Süden folgt die Küstenlinie ungefähr einer halbrunden Form. Spitz zulaufende Landmassen - das Nordende Sumatras etwa oder der südliche Zipfel Indiens - wirken wie gigantische Wellenbrecher:
An ihrer Front prallt die Woge mit aller Gewalt gegenan, auf der Rückseite hingegen bleibt der Ozean nahezu still. Um die geschwungene Südküste Sri Lankas kann die Welle jedoch herumlaufen: Sie wird nicht gebrochen, sondern abgelenkt wie ein langes Stück Garn, das sich um eine Spule wickelt. So wird, bis auf eine Region im Nordwesten, fast die ganze Insel von dem Tsunami umspült.
Dafür allerdings benötigt die Welle Zeit: Zwischen dem ersten Anprall an der östlichsten Küste Sri Lankas und ihrem Anmarsch an der Südwestküste liegen gut 30 Minuten.
Eine halbe Stunde - das wäre immer noch ausreichend Zeit, um große Teile der Küste zu evakuieren. Wenn denn jemand die Menschen dort warnen würde.
2,31 Stunden nach dem Beben, Sri Lankas Südwestküste
Barberyn-Reef-Hotel in Beruwala, Südwestküste Sri Lankas, 9.30 Uhr Ortszeit, 2.31 Stunden nach dem Beben: die plötzliche Stille.
Thomas Elmerhaus blickt auf die Einheimischen, die vom Strand Richtung Horizont starren, und dann ebenfalls zum Ozean. Das Meer strömt auf ihn zu.
Hier an diesem Küstenabschnitt kommt der Tsunami nicht als Wasserwand an, sondern es ist eher so, als würde der Ozean einfach überschwappen.
Elmerhaus steht auf. "Sieh dir das an!", ruft er seiner Frau zu, die sich noch im Bungalow befindet. Er macht sich keinerlei Sorgen und denkt nur an ein seltsames Naturphänomen. Dann ist das Wasser da.
Anna Lechner kommt gerade noch rechtzeitig aus ihrem Häuschen, um zwei einheimischen Jungen und einer spindeldürren japanischen Touristin über den kleinen Steinwall am Strand zu helfen - im wirbelnden braunen Wasser bereits ein formidables Hindernis.
Anschließend rettet sie sich mit der Japanerin, den Jungen und weiteren Touristen auf die Rückseite eines Bungalows. Dort befinden sich ungefähr ein Meter hohe, gemauerte Sockel, auf denen normalerweise leere Getränkeflaschen abgestellt werden. Binnen Sekunden umspült das Wasser auch hier ihre Waden.
Die Flut drückt die Fenster ein
Thomas Elmerhaus hat es in diesen Augenblicken irgendwie in einen Strandbungalow verschlagen, zusammen mit einer weiteren Touristin. Die beiden stemmen die Tür gegen den Wasserdruck zu und verkeilen sie mit Liegen. Gleich darauf aber drückt die Flut die Fenster ein. Nur raus!
Er hilft der Frau, die ihre Kontaktlinsen verloren hat und nicht mehr klar sehen kann. Einige Dutzend Meter hinter den Bungalows erhebt sich das Hauptgebäude des Hotels, in dem sie gerade noch gefrühstückt haben. Das Wasser scheint ruhiger zu fließen: Elmerhaus und die Touristin schlagen sich bis dorthin durch, Anna Lechner und ihre kleine Gruppe ebenfalls. Im Hauptgebäude hasten sie hinauf ins erste Stockwerk. Vorerst gerettet.
Die Hamburger Psychologin ist bereits hysterisch und beklagt in ununterbrochener Litanei den Verlust ihrer teuren Handtasche. Anna Lechner sieht mehrere der jungen Mädchen, die sonst im Hotel arbeiten. Einige weinen.
Nach zehn Minuten zieht sich das Wasser wieder zurück. "Alles überstanden", denkt Elmerhaus. Die Gäste versammeln sich kurz an der Rezeption. Ein bunter Aufzug: die Japanerin in einem grellen, pinkfarbenen Bikini, Elmerhaus und seine Frau in alten Badesachen und barfuß, andere mit Schlamm-Masken im Gesicht. Die Hotelleitung bietet an, die Ausländer mit Minibussen zu anderen, vom Wasser nicht beschädigten Resorts zu fahren. Viele akzeptieren.
Das Wasser weicht. Dann kommt die zweite Welle
Anna Lechner und Thomas Elmerhaus kehren noch einmal zu ihrem Bungalow zurück. Ihre Sachen sind vom Wasser durchgeweicht - nur die neue Digitalkamera nicht; die lag auf einem Tisch, der im Wasser aufschwamm. Sie machen Bilder, für die Versicherung daheim.
Geld, ihre Papiere oder Gepäck raffen sie nicht zusammen. Warum auch? Ist doch alles vorüber, denken sie.
Doch als Elmerhaus noch einmal kurz zum Strand geht, fällt ihm Merkwürdiges auf: Draußen im Meer, an dem sich bislang die Wellen immer an einem Riff brachen, entdeckt er plötzlich zwei Riffe. Das zweite, tiefer liegende, war bis dahin stets überflutet gewesen. Nun liegt es vollständig trocken. Die ersten Touristen machen sich bereits auf den Weg, das Riff aus der Nähe zu erkunden. "Nur weg!", denkt Elmerhaus. Der Autolackierer weiß nicht viel vom Meer und so gut wie gar nichts von Tsunamis, aber das hier ist ihm unheimlich. Die beiden Hamburger gehen nicht aus dem Bungalow - sie fliehen.
Sie rennen einfach los, barfuß und fast nackt, vorbei an den anderen Bungalows, dem Hauptgebäude, dem Zaun, auf eine Schotterpiste, die in den Dschungel führt. Die Füße schmerzen, die schwüle Hitze ist fast unerträglich - aber nur weg vom Meer!
Mag sein, dass dies ihr Leben gerettet hat. Denn die zweite Welle kommt. Hier, an der Südwestküste, rund eine Stunde nach der ersten. Und sie ist stärker als diese.

Die zweite Welle überspült das Hotel. Viele Gäste - auch die gehbehinderte Deutsche - warten in diesem Moment gerade in einem vor der Rezeption geparkten Minibus, als dieser von braunem Wasser umspült wird. Verzweifelt reißen die Menschen die Schiebefenster auf und zwängen sich hinaus, um auf das Dach des Fahrzeugs zu gelangen.
Wie durch ein Wunder entkommen alle aus dem Inneren des Minibusses. Eine ältere einheimische Yogalehrerin schafft es nicht mehr bis auf das Dach, doch sie klammert sich an den Rückspiegel. Sie ist stärker als das Wasser.
Anna Lechner und Thomas Elmerhaus sind in diesem Moment bereits im Dschungel auf der Plattform eines Tempels, erschöpft und durstig, aber unverletzt. Für sie ist der Tsunami nur noch ein fernes Rauschen jenseits der Waldgrenze. Die Touristenorte an der Südwestküste Sri Lankas werden schwer getroffen.
Altkanzler Helmut Kohl entkommt. Unverletzt, aber schockiert
Im luxuriösen Hotel Paragon in Thalpe, nur einige Kilometer südlich des Resorts, in dem Anna Lechner und Thomas Elmerhaus wohnen, überflutet die Welle zwei Stockwerke. Der prominenteste Augenzeuge hier: Helmut Kohl, zu einem Kuraufenthalt im Haus - im dritten Stock. Der Altbundeskanzler entkommt unverletzt, aber schockiert. Die Verwüstungen, wird er später schreiben, erinnern ihn an schwere Bombenangriffe im Krieg.
Andere haben weniger Glück. In der alten Kolonialstadt Galle im Südwesten etwa. Die wird von einer gewaltigen Festungsmauer geschützt, welche die Holländer im 17. Jahrhundert ausgebaut haben. Sie bewahrt tatsächlich die Häuser in ihrem Inneren vor dem Ansturm des Wassers. Doch die Wellen laufen links und rechts entlang der Mauer einmal um die ganze Stadt herum - und treffen auf der dem Meer abgewandten Rückseite wieder zusammen. Dazwischen: der belebte Busbahnhof der Stadt.
Allein hier sterben auf einen Schlag über 200 Menschen. Sie ertrinken in gefluteten Bussen, werden von Fahrzeugen erschlagen oder von herumwirbelnden Glassplittern tödlich verwundet.
Ein Expresszug wird zur Falle
In der nahe gelegenen Stadt Hambantota fegt der Tsunami über den belebten Fischmarkt und nimmt Hunderte mit. Und zwischen der Hauptstadt Colombo und Galle stoppt die erste Welle einen voll besetzten Zug - den dann die zweite Welle, gleich einem stehenden Ziel, zerschmettert.
Samudradevi heißt der Expresszug Nummer 50 von Colombo nach Galle, "Königin des Ozeans". Und in der Tat: Die Diesellokomotive mag ein halbes Jahrhundert alt und kaum schneller als 40 km/h sein - die von den britischen Kolonialherren im 19. Jahrhundert angelegte Strecke jedoch ist königlich, denn sie führt unter Palmen dahin, immer in der Nähe des Meeres.
Um 7.10 Uhr sollte der Zug den Bahnhof Colombo Fort verlassen. Acht Waggons hat er, ausgelegt für jeweils 80 Reisende. Doch heute, an diesem Feiertag, drängen sich viel mehr Menschen als sonst auf den Gängen, zwängen sich gar unter die Sitze. Mindestens 200 Männer, Frauen und Kinder haben in jedem der Waggons irgendwie Platz gefunden.
Die "Königin des Ozeans" hat zwei Minuten Verspätung. Zwei fatale Minuten. Denn als die erste Welle anrollt, rennen panische Einheimische auf die Schienen, rudern mit den Armen, schreien und stoppen so den Zug kurz vor dem Dorf Hikkaduwa - rund 150 Meter entfernt vom Ozean und kaum einen Meter oberhalb des Meeresspiegels. Wäre der Zug pünktlich gewesen, hätte die Woge ihn an einer weniger exponierten Stelle heimgesucht.

So aber trifft die erste Welle den Zug, schüttelt ihn durch und schwappt einen Meter hoch in die Waggons. Dort herrscht Panik. Einige Menschen werden fortgespült, andere versuchen verzweifelt, irgendwie von den Fenstern auf das Dach zu klettern. Viele Einheimische aus Hikkaduwa klammern sich ebenfalls an die Waggons, die wie Inseln in der Welle stehen geblieben sind, während die Häuser im Dorf kollabieren.
Andere Fahrgäste behalten dagegen einen kühlen Kopf. "Keine Angst. Wir sitzen hier fest, aber das Wasser geht schon wieder zurück", beruhigt etwa die 25 Jahre alte Lanka Chandima ihren Vater, den sie per Mobiltelefon von dem Unglück unterrichtet hat.
Das schlimmste Zugunglück aller Zeiten
Doch da kommt die zweite, noch größere Welle. "Plötzlich waren 85 Prozent des Horizonts mit einer Wand aus Wasser ausgefüllt", wird einer der wenigen Überlebenden später berichten.
Die Woge packt die Waggons, wirft sie von den Schienen, reißt das Metall auf, schleudert manche Wagen bis zu 100 Meter weit. Auch die 80 Tonnen schwere Diesellokomotive wird 50 Meter vom Bahndamm getragen. Die hoffnungslos überfüllten, umgekippten Waggons verschwinden unter der sechs bis sieben Meter hohen Welle. Niemand vermag sich vorzustellen, was sich in diesen Sekunden in den Waggons abgespielt haben mag.
Viel später, als das Wasser wieder verschwunden ist und nur schlammbedeckte, verbogene Waggons zurückgelassen hat, wird man 1000 Tote zählen, dann 1300, 1500 . . . Keiner wird je genau wissen, wie viele Menschen in der Samudradevi gestorben sind. Sicher ist nur dies: Es ist das schlimmste Zugunglück aller Zeiten.
Etwa 150 Menschen haben sich retten können. Sie sind rechtzeitig aufs Dach gelangt und fortgespült worden. Die vier Jahre alte Mimani gehört zu den Glücklichen. Das Mädchen werden Retter später bergen und für tot halten. Ihr Großvater jedoch, der verzweifelt alle Leichenschauhäuser der Umgebung absucht, wird sie in einem finden, erkennen, dass sie nur verletzt ist, und die Totgeglaubte herausholen.
Lanka Chandima jedoch, die am Handy noch ihren Vater beruhigte, wird man erst nach drei Tagen bergen. Tot.
Niemand warnte die Menschen in Sri Lanka
Mehr als 36000 Menschen sterben in Sri Lanka. Es ist die schlimmste Naturkatastrophe in der Geschichte des Landes. Nach Indonesien ist Sri Lanka der Staat, der am härtesten von dem Tsunami getroffen wird. Doch anders als dort, wo nur wenige Minuten zwischen Erdbeben und Flutwelle verstrichen sind, wären hier mindestens anderthalb Stunden Zeit geblieben, um die Menschen zu warnen. Es hat nur niemand getan.
2,31 Stunden nach dem Beben, Hawaii
Pacific Tsunami Warning Center, 17.30 Uhr Ortszeit, 2.31 Stunden nach dem Erdbeben: Das Wissen um die tödliche Welle gelangt nicht von den Forschern zu den Menschen der bedrohten Gebiete, sondern geht den umgekehrten Weg: Erst durch die Betroffenen erfahren die Experten, was sich im Indischen Ozean abspielt.
Die drei Wissenschaftler im PTWC haben seit über einer Stunde den Nachrichtensender CNN eingeschaltet und studieren die ständig aktualisierten Newsmeldungen im Internet. Sie ahnen, dass irgendwo da draußen Schreckliches vor sich geht.
Gegen 17.30 Uhr liest Stuart Weinstein dann die ersten Meldungen im Internet: Tsunami in Sri Lanka. Da sie das Epizentrum des Bebens längst lokalisiert haben, wissen die Amerikaner, dass das entfernte Sri Lanka nicht das einzige betroffene Land sein kann. "Es werden noch mehr Menschen sterben", murmelt Andrew Hirshorn.
Sie greifen wieder zum Telefon, versuchen, Kollegen zu erreichen. Hat vielleicht irgendjemand eine Kontaktadresse im Indischen Ozean? Wen kann man warnen?
Ein improvisiertes Warnsystem
Gegen 17.45 Uhr spricht einer der drei Forscher mit dem Hauptquartier der US-Pazifikflotte auf Hawaii. Er informiert die Militärs über den Tsunami. Könne die Navy, die auch Einheiten im Indischen Ozean stationiert hat, vielleicht irgendetwas unternehmen?
Ungefähr in diesem Moment klingelt im PTWC ein Telefon. In der Leitung: ein Offizier der Marine von Sri Lanka. Endlich jemand vor Ort! Doch der Anruf des Offiziers offenbart zugleich die Ratlosigkeit, ja Verzweiflung dort: Der Offizier aus Sri Lanka fragt Weinstein und seine Kollegen, ob für seine Insel weitere Wellen zu erwarten seien. Es ist nicht ganz klar, was die Forscher antworten, aber vage wird ihre Reaktion auf jeden Fall ausgefallen sein. Was sollen sie, die nicht einmal die genaue Stärke des ersten, schweren Bebens kennen, schon an Prognosen abgeben können?
Etwas konkreter wird es gegen 18.00 Uhr. Da meldet sich der US-Botschafter in Sri Lanka im PTWC. Ob man eine Alarmkette für Nachbeben improvisieren könne? Endlich formt sich so etwas wie ein hastig zusammengestückeltes Warnsystem: Die drei Männer im PTWC werden von nun an alle seismischen Aktivitäten im Indischen Ozean überwachen.
Sollte es ein beunruhigend starkes Beben geben, werden sie die US-Botschaft in Colombo informieren. Die wiederum wird diese Warnung an die Regierung von Sri Lanka weitergeben. Das System beruht auf groben Schätzungen und ist langsam - aber es ist das erste im Indischen Ozean.
3,01 Stunden nach dem Beben, Seattle
Pacificmarine Environmental Laboratory, Sand Point Way, Seattle, Washington State, 20.00 Uhr Ortszeit, 3.01 Stunden nach dem Erdbeben: Seit einer Stunde liefert sich ein Mann ein aussichtsloses Wettrennen mit der 20 000 Kilometer entfernten Riesenwelle. Der Mathematiker Vasily Titov ist stellvertretender Direktor eines Projektteams, das die Ausbreitung von Tsunamis studiert.
Die Forscher in Seattle gehören zu den führenden Experten für dieses Phänomen. Die "Tsunameter" - jene Sensoren, die auf dem Meeresboden Riesenwellen aufspüren und weitermelden sollen - sind von ihnen entwickelt worden.
Vasily Titov ist, kurz nachdem vom PTWC die ersten Warnmeldungen eingegangen waren, in sein Labor geeilt. Er hat kein TV-Gerät angestellt, die News im Internet interessierten ihn nicht. Er weiß nicht, was im Indischen Ozean vor sich geht - und weiß es doch auch.
Viele Faktoren bestimmen den Weg einer Welle
Denn Titov ist, parallel mit einem Kollegen in Japan, der ebenfalls fieberhaft arbeitet, der erste Mensch, der sich daran macht, den Weg des Tsunami zu berechnen. Die Schwierigkeiten sind ungeheuer: Riesenwellen werden in ihrer Größe durch Stärke, Tiefe und Verlauf eines Erdbebens bestimmt. Hier schon muss Titov mit vielen vorläufigen Werten rechnen. Die Richtung, die eine Riesenwelle einschlägt, hängt dann zusätzlich von der Beschaffenheit des Meeresgrundes ab. Die Höhe, aber auch die Form von Unterwassergebirgen etwa können Wellen beeinflussen.
Titov, dessen Forschungen sich bis jetzt auf den Pazifik konzentriert haben, muss erst einmal ein Bodenprofil des gesamten Indischen Ozeans in seinen Computer laden. Dann folgen die vorläufigen Werte des Erdbebens. Schließlich Modellrechnungen, die auf der Beobachtung älterer Tsunamis im Stillen Ozean basieren. Millionen Daten, die in hochkomplizierten Rechenoperationen mit einer von einem russischen Spezialisten entwickelten Software verarbeitet werden müssen.
Für jeden Kilometer Ausbreitung des Tsunami müssen unzählige Daten berücksichtigt werden. Das kostet Zeit - und zwar so viel, dass die Berechnung der Ausbreitung eines Tsunami ungefähr so schnell vorangeht, wie sich der reale Tsunami im Ozean bewegt. Für Titov bedeutet dies: So sehr er auch rechnet, seine im Computer erzeugte virtuelle Welle wird die reale niemals überholen können. Stets hinkt er zwei Stunden hinter den Ereignissen hinterher. Er wird eine Bestandsaufnahme schaffen, aber keine Voraussage - und erst recht keine Warnung.
3,01 Stunden nach dem Beben, Meulaboh, Indonesien
Meulaboh, Sumatra, Indonesien, etwa 11.00 Uhr Ortszeit, 3.01 Stunden nach dem Erbeben: Während Vasily Titov eine Riesenwelle berechnet, die ihm stets Hunderte Kilometer voraus ist, und die drei Forscher des PTWC zunehmend verzweifelt nach Telefonnummern suchen, muss Agus Maidi endlich nicht mehr um sein Leben kämpfen.
Der Aufseher der Plantagengesellschaft hat auf dem Dach des überfluteten Ladengebäudes ausgehalten. Ebenso seine Frau auf dem Lastwagen, einige Dutzend Meter entfernt. Nach zwei Stunden haben beide beschlossen, nach den Kindern und ihren Eltern zu sehen. Das Wasser war noch nicht abgezogen, hatte sich jedoch beruhigt; keine Riesenwelle, keine unbezwingbare Rückströmung mehr.
Die beiden stürzten sich von ihren Fluchtpunkten aus ins schmutzige Nass. Es waren drei Kilometer bis zu ihrem Haus. Sie schwammen durch ein Leichenfeld. Überall Körper, zwischen den Ruinen treibend oder in den Trümmern verfangen. Wo das Wasser schon zurückgegangen war, hatte sich eine schwarze, erstickende Schlammdecke abgelagert.
Endlich erreichen sie ihr Haus. Es steht auf höherem Grund und ist deshalb unversehrt. Doch niemand ist da. Dann die Erleichterung: Die Kinder und die Eltern sind zur nächsten Moschee geflohen. Maidi hat, ein Wunder an diesem Tag in dieser Stadt, niemanden aus seiner Familie verloren.
Der Bronzebuddha im Kloster ist unversehrt
Ein Wunder auch sei es, meinen die Menschen von Kamala in Thailand, dass zwar das Kloster verwüstet, doch ausgerechnet die größte, die bronzene Buddhastatue im Haupttempel, unversehrt ist. Kein Trost für Phra Ajarn Toy. Der Abt hat, festgeklammert an der Kabeltrommel, die Flutwelle überstanden.
Auch einer seiner Mönche ist davongekommen, doch die Körper der anderen drei werden Retter in einem Kanal finden, tot. Nun ist Phra Ajarn Toy ein Abt ohne Mönche und ohne Kloster. Ungefähr zu dieser Zeit wagt sich an der Ostküste Sri Lankas Anqusauy Parameswaran von der Palme herunter. Seine Tochter Mary, die sich auf einen anderen Baum gerettet hat, findet er schnell.
Dann entdecken beide in den Trümmern ihres Heimatdorfes auch Parameswarans Frau. Die 39-Jährige ist schwer verletzt. Sie schafft es noch bis ins nächstgelegene, 15 Kilometer entfernte Krankenhaus - doch dort verlieren die Ärzte den Kampf um ihr Leben. Parameswarans andere vier Kinder bleiben spurlos verschwunden, fortgetragen von der Welle.
3,21 Stunden nach dem Beben
Ari Atoll, Malediven, 10.20 Uhr Ortszeit, 3.21 Stunden nach dem Erdbeben: So eine ungewöhnliche Strömung hat Boris Abdul-Salam noch nie erlebt.
Sie ist stark, doch kommt sie mal aus der einen, mal aus der anderen Richtung. Das Wasser trübt sich ein. Und als er und einige weitere Taucher schließlich nach oben schwimmen, geschieht etwas Seltsames: Die Blasen aus der Sauerstoffflasche, die normalerweise schneller als die Menschen aufsteigen, bleiben im Wasser stehen:
Die Taucher schweben in sprudelnden Wolken nach oben. Der 35-jährige Tauchlehrer aus Kiel arbeitet zum zweiten Mal seit 2003 auf den Malediven. Seine Basis liegt auf Athuruga, einem nur 280 mal 100 Meter messenden Eiland am Westrand des Atolls. Eine Trauminsel, wie so viele der 1190 Landfleckchen mitten im Indischen Ozean, die diesen Staat bilden: überall Palmen, Mangroven, weite Sandstrände.
Um 9.30 Uhr sind Abdul-Salam und ein Kollege mit dem Tauchboot hinausgefahren. Sieben Gäste haben sie an diesem Morgen zu einem Wrack hinuntergebracht. Als sie nun auftauchen, sehen sie, dass auch die Wasseroberfläche in der Lagune unruhig ist: Kleine, kabbelige Wellen tanzen über das grünlich schimmernde Wasser, obwohl kaum ein Lüftchen weht.
Der Anlegesteg ist fort. Der Strand auch
Auf dem Rückweg ruhen sich Abdul-Salam und sein Kollege auf dem Sonnendeck aus. Athuruga kommt in Sicht. "Ist sie nicht schön?", ruft Abdul- Salam aus. "Jedes Mal sieht sie wieder anders aus!" Sie fahren näher heran - und ganz langsam geht den Tauchern auf, dass die veränderte Form der Insel diesmal mehr ist als bloß ein Spiel von Lichtreflexen und Schatten.
Ihr Anlegesteg ist spurlos verschwunden. Der Strand ist fort. Während das Boot auf dem Wasser zur Sicherheit beidreht, springt Abdul- Salam über Bord und schnorchelt zur Insel hinüber: um nachzusehen, was hier passiert sein mag.

Sechs Tage zuvor sind die Malediven, endlich, aus der UN-Liste der ärmsten Länder der Welt gestrichen worden. Rund 300 000 Menschen leben hier, ein Viertel in der Hauptstadt Male, der Rest verteilt auf rund 200 bewohnte Eilande.
87 luxuriöse Hotels sind auf den Inseln verstreut, Paradiese für wohlhabende Taucher, Schnorchler, Segler. Etwa 2500 Kilometer hat der Tsunami zurückgelegt, als er an diesem Morgen auf die 1190 Inseln trifft. Er baut sich zu einer Höhe von 1,00 bis 3,70 Meter auf - nicht mehr so gewaltig wie vor Sumatra, doch hoch genug, möchte man meinen, für Eilande, deren höchste natürliche Erhebung gerade 1,50 Meter über den Meeresspiegel ragt.
Korallenriffe wirken wie Wellenbrecher
Doch die großen, vorgelagerten Korallenriffe, die Paradiese der Taucher, leiten vielerorts die Gewalt der Woge ab wie Wellenbrecher. Und da die Inseln ausnahmslos klein und flach sind, geht der Tsunami über sie hinweg - zwar bedeckt er sie vollständig, doch nur für ein paar Augenblicke, dann zieht die Welle weiter. Nirgendwo hat das Wasser jene starke Sogwirkung, die andernorts Tausende ins Meer und in den sicheren Tod gezerrt hat.
Es ist trotzdem schlimm genug. Der erste Mensch stirbt, noch ehe die Welle überhaupt angekommen ist: ein britischer Tourist, der an den Strand geht, um den Sonnenaufgang zu beobachten. Er erblickt die Woge, die sich am Riff aufbaut - und erleidet einen Herzinfarkt.
Als der Tsunami die Inseln erreicht, sinkt innerhalb der Atolle das Wasser. In manchen Lagunen fällt der Pegel kurzzeitig um vier Meter. Dann jedoch wird die Hauptstadt Male brusthoch überflutet, werden alle Dörfer der Einheimischen und alle Resorts, wird jede unbewohnte Insel überspült. Der Spuk dauert nie lange, fünf, höchstens zehn Minuten.
Als Boris Abdul-Salam die Insel Athuruga erreicht, ist alles schon vorbei. Die Bungalows sind nicht einmal bis zu einer Höhe von einem Meter durchfeuchtet. Nur dort, wo geschlossene Türen dem Wasser Widerstand geboten haben, sind Schäden an den Gebäuden aufgetreten.
"Hast Du die Katastrophe überstanden?"
Niemand aber ist fortgerissen worden. Erst Stunden später, als sich besorgte Freunde aus Deutschland per SMS bei Abdul-Salam melden ("Hast du die Katastrophe überstanden?"), erfährt er von dem Desaster, das Asien heimgesucht hat.
Auf anderen Inseln ist es schlimmer. Auf Olhuveli etwa wird eine deutsche Touristin in ihrem Bungalow vom Wasser überrascht. Sie flieht ins Badezimmer und versperrt die Tür. Das Wasser dringt trotzdem ein und steigt. Der Raum hat kein Fenster. Die Frau erkennt, dass sie in einer Falle steckt und will die Tür wieder aufstoßen. Doch die schwingt nach außen auf - und dagegen drückt die Welle . . .
Das Badezimmer hat sich binnen Sekunden in eine Zelle verwandelt, die voll läuft. Die Touristin ist gefangen, sie kann die Tür nicht mehr öffnen. Sie klettert auf den Waschtisch, um ihren Kopf über dem wogenden Nass zu halten.

Das Wasser steigt. Qualvolle Minuten vergehen. Dann, endlich, beruhigt sich das Meer. Der Raum wird nicht bis unter die Decke geflutet. Es bleibt noch etwas Platz zum Atmen. Die Deutsche ist gerettet.
Für 109 Menschen, unter ihnen mehrere Touristen, wird die Welle jedoch zur tödlichen Gefahr: Die meisten der Opfer werden mitgerissen und ertrinken. Ein Drittel der Hotelanlagen wird vollständig zerstört oder zumindest schwer beschädigt. Der Tourismus aber geht weiter.
Das Geschäft muss weitergehen
In dem Hotel, in dem Abdul-Salams Tauchbasis liegt, wird schon am Abend des Unglückstages das Restaurant wieder eröffnet. Ein paar Wochen später ist die Anlage bereits wieder zur Hälfte belegt. Stammgäste. Aber einige der Menschen, die an der Rezeption stehen oder die Räume putzen, stammen nicht von den Malediven - sondern aus Indien und Sri Lanka.
Lange müssen sie auf der Insel ausharren, ohne zu wissen, ob ihre Familien daheim noch leben. Der Flughafen bei Male wird zunächst gesperrt, dann öffnet er nur für jene Jets, welche Touristen abtransportieren. E-Mail- und Telefonverbindungen in die Katastrophengebiete sind schlecht, Tage quälender Ungewissheit die Folge.
Und etwa drei Wochen nach dem Tsunami werden noch ganz andere, schreckliche Botschaften aus Sri Lanka auf den Malediven ankommen: Leichen. Mindestens zwölf Tote, die der Tsunami von der gut 900 Kilometer entfernten Insel gerissen hat, treiben auf die schönen Strände der Malediven.
4,26 Stunden nach dem Beben
Pacific Tsunami Warning Center, Hawaii, 19.25 Ortszeit, 4.26 Stunden nach dem Erdbeben: Eine Meldung vom Seismologischen Institut der Universität Harvard geht auf Hawaii ein. Die dortigen Wissenschaftler können mit ihren Computern Beben-Messwerte so schnell und genau analysieren wie kaum eine andere Forschungsstelle der Welt. Sie melden: Stärke 8,9. (Etwas später korrigieren sie ihre Schätzung auf 9,0.)
Charles McCreery wird erst jetzt klar, dass sie es mit einem Monster zu tun haben. Die Werte der Richter-Skala steigen nicht linear an, sondern logarithmisch zur Basis zehn: 9,0 ist zehnmal so stark wie 8,0. Nun erst wissen die Forscher auf Hawaii, dass sie eines der stärksten Erdbeben der Geschichte aufgezeichnet haben.
Doch praktisch zur selben Minute gehen Daten von den australischen Kollegen ein: Eine Messboje hat vor den Kokosinseln westlich des fünften Kontinents eine Wellenhöhe von nur 50 Zentimetern gemessen. Und knapp eine Stunde später meldet das nationale Wetteramt der USA, dass auf dem Eiland Diego Garcia, einem US-Militärstützpunkt im Indischen Ozean, kein Tsunami bemerkt worden sei.
Die Riesenwelle mag noch irgendwo durch den Indischen Ozean rasen. Aber wo? Die Spezialisten auf Hawaii wissen vorläufig nur, wo der Tsunami nicht ist.
6,30 STUNDEN NACH DEM ERDBEBEN:
Die Seychellen werden getroffen, eine Inselwelt ähnlich schön wie die Malediven. Hier hat die Welle noch die Kraft, drei Menschen fortzureißen. Die Brücke zum Flughafen stürzt ein.
Anna Lechner und Thomas Elmerhaus haben den Tempel im Dschungel von Sri Lanka verlassen. Ihr Hotel ist verwüstet, Geld, Papiere, Flugtickets sind in den Fluten verschwunden. Sie besitzen nur die wenigen Kleidungsstücke, die sie am Leib tragen. Anna Lechner rettet aus dem verwüsteten Hotel das weiße Hemd eines Angestellten und wäscht mühsam den Schlamm heraus, damit sie wenigstens etwas zum Wechseln hat. Für die beiden beginnt eine tagelange Odyssee, bis sie schließlich ein Flugzeug erreichen, das sie nach Hause bringt.
Immerhin leiht ihnen jemand kurz ein Mobiltelefon. Anna Lechner kann nicht anrufen, das Netz ist überlastet. Aber eine SMS an ihre Mutter kommt durch: "Haben überlebt, sind in Sicherheit."
7,16 Stunden nach dem Beben
Pacific Tsunami Warning Center, 22.15 Ortszeit, 7.16 Stunden nach dem Erdbeben. In den Minuten, in denen sich das Hamburger Ehepaar vom Tempel in Sri Lanka aus durchschlägt, spricht McCreery per Konferenzschaltung mit Beamten des Außenministeriums in Washington und Angehörigen der US-Botschaften auf Madagaskar und Mauritius.
Der Wissenschaftler warnt die Diplomaten vor dem Tsunami, der beide Inseln bedrohen könne. Es ist die erste Prognose der Experten auf Hawaii.
Und sie ist falsch. Tatsächlich nämlich kommen diese beiden Inseln glimpflich davon - während die Welle rund 2000 Kilometer nördlich von Madagaskar (und unbemerkt von den Forschern) bereits wieder zugeschlagen hat: in Somalia.
Fischer stürzen ins Meer
Dort, rund 5000 Kilometer vom Epizentrum entfernt, ist der Tsunami noch immer mehr als einen Meter hoch. Die Fischer der Region Puntland sind auf hoher See. Sie jagen am Horn von Afrika Hammerhaie. Viele Boote kentern in der plötzlich auftretenden Wasserwand, die Fischer stürzen ins haiverseuchte Meer. An der Küste werden Dörfer überspült. Mindestens 150 Menschen sterben in dem ostafrikanischen Staat.
Das Land, zerrüttet von jahrzehntelangen Kämpfen marodierender Banden, hat keine funktionierende Regierung, keine einheitliche Verwaltung, keine zuverlässige Armee oder Polizei, keine nationalen Rettungsdienste, keine Küstenwacht.
Obwohl internationale Fernsehsender seit Stunden über den Tsunami berichten, wird hier niemand gewarnt. Und es ist noch immer nicht genug.
8 Stunden nach dem Beben
8 Stunden nach dem Erdbeben: Der Tsunami hat endlich das ferne westliche Ende des Indischen Ozeans erreicht. Rund einen Meter hoch sind die Wogen, die von einem Zipfel Arabiens bis zum Kap der Guten Hoffnung an die Küsten donnern. Im Jemen soll ein Kind in der Woge ertrunken sein. In Tansania sterben zehn Menschen.
Nur Kenia ist gewarnt - mehr als 5000 Kilometer und acht Stunden entfernt vom Erdbeben. Aber es sind nicht die Experten auf Hawaii, keine Diplomaten, keine Regierungsvertreter, keine Wissenschaftler, die das Land - als Einziges an den Gestaden des Indischen Ozeans - rechtzeitig alarmieren.
Es sind ein paar aufmerksame Menschen vor Ort.
8,01 Stunden nach dem Beben
Hafen von Mombasa, Kenia, 13.00 Uhr Ortszeit, 8.01 Stunden nach dem Erdbeben: In dem Büro von Kapitän Twalib Hamisi, dem Hafenmeister, klingelt das Telefon. Ein Mitarbeiter meldet, dass im Haupthafen das Wasser steige - obwohl Ebbe sei.
Hamisi hat keine Erklärung für das Phänomen, doch er ist sofort misstrauisch. Vielleicht ist irgendwo eine Wasserleitung gebrochen? Er ruft Kollegen in den Häfen von Malindi und Lamu an. Dort, so erfährt er, steigt das Wasser ebenfalls an.
Dann meldet sich Kenias Außenminister bei dem Hafenmeister. Der Politiker hat Fernsehberichte von dem Tsunami in Asien gesehen. "Wir haben ein Problem", sagt Hamisi.
Bei dem Hafenmeister liegen Notfallpläne - für Ölunfälle und ähnliche Desaster. An einen Tsunami hat niemand je gedacht. Hamisi improvisiert und wandelt diese Pläne ab: Er informiert die Polizei; die Beamten sollen alle Strände evakuieren.
Kenia: Die Medien sollen warnen. Sofort
Er telefoniert mit den örtlichen Journalisten; die Medien sollen Warnmeldungen verbreiten. Er funkt alle größeren Schiffe in seinem Küstenabschnitt an und warnt sie; außerdem mögen die Kapitäne doch bitte an die vielen hölzernen Daus, die einfachen, nicht mit Funkgeräten ausgerüsteten Fischerboote, heranfahren und Alarmmeldungen hinüberrufen.
Auch andernorts bleiben die Menschen nicht tatenlos. Im edlen Hotel "Hemingway's Resort" in Watamu etwa, wo einige Angestellte im Fernsehen Bilder des Tsunami sehen. Sofort ahnen sie, dass auch ihre Küste in Gefahr sein könnte.
Sie rufen jemanden im nächstgelegenen Hafenamt an, doch der ist noch nicht informiert. Sie melden sich bei einem Offizier der kenianischen Marine - der verspricht bloß, sich um die Sache zu kümmern. Irgendjemand sucht nach der Nummer eines britischen Professors, der angeblich Experte für Meeresströmungen an der afrikanischen Ostküste ist.
Schließlich werden die Angestellten nervös. Da ihnen niemand irgendeine konkrete Information geben kann, alarmieren sie auf eigene Faust ihre Gäste.
30 Minuten reichen, Kenias Küste zu räumen
Diese müssen den Strand verlassen und sich auf einem Parkplatz sammeln - mehr als einen halben Kilometer entfernt vom Meer.
Zwischen der ersten Welle, die den Hafenmeister Hamisi alarmiert, und der zweiten, stärkeren, verstreichen in Kenia rund 30 Minuten. Die reichen vollkommen aus, um die Küsten des Landes größtenteils zu evakuieren.
Nur 30 Minuten! Die Menschen in Sumatra und auf den Andamanen und Nikobaren hätten wohl auch unter anderen Umständen keine Chance gehabt, dem Tsunami zu entgehen. Zu nahe lebten sie am Epizentrum, zu kurz war die Vorwarnzeit. Doch in Thailand und Indien, auf Sri Lanka, den Malediven und in Ostafrika war die Vorwarnzeit nicht in Minuten bemessen, sondern in Stunden.
Wenn Kenia in 30 Minuten seine Küsten größtenteils evakuieren konnte, warum hätte dies in Asien nicht auch gelingen können? Zehntausende wären gerettet worden.
So aber sterben binnen acht Stunden mehr als 300 000 Menschen. Wohl ein Drittel von ihnen sind Kinder.
Wenig werde sich ändern, prophezeien schon bald darauf die Experten. Die Atommacht Indien werde sich weiterhin als regionale Vormacht aufspielen. Der Bürgerkrieg in Aceh werde weiterschwelen und der in Sri Lanka auch. Den Naturvölkern der Andamanen und Nikobaren drohe auch in Zukunft das Aussterben. Und warum sollte die Tourismusbehörde in Thailand ihren immensen Einfluss verlieren? Die Reisenden hätten ein kurzes Gedächtnis.
Bald seien die Strände wieder begehrte Ziele der Sonnenhungrigen. Und die ruinierten Fischer? Gesamtwirtschaftlich gesehen für die meisten Staaten nur eine Marginalie. Doch kann man da wirklich so sicher sein?
Zehntausende Waisen, zehntausende Eltern ohne Kinder
Wird nicht die schiere Zahl der Opfer eine Wirkung entfalten? Die Welle hat Zehntausende Waisen zurückgelassen - und Zehntausende Eltern, die ihre Kinder nicht haben retten können. Wird das an den Gesellschaften am Indischen Ozean tatsächlich spurlos vorübergehen?
Wird nicht zumindest in der Provinz Aceh das Leben für immer anders sein? In jenen Minuten, in denen die Welle zuschlug, sind allein hier etwa fünf Prozent der Bevölkerung ertrunken. Einer von 20 Einwohnern.

Eine Veränderung ist wohl schon absehbar: Tsunamis sind nicht länger ein "Pazifik-Problem". Die Anrainerstaaten des Indischen Ozeans haben versprochen, binnen weniger Jahre ein dem Stillen Ozean vergleichbares internationales Warnsystem aufzubauen.
Dann werden, hoffentlich, Messbojen im Meer wachen, damit Forscher schnell und zuverlässig über einen Tsunami unterrichtet werden. Dann werden, hoffentlich, in den Wetterämtern und Katastrophenschutzbehörden Menschen arbeiten, die es wagen, eine Warnung rechtzeitig auszusprechen. Und es werden, hoffentlich, Kommunikationsnetze aufgebaut, um die Menschen zu alarmieren, die vom Meer leben oder sich an seinen Gestaden erholen. Denn dieser letzte Schritt in der Alarmkette wird wohl der schwierigste sein.
Der Sog der Welle
Selbst in Kenia, wo viele Menschen schnell reagieren, sind sie, ein tragisches Mal, nicht schnell genug: In Malindi ist Samuel Njoroge im Wasser, als die Welle kommt, ein 20 Jahre alter Mechaniker aus Nairobi. Er badet zusammen mit seinem Onkel, der Strand liegt nur gut drei Meter hinter ihnen.
Die Woge ist nicht hoch, doch ihr Sog übermächtig. Njoroge und sein Onkel werden unter Wasser gezogen. Italienische Touristen springen hinzu und helfen. Schließlich sind die beiden Männer wieder am Ufer. Der Onkel überlebt - doch für seinen Neffen kommt die Rettung zu spät. Er ist bereits ertrunken.
Es ist das erste Mal, dass Samuel Njoroge im Meer geschwommen ist.