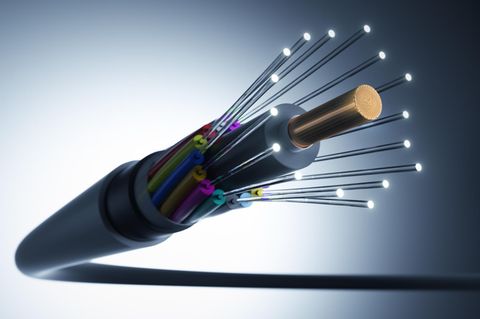Im Februar 2024 bekam Los Angeles die Zukunft zu spüren. Binnen dreier Tage fielen gut 20 Zentimeter Regen pro Quadratmeter auf die Stadt, der zweitschlimmste Guss seit 150 Jahren. Es war eines jener Extremwetter-Ereignisse, von denen Klimaforscher sagen, dass sie in den kommenden Jahrzehnten das neue Normal seien.
Noch vor zehn Jahren hätten die Wassermassen wahrscheinlich die Kanalisation der x-Millionenstadt überfordert. Diesmal waren die Zuständigen gewappnet: Gut drei Milliarden Liter Regenwasser waren am Ende aufgefangen und gespeichert worden, die gefürchteten Überschwemmungen waren ausgeblieben.
Los Angeles hat sich in den letzten Jahren zur "Schwammstadt" gemausert, ein mittlerweile gängiger Begriff aus der Stadtplaner-Sprache. Denn weltweit teilen viele Städte die Probleme Los Angeles‘: Extreme Regenfälle, aber auch, wie in Kalifornien, massive Dürre sorgen einerseits für zu viel, andererseits für zu wenig Wasser. Schwammstädte sollen beidem Herr werden. Sie saugen Wasser auf, vermeiden so Überschwemmungen, speichern es aber auch und nutzen es für die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen. Oder aber sogar, bei entsprechender Klärung, als Trinkwasser.
Wasserundurchlässige Flächen saugen das Nass auf und speichern es
Die Maßnahmen, die Los Angeles ergriff, gleichen denen, die in anderen "Sponge Cities" auf der Welt unternommen wurden. Zunächst konzentrierte man sich darauf, den allgegenwärtigen Asphalt zu knacken, oder, im Stadtplaner-Jargon: Flächen wie Parkplätze, öffentliche Versammlungsorte und betonierte Wege zu "entsiegeln".
Wasserundurchlässige Flächen verwandeln sich dann in Landschaften mit porösem Boden, die das Nass aufsaugen und sogar speichern – Parks, Spielplätze auf Wiesengrund, Stellplätze für Autos auf schlichter Erde. Durch diese fließt das Wasser in Grundwasserspeicher, unterirdische Zisternen oder wasserführende Bodenschichten, wird dort gehalten und kann bei akutem Wassermangel wieder aufbereitet werden.
Was in den USA erst beginnt, hatte in Asien, vor allem in China, schon vor zehn Jahren Fahrt aufgenommen, auch hier geboren aus schlichter Notwendigkeit: Zwischen 2004 und 2014 hatte das damals noch bevölkerungsreichste Land der Erde mehr Naturkatastrophen erlebt als jede andere Region des Planeten.

2015 verabschiedete die chinesische Zentralregierung ein Drei-Milliarden-Dollar-Programm, das 16 Städte in die Lage versetzen sollte, "wie ein Schwamm zu agieren". In Wuhan beispielsweise, einer 13-Millionen-Stadt in Zentralchina nehmen die Projekte zur Errichtung einer Schwammstadt fast 40 Quadratkilometer ein: frisch ausgehobene städtische Gärten, eine Entsiegelung asphaltierter Flächen, aber auch künstliche Seen an den Stadträndern, in die überschüssiges Wasser aus der betonierten Innenstadt umstandslos geleitet werden kann. In Dürreperioden halten diese Speicher Wasser für Landwirtschaft und Einwohner bereit.
Auch der Inselstaat Singapur, gelegen in einer feuchttropischen Klimazone, ergriff früh Maßnahmen gegen Wasserüberfluss durch Extremregen: Rasch entstanden mehr als ein Dutzend Wasserreservoirs am Rande der Stadt, die inzwischen bis zu 35 Prozent des Regenwassers aus der Innenstadt aufnehmen können. Eine Quote, die auch viele andere Länder als notwendig ansehen.
Besseres Mikroklima bei Hitzewellen
Auch in Berlin soll, so die örtlichen Wasserbetriebe, "Regenwasser durch Entsiegelung und Bepflanzung von Flächen, Dächern und Fassaden" gespeichert werden. Der zuständige Landesverband des BUND hat berechnet, dass sich beispielsweise mit der Dachbegrünung von Häusern und Tiefgaragen zwischen 50 und 100 Prozent des Jahresniederschlags zurückhalten lassen. Die Begrünung von Fassaden mit Kletterpflanzen oder mit "Living Walls", bei der die Fassade direkt bepflanzt wird, wirkt wiederum auch bei Hitzewellen: Dann trägt vor allem die Verdunstungskühle und die Kälteisolierung zu einem besseren Mikroklima bei.
Die Vielzahl der verschiedenen Maßnahmen spiegelt die vielfältigen Probleme – aber auch, dass es viele Lösungswege gibt. Michael Kiparsky, Forscher an der nicht weit von Los Angeles gelegenen Eliteuni Berkely, beschreibt es so: "Nicht die eine asphaltierte Auffahrt, nicht das eine versiegelte Hochhausdach verursacht die massive Veränderung der natürlichen Wasserläufe, das geschieht durch ihre millionenfache Zahl. Die Probleme der städtischen Wasserhaushalte werden durch tausend kleine Schnitte verursacht. Und vielleicht können wir das Problem mit tausend kleinen Pflastern lösen."