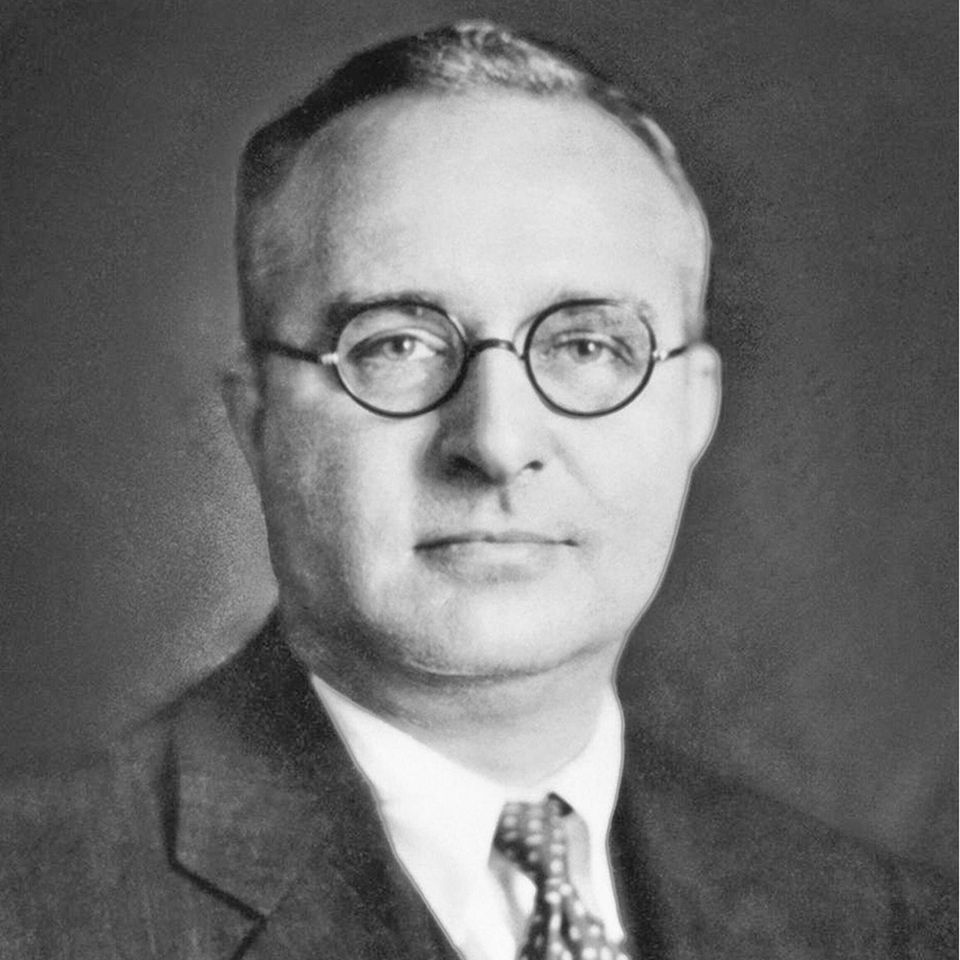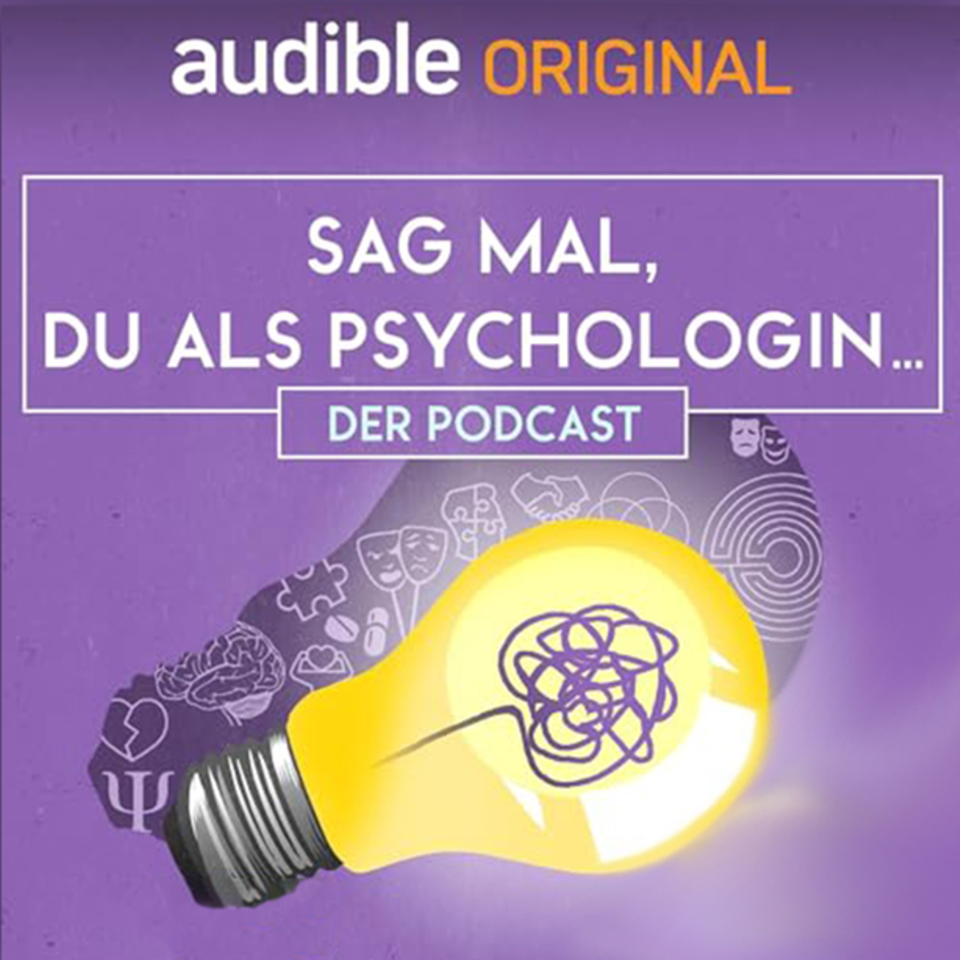Rekordwerte für Treibhausgase in der Atmosphäre, bedrückende Prognosen zur Erderwärmung und immer neue Berichte über Hitzewellen, Dürren und Extremwetter-Ereignisse: Die Schreckensmeldungen zum Klimawandel werden immer drängender. Dennoch scheinen sowohl Politik als auch jede und jeder Einzelne nur schwer ins Handeln zu kommen. Tatsächlich spielen für unsere Untätigkeit auch psychologische Prozesse eine Rolle.
Im Frühjahr 2023 zeigte eine Studie im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe, dass der Verkehrssektor in Deutschland weiterhin die Klimaziele verfehlt, für den Gebäudebereich bescheinigte der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung zu wenig Ehrgeiz, und das Umweltbundesamt mahnte zu allerhöchster Eile beim Ausbau der Erneuerbaren Energien, um die Klimaziele der kommenden Jahre zu erreichen. Gleichzeitig vermeldete das Luftfahrt-Tracking-Unternehmen "Flightradar24", dass am 6. Juli 2023 so viele kommerzielle Flugzeuge in der Luft gewesen seien wie noch nie seit Start des Dienstes im Jahr 2006, während das Statistische Bundesamt im September vergangenen Jahres von einer Rekordzahl an Pkw je Einwohner in Deutschland für 2022 berichtete.
Klimawandelleugner sind eine laute Minderheit
Politisch wie individuell wirkt unsere Reaktion auf die Klimakrise im besten Fall schwerfällig – und das, obwohl der Klimawandel vielen Menschen Angst macht und ihnen der Schutz des Klimas wichtig ist, wie Umfragen regelmäßig zeigen. Auch Gerhard Reese, Professor für Umweltpsychologie an der Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau, sagt: "In den vergangenen Jahrzehnten ist das Klima-Bewusstsein auf ein sehr hohes Niveau gestiegen." Es gebe zwar eine kleine Gruppe von Menschen, die sowohl die eigene Verantwortung als auch den Klimawandel an sich leugneten. Dies sei aber wahrscheinlich nicht die Mehrheit, sondern eine oft sehr laute Minderheit.
"Vielen ist also bewusst, was da passiert, und trotzdem fällt es uns schwer, das mit unserem eigenen Handeln zu verknüpfen", führt Reese aus. Dadurch, dass es sich um eine globale Krise handele, entstehe ein Gefühl der Hilflosigkeit: "Ich mit meiner eigenen Selbstwirksamkeit, als Einzelner, kann die Klimakrise ja nicht aufhalten."
Unser Gehirn tut sich mit abstrakten Zusammenhängen schwer
Hinzu kommt, dass der Klimawandel und seine Konsequenzen für viele Menschen immer noch schwer greifbar sind, erklärt Isabella Uhl-Hädicke, Umweltpsychologin an der Universität Salzburg: "Wir reden über 1,5 oder 2 Grad: Das ist nichts, was uns emotional berührt. Natürlich geht es dabei um globale Temperaturunterschiede, aber salopp gesagt spüre ich ein halbes Grad Unterschied im Raum nicht." Zudem werde sehr theoretisch, kognitiv und rational darüber gesprochen: "Dinge müssen uns aber emotional berühren, damit wir ins Handeln kommen."
Ein Aspekt, den auch Reese aufgreift: "Klimakrise oder Klimawandel sind für uns sehr abstrakt." Events wie Dürren würden zwar wahrgenommen und von vielen Menschen auch mit der Klimakrise in Verbindung gebracht. "Wobei wir wissenschaftlich gar nicht sagen können: Dieses eine Event liegt zu hundert Prozent am Klimawandel. Derartige Attributionen sind auch mit Unsicherheiten verbunden, und diese Unsicherheit ist einer der Aspekte, die es uns als Bürgerinnen und Bürgern, aber auch der Politik schwer macht", führt Reese aus.
Der Genuss im Moment überwiegt oft
Wie Uhl-Hädicke erklärt, wird unser Verhalten durch Konsequenzen gesteuert, die wir idealerweise unmittelbar erleben: "Das Problem beim klimafreundlichen Verhalten ist, dass wir vielleicht Verhaltensweisen aufgeben sollen, die wir gern machen, uns wichtig sind und uns positive Emotionen bringen." Als Beispiel dafür beschreibt sie eine alltägliche Situation in der Kantine, bei der man sich zwischen einem Fleisch- und einem vegetarischen Gericht entscheiden muss: "Der Punkt ist, dass ich bei der Entscheidung fürs vegetarische Gericht die unmittelbaren Konsequenzen für das Klima nicht spüre, indem etwa die Temperaturen wieder sinken oder die Gletscher wachsen."
Klimafreundliche Handlungen im Heute würden also erst in fernerer Zukunft Konsequenzen haben: "Das macht es so schwierig: Das unmittelbar positive Erlebnis, das mit dem klimaschädigenden Verhalten einhergehen kann – wie etwa der Griff zum Fleischgericht, das mir schmeckt und Genuss bringt – steht in Konflikt zu dem, was rational gut ist, mir aber vielleicht nicht die positive Bestärkung gibt."
Unser System macht klimaschonendes Verhalten mühsamer
Unser klimaschädliches Verhalten werde allerdings nicht nur von psychologischen oder individuellen Faktoren bestimmt, sondern auch von systemischen Standards, merkt Reese an: "Wenn es überall Straßen gibt, fahren Menschen natürlich Autos. Und wenn das Fliegen billiger ist als Zugfahren, entscheiden sich Menschen für das Flugzeug. Es ist einfach so, dass das klimaschonende Verhalten an den allermeisten Stellen sehr viel schwieriger, zeitaufwendiger und für viele noch ungemütlicher ist."
Uhl-Hädicke verweist auf die Bedeutung sozialer Normen und Verhaltensweisen, die wir in unserem Umfeld beobachten. Um deutlich zu machen, wie stark diese wirken können, erinnert die Klimapsychologin an die sogenannte Rauchstudie, ein Experiment von 1968: Dafür wurden Menschen in einen Raum gesetzt, in den weißer Rauch geleitet wurde. Einem Teil der Teilnehmer war klar, dass der Rauch kein Feuer anzeigt; diese Eingeweihten hatten die Anweisung, sitzenzubleiben. Doch auch die Nicht-Eingeweihten verharrten im Raum - obwohl der Rauch Signal einer lebensbedrohlichen Situation hätte sein können.
Experimente zeigen: Wir richten uns nach der Lebensweise der Mehrheit
Für Uhl-Hädicke eine gute Analogie zu dem, was gerade in der Klimakrise passiere: "Zum einen sehen wir das Ausbleiben von Konsequenzen, zum anderen aber eben auch, dass wir uns an anderen orientieren. Natürlich lesen wir in den Medien regelmäßig die Schlagzeilen über die katastrophalen Folgen der Klimakrise, aber wenn man sich umschaut, ist niemand so richtig panisch." Die ausbleibende Panik im eigenen Umfeld führe zu dem Trugschluss, dass alles nicht so schlimm sein könne.
Hinzu kämen sogenannte Norm-Konflikte: Auf der einen Seite stehe die moralische Norm, auf die wir uns in der Gesellschaft geeinigt hätten und die uns sage, welches Verhalten als erstrebenswert und welches als negativ betrachtet werde. Demgegenüber stehe die beschreibende Norm, "also die Norm, die ich beobachte – das Verhalten, das die Mehrheit zeigt", so die Klimapsychologin. "Und in einem Norm-Konflikt zwischen gewünschtem und gezeigtem Verhalten – das zeigt die Forschung – wirkt die deskriptive Norm stärker: zum einen, weil es oft leichter ist, ihr zu folgen, zum anderen aber vor allem, weil wir uns an der Mehrheit orientieren möchten."
Die Kommunikation zur Klimakrise bestärkt ausgerechnet klimaschädigendes Verhalten
Die Bedeutung sozialer Normen hat für Uhl-Hädicke Folgen für die Kommunikation zur Klimakrise. So würden Schlagzeilen wie "70 Prozent der Männer würden lieber sterben, als auf Fleisch zu verzichten" zeigen, wie sich die Mehrheit verhält "und daran orientieren wir uns, selbst, wenn ein solches Verhalten an den Pranger gestellt wird". Daher wäre es sinnvoll, Trendprognosen zu nutzen oder dynamische Normen anzusprechen. "Beim Fleischkonsum könnte also berichtet werden: Die Mehrheit greift noch zu Fleisch, aber immer mehr finden Geschmack an fleischlosen Alternativen. Entsprechende Studien zeigten, dass ein solcher Ansatz wirkt, weil wir auch Teil von Innovationen oder Trends sein wollen", erläutert Uhl-Hädicke.
Andere Studien machten deutlich, dass die meisten Menschen es als gerecht empfänden, wenn Verursacherinnen oder Verursacher auch die Verantwortung übernähmen, ergänzt Reese. "Das müsste vermutlich stärker kommuniziert werden, denn Menschen ist bewusst, dass sie mit dem Verhalten für etwas verantwortlich sind." Konkret könnte das bedeuten, klimaschädigendes Verhalten stärker zu bepreisen.
Verbote sind sozial gerechter als hohe Preise
Neben der Preisgestaltung könnte allerdings auch mit Verboten gearbeitet werden, so Reese: "Verbote sind eigentlich etwas sehr Gerechtes. Wenn ich etwas verbiete, kann ich mich auch nicht mit viel Geld rein oder raus kaufen." Allerdings würden Verbote bei vielen Menschen spontane Abwehr auslösen: "Dennoch können Verbote hilfreich sein, nämlich dann, wenn sie gerecht sind und der Mehrheit sehr viel Gewinn bringen, wie zum Beispiel das Nichtraucherschutzgesetz oder das Verbot, ohne Gurt Auto zu fahren, zeigen." Gerade die Anschnallpflicht mache zudem deutlich, dass politische Maßnahmen der schnellste Hebel seien, um soziale Normen zu verändern, sagt Uhl-Hädicke.
Dass politische Maßnahmen am schnellsten Wirkung zeigten, glaubt auch Reese. Das heiße aber nicht, dass man sich als Einzelner aus der Verantwortung nehmen könne, so Uhl-Hädicke: "Aus psychologischer Sicht schon allein deswegen nicht, weil wir mit Blick auf soziale Normen mit unserem Verhalten eine Vorbildfunktion entfalten und andere motivieren können."
Menschen können einander unheimlich gut motivieren
Sie sieht bei der Kommunikation über die Klimakrise auch die Medien in der Verantwortung: "Eine Vielzahl von Schreckensmeldungen über deren Folgen führen bei den Menschen zu Abwehrmechanismen: Informationen über eine existenzielle Bedrohung lösen dann eine Art Schockstarre oder zumindest ungute Gefühle aus." Wichtig wäre daher, positive Beispiele zu berichten: "Wir wissen, dass Horrorszenarien uns hemmen und Mechanismen auslösen, mit denen wir uns von den bedrohlichen Gefühlen lösen, ohne die Ursachen der Szenarien anzugehen. Positive Beispiele motivieren uns hingegen", führt Uhl-Hädicke aus.
Noch dazu finde die Klimakrise gleichzeitig mit vielen anderen Krisen statt: "Wir Menschen halten nur ein bestimmtes Maß an Krisen aus, insofern ist ein gewisser Grad an Nachrichtenmüdigkeit auch verständlich. Aber man kann sich daraus lösen, indem man sich etwa der Bedrohung zuwendet und versucht, etwas zu deren Lösung beizutragen, also konkret: einen klimafreundlichen Lebensstil aufzunehmen."
Finde eine solche Verhaltensveränderung in einer Gruppe statt, könne ein Gefühl kollektiver Wirksamkeit entstehen, betont Reese: "Wir als Nachbarschaft, wir als Community, wir als Nation oder vielleicht auch wir als ganze Menschheit – auch wenn das utopisch klingen mag – aber wir als Gruppe, wir als Bewegung, wir können etwas verändern."