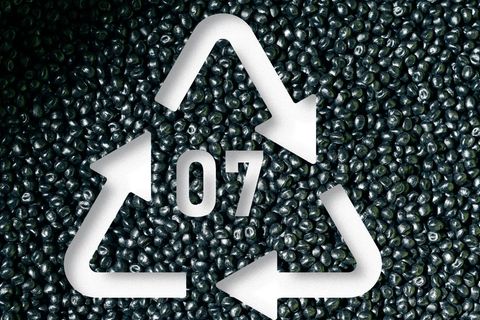GEO: Frau Dr. Beyerl, vielen ist inzwischen bewusst: Unser momentaner Lebensstil trägt nicht für die Zukunft. Wenn wir die grüne Wende schaffen wollen, muss jeder von uns deutlich nachhaltiger werden, sein Verhalten ändern. Warum fällt das bisweilen so schwer?
Frau Dr. Beyerl: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Die meisten Dinge tun wir, weil wir sie immer schon getan haben, weil sie gelernte Routine sind, sich in unserem Alltag bewährt haben. Wenn wir etwa im Supermarkt den Einkaufswagen füllen, fragen wir nicht bei jedem einzelnen Produkt: Unter welchen Bedingungen ist es entstanden? Welche Transportwege hat es hinter sich? Ist es ökologisch sinnvoll? Vielmehr kaufen wir das ein, was wir auch letzte Woche schon eingekauft haben. Schlichtweg, weil es vertraut ist, weil es gut schmeckt und uns gefällt. In der Regel hinterfragen wir unsere Routinen erst, wenn sie nicht mehr funktionieren.
Was können wir tun?
Eine gute Möglichkeit, Gewohnheiten umzustellen, bietet sich immer dann, wenn ohnehin eine Veränderung ansteht. Bei einem Umzug sind beispielsweise lauter Entscheidungen fällig – wie viel Platz benötige ich wirklich, und welcher Stromanbieter soll es künftig sein? Wenn man den Job wechselt, bietet es sich womöglich an, den neuen Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad zurückzulegen. Wer ein neues Konto eröffnet, kann gleich eine nachhaltige Bank wählen. Ich spreche in diesem Zusammenhang von "Gelegenheitsfenstern" – Momenten im Leben, in denen die Rahmenbedingungen des Alltags gewissermaßen neu justiert werden.
Gilt das auch auf institutioneller Ebene?
Unbedingt. Gerade in Firmen standen ja im Zuge der Pandemie viele Prozesse und Richtlinien auf dem Prüfstand: neue Reisevorschriften, einen veränderten Bedarf an Arbeitsmaterialien, die Wiedereröffnung der Kantine, vielleicht ein neues Bürogebäude oder Renovierungen. Hier besteht die Chance, grundlegende Veränderungen durchzuführen, die gleichzeitig das Ziel nachhaltigeren Wirtschaftens im Blick haben. Der Vorteil bei solchen Entscheidungen ist, dass sie in der Regel nur einmal getroffen werden müssen. Ob Stromanbieter, Reiserichtlinie, Gebäudebau: Ist der Hebel einmal umgelegt, dauert es nicht lang, bis das Neue das neue Normal ist.
Um seine Ernährung umzustellen oder öfter das Auto stehen zu lassen, braucht es in jedem Fall Disziplin. Wie kann man sich motivieren?
Besonders für den Anfang kann es hilfreich sein, Verbündete zu suchen. Menschen, die Ähnliches vorhaben und mit denen man sich gemeinsame Ziele setzen kann. Zum Beispiel: Erzählen Sie Ihren Freunden, dass Sie sich entschieden haben, bis Ende des Monats kein Fleisch mehr zu essen. Womöglich schließt sich ein Zweiter an. Schon können Sie sich gegenseitig unterstützen, in einen positiven Wettbewerb treten und gemeinsam ausprobieren, was gut funktioniert. Es fällt leichter, an einem Vorhaben festzuhalten, wenn ich anderen davon erzähle. Kommunikation erzeugt Verbindlichkeit. Und gemeinsam kann man Erreichtes auch mal feiern. Sich darüber freuen, dass ein Muster durchbrochen ist. Dieses soziale Element ist auf dem langen Weg der Transformation, die als Gesellschaft vor uns liegt, ungemein wertvoll.

Was sind die wichtigsten Stellschrauben für den Einzelnen?
Nachhaltig zu leben bedeutet, sich so zu verhalten, dass die natürlichen und sozialen Lebensgrundlagen möglichst wenig beeinträchtigt werden und ein gutes Dasein für alle möglich wird. Einen wirksamen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leistet vor allem, wer die nicht nachhaltige Mobilität reduziert – also insbesondere weniger fliegt –, wer weniger tierische Produkte zu sich nimmt und wer insgesamt den Konsum solcher Waren und Dienstleistungen einschränkt, die mit hohen sozialökologischen Kosten verbunden sind.
Was meinen Sie damit?
Jedes Produkt hat einen sozialen und ökologischen Fußabdruck. Und der ist bei vielem, was wir im globalen Norden konsumieren, exorbitant groß – von der Herstellung bis zur Entsorgung. Beispiel Billig-T-Shirt: Das entsteht häufig in südostasiatischen Ländern, wo die Arbeitsbedingungen auch aufgrund des Preisdrucks oft ausbeuterisch und gefährlich sind, beispielsweise wenn giftige Chemikalien zum Einsatz kommen, die Mensch und Umwelt belasten.

Dann wird es unter Verbrennung fossiler Energieträger Tausende Kilometer zu uns verschifft, landet für wenige Euro in irgendeinem Kleiderschrank – wenn überhaupt –, wird vielleicht zwei- oder dreimal getragen und endet nicht selten im Müll. Diese fatalen, nicht nachhaltigen Konsummuster herrschen in vielen Bereichen vor. Bei der Art und Weise, wie wir bauen, wie wir Energie produzieren, wie wir Lebensmittel herstellen. So schaden wir mit unserem täglichen Verhalten anderen, den Lebensbedingungen auf der Erde – und somit auch uns selbst.
Ist die Regelung von Produktionsbedingungen nicht Sache der Politik?
Wer ist denn die Politik? Das sind in zahlreichen Ländern – so auch bei uns in Deutschland – demokratisch gewählte Menschen. Und ebenso steuern wir Menschen als Produzenten und Konsumenten mit unserem Verhalten das Angebot. Diese Macht und die damit verbundene Verantwortung sollten wir niemals unterschätzen. Dass inzwischen viele Konzerne umsteuern und sich um mehr Nachhaltigkeit bemühen, beruht ja weniger auf moralischer Einsicht oder auf politischer Doktrin. Dahinter steht nicht zuletzt wirtschaftliches Kalkül: Vielen Verbrauchern ist es eben nicht mehr gleichgültig, zu welchen ökologischen und sozialen Kosten ein Produkt entstanden ist. Entsprechend wirken sie auf das Angebot ein. Das geht so weit, dass eine große deutsche Discount-Kette mittlerweile erwägt, Billigfleisch aus ihren Regalen zu verbannen.
Warum geschieht dieses Umdenken erst jetzt?
Ein Grund dafür ist, dass die sozialökologischen Kosten der allermeisten Produkte für Verbraucher unsichtbar bleiben. Das Leid der Tiere in den Ställen, die ausgebeutete Näherin in Bangladesch, die Tonnen an CO2, die beim Warentransport in die Atmosphäre gelangen – kaum jemand befürwortet diese Umstände. Doch weil sie gewissermaßen außerhalb unseres Blickfelds liegen, können wir sie recht gut verdrängen. Zudem sind unsere Prioritäten im Alltag häufig andere.
Was ist wichtiger?
Ob wir rasch zur Arbeit kommen wollen oder auf der Suche nach einem kleinen Snack für unterwegs sind: In vielen alltäglichen Dingen spielt Nachhaltigkeit leider nicht die wichtigste Rolle. Obst, das in Plastikschalen verpackt ist, erscheint praktisch, weil es sich gut transportieren lässt. Wenn der Paketbote jeden Einkauf ohne Aufpreis bis an die Wohnungstür liefert, ist das bequem. Ein weiterer Grund, warum das nicht nachhaltige Leben lange Zeit wenig hinterfragt wurde, ist, dass viele Menschen die Folgen, die dieser Lebensstil hat – namentlich die von der Wissenschaft schon vor Jahrzehnten prognostizierte Erderwärmung – erst seit kurzer Zeit unmittelbar spüren.
Inwiefern macht sich die bemerkbar?
Die Pegelstände von Seen sind mancherorts rapide abgesunken, Extremwetterereignisse wie Hitzewellen oder Stürme nehmen zu, auf Windschutzscheiben sehen wir kaum noch Insekten, weil es immer weniger davon gibt. Allmählich setzt sich die Einsicht durch, dass auch wir in Deutschland von Umweltveränderungen betroffen sind. Erst wenn Menschen derartige Veränderungen tatsächlich wahrnehmen, ist es wahrscheinlich, dass sie sich bewegen – und ihr Verhalten anpassen. Zweitens müssen sie über die nötigen Strategien und Möglichkeiten verfügen, eine Verhaltensänderung auch zu bewältigen. Und drittens müssen sie von der Effektivität einer Maßnahme überzeugt sein.
Viele haben aber den Eindruck, ihr persönlicher Beitrag – etwa der Verzicht auf einen Flug – sei eben nicht wirksam, mache keinen Unterschied.
Das ist eine Fehlwahrnehmung. Wir sind ja immer einzelne Menschen, die jeden Tag einzelne Entscheidungen treffen. In der Summe ist jeder Beitrag wertvoll. Jeder trägt einen Anteil bei, ist mitverantwortlich. Hinzu kommt, dass wir als Konsumenten nicht bloß Privatpersonen sind. Wir sind immer auch in Institutionen eingebunden, sind Mitarbeiter, Architektin, Stadtplaner, Bäuerin, Manager, teilweise eben auch Politikerin. Und als solche Vorbild für andere. Wir alle prägen mit unserem Verhalten das, was soziale Norm ist. Und diese Norm wandelt sich. Noch vor einigen Jahren konnte man zum Beispiel bedenkenlos mit einem Shoppingtrip nach New York prahlen. Inzwischen kennt die deutsche Sprache Wörter wie "Flugscham".

Weniger Fliegen, weniger Fleisch, weniger Shopping: Verzicht erscheint wie das Gegenteil von Lebensfreude – zumal er im Stillen stattfindet, für andere nicht sichtbar ist. Was setzt man dem entgegen?
Ich behaupte das Gegenteil: Der Massenkonsum und die damit verbundenen Arbeits- und Produktionsbedingungen haben dazu geführt, dass vielen Menschen das Gespür für wahren Genuss und wahre Freude abhanden gekommen ist. Vielmehr fühlen sie sich in einer immer individualistischeren Welt einsam und gefangen in Hamsterrädern. Man sollte sich fragen, um welchen Verzicht es hier eigentlich geht. Ist es wirklich das gute Leben, auf das wir verzichten sollen? Wir sprechen über Fleisch von gestressten Tieren, das mit Antibiotika vollgepumpt ist; schadstoffbelastete Kleidung mit verzogenen Nähten; unnötige Kosmetikprodukte mit Mikroplastik und bedenklichen Inhaltsstoffen. Brauchen – und wollen – wir diese Dinge wirklich? Eine Umstellung bietet die ungemein wertvolle Chance, sein Leben mehr an Qualität denn an Quantität auszurichten, zu teilen und gemeinsam zu gestalten. Ein nachhaltiges Leben bedeutet für mich ein entspannteres, ein sozial gerechteres, ein qualitativ hochwertigeres Leben.
Ein Bio-Schnitzel ist deutlich teurer als ein konventionelles, Flugemissionen zu kompensieren kostet Geld. Muss man besonders wohlhabend sein, um ökologisch korrekt zu leben? Oder besonders arm, weil man sich dann ohnehin nicht viel leisten kann?
Klar ist, dass die Transformation für alle machbar und tragbar sein muss. Sonst drohen soziale Spannungen. Daher braucht es beides, ein Umdenken auf individueller Ebene, aber noch wichtiger – die grundlegende Anpassung politischer und rechtlicher Rahmenbedingungen. Die sozialökologische Wende darf nicht nur ein Thema für bestimmte Milieus wie die urbane Mittelschicht sein.
Ist nicht davon auszugehen, dass eine breite Masse ihren Konsum auch weiterhin am Preis ausrichten wird? Anders formuliert: Solange es T-Shirts gibt, die nur zwei Euro kosten, werden sie auch gekauft.
Momentan ist es doch eher so, dass die wahren sozialen und ökologischen Kosten, die bei der Produktion, dem Transport und der Entsorgung vieler Billigwaren anfallen, im Preis gar nicht abgebildet sind. Die Profite kommen wenigen zugute, während die Kosten auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. Die Frage lautet also: Wie schaffen wir es, dass nachhaltige Waren und Dienstleistungen günstiger, attraktiver und leichter umsetzbar für alle werden?
Zum Beispiel?
So müssten etwa fair produzierte Bio-Lebensmittel für Konsumenten die preiswerteste Alternative sein, und die Erzeugung muss sich für die Bauern lohnen. Wer auf Pestizide, Herbizide und den Einsatz schädlicher Düngemittel verzichtet, dafür aber biologische Vielfalt, gesunde Lebensmittel und gute Arbeitsplätze gewährleistet, der müsste steuerliche und finanzielle Vorteile erhalten. Die Preisgestaltung im Lebensmittelsektor zwingt die Bauern, zu minimalen Kosten zu produzieren, darunter leidet die Qualität der Produkte, die Umwelt und letztendlich wir alle.
Klimaschutz findet eine Mehrheit richtig, aber er soll ja nicht finanziell belasten. Sobald der Benzinpreis steigt, ist es mit dem grünen Gewissen schnell dahin.
Noch einmal: Ökologisch und sozial muss immer zusammen gedacht werden. Einfach nur die Preise für nicht nachhaltige Produkte wie etwa Benzin zu erhöhen, ohne nachhaltige Angebote zu subventionieren, wird zu Recht auf wenig Akzeptanz stoßen und soziale Spannungen verstärken. Daher halte ich es für wichtig, dass wohlhabendere Menschen stärker zur Kasse gebeten werden. Zudem sind faire Löhne notwendig. Ein bedingungsloses Grundeinkommen mit Zusatzverdienstmöglichkeiten könnte überdies helfen, zu einer Entschleunigung beizutragen.

Wo würden Sie noch ansetzen?
Ich wünsche mir eine Ökonomie, die am Gemeinwohl ausgerichtet ist. Man könnte Unternehmen beispielsweise nicht nur nach Umsatz und Gewinn bilanzieren, sondern auch danach, ob sie faire Löhne bezahlen, ob sie ökologisch wirtschaften, wie ihre Lieferketten aussehen. Und schon stünden Konzerne in einem anderen, positiveren Wettbewerb als heute. Dazu bräuchte es – wie erwähnt – umfassende Reformen, möglichst über Ländergrenzen hinweg. Darüber hinaus halte ich es für wichtig, regionale und nachhaltige Wertschöpfungsketten zu fördern. Darin liegt ein wichtiger Schlüssel. Wenn regional produziert, konsumiert und entsorgt wird, entstehen Arbeitsplätze und sichtbare Verantwortlichkeiten. Zugleich werden Transportwege und die globale Ausbeutung reduziert.
Das klingt nach viel Veränderung!
Es geht nicht darum, alle Freiheiten der Moderne aufzugeben, sondern neu zu denken und zu organisieren. Ob genossenschaftliche Ansätze für die Produktion von Lebensmitteln oder deren regionaler Vertrieb in gemeinsam betriebenen Läden und Cafés, ob das Teilen von selten benutzten Dingen oder das Reparieren in Stadtteilläden: Es gibt so viele Ansätze, die das Leben für alle lebenswerter machen könnten. Nie zuvor waren die Möglichkeit so zahlreich.
Manche sagen, ganz gleich, welche Anstrengung wir auch unternehmen: Es ist eh zu spät!
Lange Jahre waren wir uns der globalen sozialökologischen Krise nicht bewusst. Mittlerweile kann jedoch kaum jemand behaupten, noch nie etwas von Klimawandel, Artensterben, schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen oder den Problemen der Massentierhaltung gehört zu haben. Durch dieses wachsende Bewusstsein sind wir mehr denn je in der Verantwortung, die Verhaltens- und Wirtschaftsweisen, die zur Krise geführt haben, umzustellen. Es braucht sicher eine gute Portion Optimismus, um überzeugt zu sein, dass wir die gesteckten Nachhaltigkeitsziele tatsächlich noch erreichen. Doch es nicht zu versuchen, ist für mich keine Alternative. Ich halte es mit dem Aphorismus von Václav Havel: "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht."