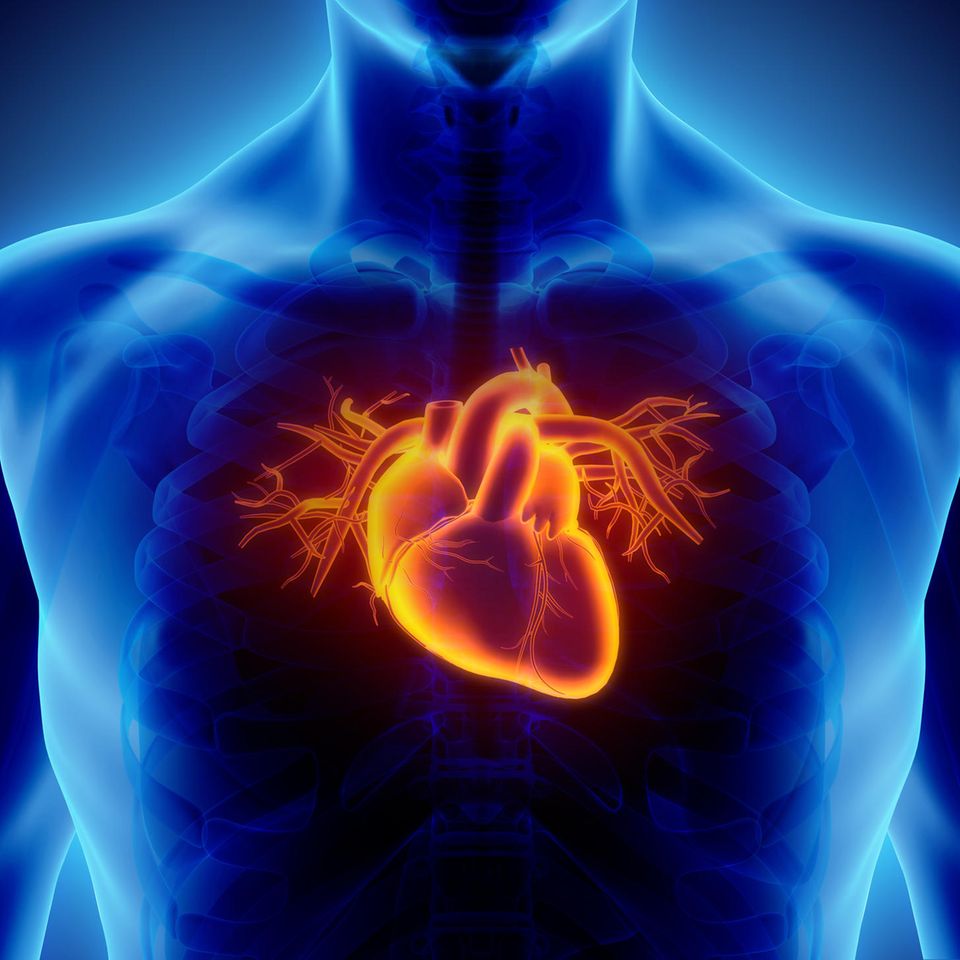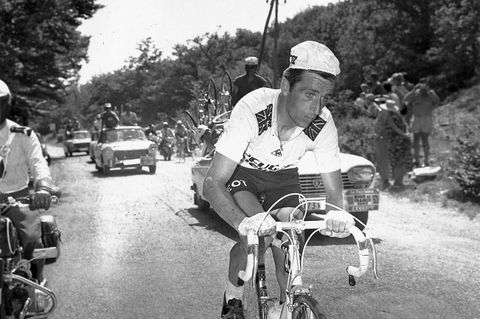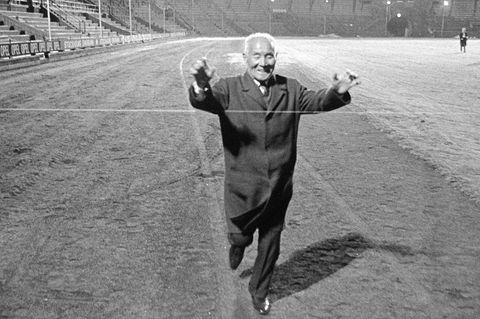Dopingskandale überschatten immer wieder sportliche Großveranstaltungen wie die Tour de France oder die Olympischen Spiele. Während die einen für einen sauberen Wettbewerb kämpfen, wünschen sich jedoch andere inzwischen die völlige Abschaffung aller Dopingregeln im Spitzensport. So ist Doping bei den sogenannten "Enhanced Games" ausdrücklich erwünscht. Bei dem für 2025 geplanten Event sollen durch den Einsatz leistungssteigernder Substanzen neue Weltrekorde aufgestellt werden. Zahlreiche Athletinnen und Athleten, das Internationale Olympisches Komitee (IOC) und die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) schlagen Alarm und verweisen auf die hohen Risiken durch den Missbrauch von Dopingmitteln. Folgende Übersicht zeigt die aktuell bei ausgewerteten Dopingtests am häufigsten festgestellten verbotenen Substanzen und Methoden.
1. Anabole Substanzen

- Dopingmittel: Stanozolol, Drostanolon, Metandienon, Clenbuterol
- Dopingziel: Anabolika haben vor allem einen Einfluss auf den Aufbaustoffwechsel (Anabolismus) im menschlichen Körper. Durch die Steigerung der Proteinsynthese lassen sich bei gleichzeitigem intensiven Training beispielsweise Muskeln schneller aufbauen. Außerdem können sie die Regenerationsfähigkeit erhöhen. Clenbuterol besitzt zusätzlich eine bronchienerweiternde Wirkung, die die Atmung und somit die Ausdauerleistung verbessern kann.
- Gefahren: Die Nutzung anaboler Substanzen kann schwerwiegende gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen Akne, Arterienverkalkung, ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte und Thrombosen und erhebliche Leberschäden. Der langfristige Gebrauch kann auch zu hormonellen Veränderungen führen sowie psychische Probleme wie Depressionen oder gesteigerte Aggressivität verursachen.
- Sportart: Besonders verbreitet im Bodybuilding, Gewichtheben und in der Leichtathletik. Diese Sportarten profitieren stark von der erhöhten Muskelmasse und -kraft. Anabolika werden häufig über einen längeren Zeitraum vor dem Wettkampf eingenommen. Deswegen können Dopingtests auch schon in den Trainingsphasen stattfinden. Der Einsatz von Anabolika erfolgt aber auch in anderen leistungsorientierten Sportarten, um die physische Belastbarkeit und die Regenerationszeit zu optimieren.
2. Stimulanzien
- Dopingmittel: Kokain, Amphetamin, Ephedrin, Methylphenidat (Ritalin)
- Dopinziel: Stimulanzien werden als Aufputschmittel konsumiert und steigern die Aufmerksamkeit und Konzentration. Ihre Wirkung ist vergleichbar mit den körpereigenen Stresshormonen Adrenalin und Noradrenalin. Sie reduzieren Müdigkeit und können die Reaktionszeit verbessern. Die Herzfrequenz und die Durchblutung der Muskulatur werden erhöht, wodurch es zu einer kurzfristigen Leistungssteigerung kommen kann. Auch die Stimmungslage und das Selbstvertrauen werden oft gehoben.
- Gefahren: Stimulanzien bewirken, dass auch bei extremer Belastung kein Übermüdungsgefühl auftritt. Körperliche Reserven werden bis zur völligen Erschöpfung aufgebraucht. Als folgenschwere Konsequenzen können Atemlähmungen und Herzinfarkte auftreten. Auch kann es zu Schlaflosigkeit und psychischen Problemen wie Angststörungen und Depressionen kommen. Der regelmäßige Konsum von Stimulanzien kann zu einer psychischen Abhängigkeit führen.
- Sportart: In vielen Sportarten weit verbreitet. Stimulanzien werden häufig im Ausdauer-, Schwimm-, Rad-, oder Mannschaftssport genutzt, um die kurzfristige Leistungsfähigkeit zu steigern.
3. Diuretika und Maskierungsmittel
- Dopingmittel: Furosemid, Hydrochlorothiazid, Canrenon, Hydroxyethylstärke
- Dopingziel: Diuretika dienen nicht der Leistungssteigerung, sondern werden dazu verwendet, die Nachweisbarkeit anderer Dopingmittel zu erschweren. Die Einnahme führt zu erhöhter Urinausscheidung und damit zur Verdünnung und Ausschwemmung verbotener Substanzen. Sie werden daher auch als Maskierungsmittel bezeichnet. Diuretika finden zudem Anwendung in Sportarten, die in Gewichtsklassen unterteilt sind. Die Einnahme kann durch den hohen Flüssigkeitsverlust innerhalb weniger Stunden eine Gewichtsreduzierung von bis zu drei Kilogramm bewirken und so den Start in einer niedrigeren Gewichtsklasse ermöglichen. Auch Hydroxyethylstärke ist ein Maskierungsmittel, zählt jedoch nicht zu den Diuretika. Diese Substanz kann das Blut verdünnen, um beispielsweise die Einnahme von Erythropoietin (EPO) zu verschleiern, und wird auch als Plasmaexpander bezeichnet.
- Gefahren: Die größte Gefahr von Diuretika ist ihre entwässernde Wirkung. Die Ausscheidung von Mineralstoffen führt zu Problemen im Elektrolythaushalt. Es kann zu starken Magen-Darm-Beschwerden und einer Störung des Herz- Kreislauf-Systems kommen. Plasmaexpander bewirken im Extremfall asthmaähnliche Zustände bis zum Atem- und Kreislaufstillstand.
- Sportart: Diuretika werden häufig beim Boxen, Gewichtheben, Ringen und Judo verwendet, um die Gewichtsklasse zu beeinflussen. Zudem in allen anderen Sportarten, um die Einnahme von Dopingmitteln zu verschleiern.

4. Hormone und Stoffwechsel-Modulatoren
- Dopingmittel: Insulin, Tamoxifen, Trimetazidin, Erythropoietin (EPO), Somatropin
- Dopingziel: Zu dieser Dopingklasse zählen Substanzen, die in den körpereigenen Stoffwechsel eingreifen. Sie können unterschiedlichste Effekte haben. Insulin reguliert den Blutzuckerspiegel, indem es die Aufnahme von Glukose in die Zellen fördert. Als Dopingmittel missbraucht, kann es die Glykogenspeicher in den Muskeln vergrößern und die Muskelmasse steigern. Tamoxifen kann Nebenwirkungen von Anabolika unterdrücken und führt bei Männern zu einer gesteigerten Testosteron-Ausschüttung. Dieses fördert unter andrem die Zunahme der Muskelmasse. Trimetazidin wird als Medikament bei Herzerkrankungen eingesetzt. Es hilft, die Effizienz der Zellen zu steigern, indem es den Stoffwechsel von Fettsäuren auf Glukose umstellt. Das Mittel verhilft zu Energie, steigert die Ausdauer, und die Muskeln ermüden nicht so schnell. EPO ist ein Hormon, das die Produktion von roten Blutkörperchen stimuliert. Dadurch kann das Blut mehr Sauerstoff transportieren, um die Ausdauerleistung zu erhöhen. Somatropin ist ein Wachstumshormon und kann das Knochen- und Muskelwachstum anregen.
- Gefahren: Die Einnahme von Hormonen und Stoffwechselmodulatoren kann zu schwersten gesundheitlichen Schäden führen. Dazu zählen krankhaftes Wachstum von Organen und Gliedmaßen, Herz-Kreislauf-Probleme und ein erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen und Herzinfarkte.
- Sportart: Die Substanzen werden in einer Vielzahl von Sportarten eingesetzt, darunter Bodybuilding, Gewichtheben und Ausdauersportarten, um die körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern und die Erholungszeit zu verkürzen. EPO wird oftmals im Radsport eingesetzt, Trimetazidin ist bei den Olympischen Spielen 2024 in den Schlagzeilen wegen mutmaßlicher Verwendung durch chinesische Schwimmerteams.
5. Glukokortikoide
- Dopingmittel: Prednison, Dexamethason, Hydrocortison, Prednisolon
- Dopingziel: Glukokortikoide sind Steroidhormone aus der Nebennierenrinde. Sie reduzieren Entzündungen und Schwellungen im Gewebe, wodurch Schmerzen verringert werden. Das ermöglicht Athletinnen und Athleten trotz Verletzungen oder intensiver Trainingsbelastungen weiterhin leistungsfähig zu bleiben. Ihre Wirkung auf den Kohlenhydrat-, Protein- und Fettstoffwechsel kann ebenfalls kurzfristige Leistungssteigerungen ermöglichen.
- Gefahren: Die langfristige Anwendung von Glukokortikoiden kann zu Osteoporose, Magengeschwüren und einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionen führen. Nach dem Absetzen der Substanzen kann die Funktion der Nebenniere gestört sein.
- Sportart: Glukokortikoide werden in einer Vielzahl von Sportarten eingesetzt, insbesondere in solchen, in denen häufig Verletzungen auftreten oder in denen man ständigen hohen körperlichen Belastungen ausgesetzt ist. Dazu gehören beispielsweise Fußball oder Rugby. Auch in Ausdauersportarten wie Marathonlauf oder Radfahren werden sie verwendet, um die Regeneration zu beschleunigen und die Erholungszeit zwischen den Wettkämpfen zu verkürzen.
6. Beta-2-Agonisten
- Dopingmittel: Terbutalin, Vilanterol, Salbutamol, Clenbuterol
- Dopingziel: Beta-2-Agonisten sind Medikamente, die hauptsächlich zur Behandlung von Asthma und anderen Atemwegserkrankungen eingesetzt werden. Sie stimulieren bestimmte Rezeptoren (β2-Adrenozeptoren) in den Atemwegen. Das führt zu einer Erweiterung der Bronchien, einer verbesserten Sauerstoffaufnahme und einer Steigerung der Atemkapazität. Dadurch wird die Ausdauerleistung erhöht. Teilweise haben Beta-2-Agonisten wie Clenbuterol auch anabole Effekte, die den Muskelaufbau unterstützen.
- Gefahren: Die Nebenwirkungen von Beta-2-Agonisten betreffen vor allem das Herz. So zählen eine Schwächung des Herzmuskels, Herzrhythmusstörungen und Herzinfarkte zu den häufigsten Gefahren.
- Sportart: Beta-2-Agonisten werden besonders in Ausdauersportarten wie Radfahren, Laufen und Schwimmen verwendet, in denen eine erhöhte Atemkapazität und eine verbesserte Ausdauer von Vorteil sind. Auch beim Gewichtheben und Bodybuilding werden sie eingesetzt, um Muskelmasse und -kraft zu steigern.
7. Blutdoping
- Dopingmittel: Eigen- und Fremdbluttransfusionen, EPO
- Dopingziel: Blutdoping umfasst verschiedene Methoden, um die Anzahl der roten Blutkörperchen im Körper zu erhöhen. Beim Eigenblutdoping wird den Athletinnen und Athleten einige Wochen vor dem Wettkampf Blut entnommen, nachdem die Anzahl der roten Blutkörperchen durch Höhentraining oder EPO erhöht wurde. Anschließend wird die Blutprobe zentrifugiert, um die roten Blutkörperchen zu konzentrieren, und mit einem Gerinnungshemmer versetzt. Kurz vor dem Wettkampf, wenn der Körper wieder Blut nachgebildet hat, wird den Athletinnen und Athleten zusätzlich per Transfusion das eingelagerte Blut zurückgeführt, um so die Anzahl an roten Blutkörperchen zu erhöhen. Dadurch wird der Sauerstofftransport im Körper erhöht. Zu den gewünschten Effekten zählen eine verbesserte Atemkapazität und verzögerte Ermüdungserscheinungen. Fremdblutdoping erfolgt ohne vorherige Blutentnahme mit manipuliertem fremden Blut direkt vor dem Wettkampf.
- Gefahren: Blutdoping erhöht die Viskosität des Blutes und steigert damit das Risiko von Blutgerinnseln, Schlaganfällen und Herzinfarkten. Bei unsachgemäßer Durchführung von Bluttransfusionen besteht zudem die Gefahr von Infektionen.
- Sportart: Blutdoping wird hauptsächlich in Ausdauersportarten wie Radfahren, Langstreckenlauf oder im Schwimmsport eingesetzt, in denen ein hoher Sauerstofftransport für die Leistungsfähigkeit entscheidend ist.