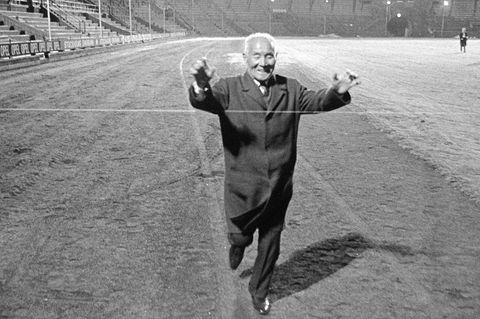Mehr als 100 Jahre lang war die Seine für die Pariser tabu. Schwimmen war gesundheitsgefährdend, das Wasser zu dreckig. Für die Olympischen Spiele 2024 investierte die Stadt deshalb ordentlich: Mit 1,4 Milliarden Euro sollte der Fluss wieder so sauber gemacht werden, dass Athletinnen und Athleten ohne Bedenken darin schwimmen können. Kurz vor Beginn der Spiele sprang sogar die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, begleitet von Dutzenden Kameras, ins Wasser.
Es wurde trotzdem knapp. Bis kurz vor Olympia-Start waren die Laborergebnisse nicht gut genug. Am Ende musste der Triathlon der Männer wegen der mangelnden Wasserqualität verschoben werden, und nur wenige Stunden vor dem zweiten Termin gab die Stadt Entwarnung: Die Wasserqualität sei wieder in Ordnung, die Wettkämpfe konnten stattfinden.
Wenige Tage später erkrankte die belgische Triathletin Claire Michel. Das teilte das belgische Nationale Olympische Komitee (BOIC) am Sonntag mit und stellte einen Zusammenhang zur schlechten Wasserqualität der Seine her. "Das BOIC und Belgian Triathlon hoffen, dass daraus Lehren gezogen werden für die nächsten Triathlonwettbewerbe bei den Olympischen Spielen", heißt es in der Stellungnahme. Weitere Angaben zu den medizinischen Details Michels Erkrankung machte das BOIC nicht.
Am Sonntagabend gab es dennoch grünes Licht für den Start der Mixed-Staffel am Montagmorgen – ohne belgisches Team. Die Seine sei sauber genug, verkündeten die Organisatoren. Doch was bedeutet das eigentlich: sauber?
Welche Werte bestimmen die Sauberkeit eines Flusses?
Ob ein Fluss sauber genug zum Schwimmen ist, entscheiden mehrere Faktoren. Treiben Flaschen, Plastikfolien oder Tüten im Wasser, ist die Verschmutzung offensichtlich. Doch auch auf chemischer und auf mikrobiologischer Ebene lauern Gefahren in Form von Schadstoffen und Bakterien. EU-Staaten etwa müssen ihre Flüsse und Seen auf 45 verschiedene Chemikalien überprüfen. Für jeden Stoff gibt es eine zulässige Höchstkonzentration, ab der es für Menschen, Tiere oder Pflanzen giftig wird. Landen beispielsweise viel Phosphor und Stickstoff im Wasser, kann das außerdem die Entwicklung von Blaualgen, also Cyanobakterien begünstigen. Schwimmen zu viele davon im Wasser, lösen die von ihnen produzierten Giftstoffe Bindehautentzündungen und Hautausschläge aus. Wer sich an dem verunreinigten Wasser verschluckt, leidet danach womöglich an Durchfall, Erbrechen, Fieber oder sogar Atemnot.
Im Fall der Seine spielen Escherichia coli (E. coli) und Intestinale Enterokokken eine entscheidende Rolle. Beides sind Darmbakterien, die mit Fäkalien ins Wasser gelangen. Ihre Menge wird in "colony-forming units" (CFU) gemessen. Eine CFU ist ein einzelnes Bakterium, das sich schnell vermehrt und eine Kolonie von Bakterien bilden kann.
Damit die Qualität eines Flusses als ausreichend gilt, dürfen nicht mehr als 330 E. Coli in 100 Millilitern Wasser vorkommen. Für Enterokokken gilt ein Höchstwert von 900 CFU pro 100 Milliliter. Die Überwachungsgruppe Eau de Paris hat Ende Juni zum Teil Werte von 2000 E.-Coli-Bakterien in der Seine festgestellt, am Mittwochmorgen, dem 31.7., lag der Wert wieder unter dem Grenzwert. Die Enterokokken blieben stets unter dem höchsten zulässigen Wert.
Was beeinflusst die Wasserqualität?
Vier Umweltfaktoren haben einen großen Einfluss auf die Qualität des Flusswassers. Das größte Problem für Paris ist Regen. Er fließt in die gleiche Kanalisation wie das Abwasser der Stadt. Prasselt zu viel Wasser auf einmal nieder, überschwemmt es die Kanalisation: Die Rohre halten nicht Stand und das Abwassersystem läuft über. Dann fließen Kot, Urin und Spülwasser unbehandelt in die Seine. Führt der Fluss nach einer Hitzeperiode besonders wenig Wasser, wirkt sich der Regen noch dramatischer auf die Wasserqualität aus. Der Anteil des Abwassers in Relation zum Flusswasser ist dann besonders hoch.
Spätestens dann wird die Fließgeschwindigkeit wichtig: Je schneller der Fluss fließt, desto schneller wird der Dreck rausgespült. Durch die Seine strömen im Sommer nach Angaben der Stadt zwischen 50 und 150 Kubikmetern pro Sekunde. Außerhalb der Sommermonate kann die Durchflussmenge Spitzenwerte von bis zu 600 Kubikmetern pro Sekunde erreichen.
Scheint die Sonne, sieht es besser aus: UV-A-Strahlung kann die DNA von Bakterien schädigen. Dieser Vorgang nennt sich solare Wasserdesinfektion. Die langen Tage in den Sommermonaten helfen dem Fluss also dabei, sich der Bakterien zu entledigen.
Theoretisch kann auch eine erhöhte Wassertemperatur dazu führen, dass Bakterien sterben. Dann werden auch einige Mikroorganismen aktiver, die Bakterien fressen. Andererseits gibt es Bakterien wie die Cyanobakterien, die sich bei 25 Grad Celsius besonders wohlfühlen und stark vermehren.
Wie lässt sich Abwasser vom Fluss fernhalten?
Damit die Sportlerinnen und Sportler in der Seine schwimmen können, baute Paris im Vorfeld ein unterirdisches Wasserspeicherbecken mit einem Fassungsvermögen von 50.000 Kubikmetern. Becken wie dieses sollen verhindern oder zumindest hinauszögern, dass die Kanalisation bei Starkregen überläuft. Auch Hausboote sind in Paris jetzt an die Kanalisation angeschlossen, sodass ihr Abwasser nicht mehr ungefiltert im Fluss landet.
In neueren Gebieten gibt es außerdem ein Trennsystem, bei dem Abwasser und Regenwasser nicht zusammen gespeichert werden. Das Regenwasser wird getrennt aufgefangen und direkt in umliegende Gewässer oder in eine Versickerungsanlage abgeleitet. Neben diesen "grauen Lösungen" wie Kanälen und Auffangbecken gibt es "grüne Lösungen". Wiesen, grüne Dächer und nicht versiegelte Böden sorgen dafür, dass Wasser versickert und natürlich gefiltert wird, ohne dass es vorher durch Kanäle laufen muss.
Wie säubert man einen Fluss?
Ist der Dreck bereits im Fluss, helfen Kläranlagen. Dort filtern Rechen zunächst groben Schmutz, etwa Müll oder Essensreste, aus dem Wasser. Danach kommt das Wasser in ein Becken, in dem sich Sand und Schlick absetzen. Im nächsten Schritt zersetzen Mikroorganismen weitere Verschmutzungen und verwandeln sie etwa in Kohlendioxid oder Wasser. Zuletzt wird das Wasser desinfiziert. Das passiert häufig mit UV-Licht, Ozon oder Chemikalien wie Chlor. All das soll jegliche Keime vernichten. Schadstoffe können allerdings immer noch enthalten sein.