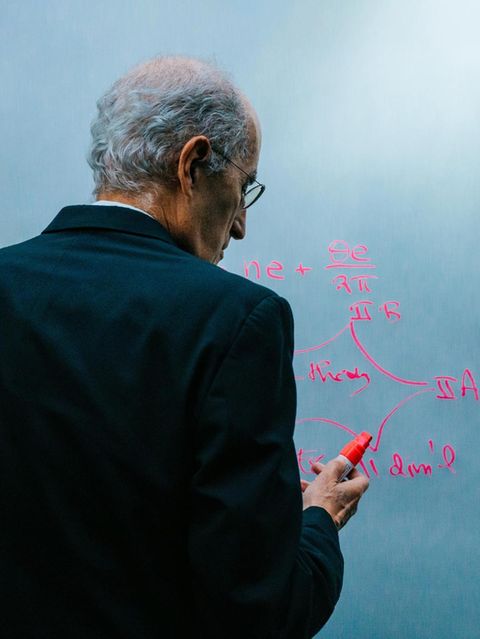GEO: Herr Konrad, Sie helfen Menschen, die nach einem Todesfall in einen Erbstreit geraten. Worum geht es bei diesen Auseinandersetzungen?
Stephan Konrad: Ich versuche in meinen Gesprächen mit Betroffenen immer, zu deren Gefühlen vorzudringen. Denn die stehen meist, mal verschleiert, mal offensichtlich, im Mittelpunkt des Konflikts. Zwar handelt es sich nicht um eine Therapie, aber der Effekt kann durchaus ähnlich sein: Menschen beginnen, sich selbst oder die Beziehung zu jemand anderem besser zu verstehen, setzen sich mit einer lang verdrängten Empfindung auseinander oder finden einen neuen Umgang miteinander.