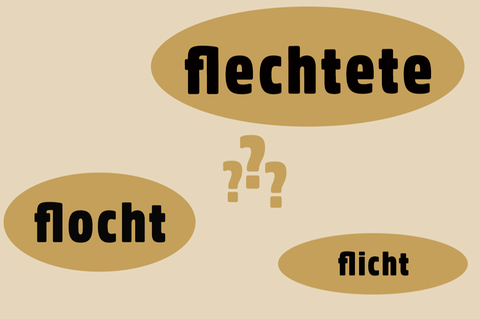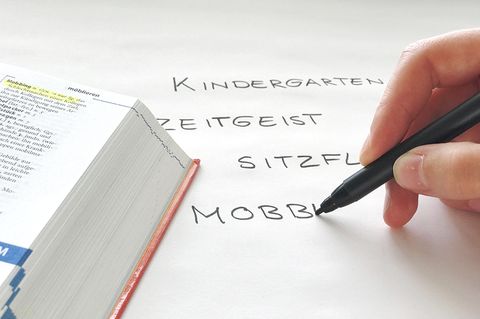Erziehung, Kultur, Vorbilder – sie alle formen unsere moralischen Grundsätze. Doch diese Werte sind weniger gefestigt, als wir denken. Eine Forschungsgruppe der Universidad Nebrija in Madrid konnte zeigen: Wechseln wir in eine Fremdsprache, verschiebt sich auch unser innerer Kompass.
Dafür ließ das Team über 200 Probanden, die von Haus aus Spanisch sprachen und in der Schule Englisch gelernt hatten, ein moralisches Dilemma lösen: Würden Sie einen unschuldigen Menschen von einer Fußgängerbrücke stoßen, um einen herannahenden Zug zu stoppen, der sonst fünf an die Gleise gefesselte Menschen töten würde? Die Hälfte der Teilnehmenden las und beantwortete die Aufgabe auf Spanisch, die andere Hälfte auf Englisch.
Das Ergebnis: 9 Prozent der Muttersprachler und 32 Prozent der Fremdsprachler gaben an, den Menschen zu schubsen. Auffällig waren auch die Unterschiede, wie die Probanden ihre Entscheidung begründeten: Wer in seiner Muttersprache redete, nutzte häufiger emotionale Begriffe wie "Schuld". Auch die Sorge, Gesetze zu brechen, spielte für sie eine größere Rolle. In der Zweitsprache formulierten die Teilnehmenden dagegen tendenziell rational-utilitaristischere Argumente – etwa: "Es ist unzulässig, einen Massentod in Kauf zu nehmen." Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Studien anderer Forschungsgruppen mit italienischen und chinesischen Muttersprachlern.
Unsere Muttersprache lernen wir in einer natürlichen Umgebung, etwa in der Familie. Die Forschenden erklären, dass wir daher auch später, wenn wir diese Sprache benutzen, emotionaler denken und uns ausdrücken. Verstärkt wird dieser Effekt dadurch, dass wir in unserer ersten Sprache einen direkteren Zugang zu autobiografischen Erinnerungen haben – Erinnerungen, in denen wir soziale Normen wie "Du sollst niemanden schubsen" erlernt haben.
Zweitsprachen hingegen erwerben wir meist in einem neutraleren Kontext wie der Schule. Unser Zugang durch sie zur Welt ist somit weniger emotional. Deshalb entscheiden wir auf einer Fremdsprache eher rational-utilitaristisch, also nach dem Prinzip: "Wie kann ich die meisten Menschen retten?" In einer weiteren Studie zeigte das Forschungsteam, dass dieser Effekt auch seine positiven Seiten hat: Die emotionalere Distanz erleichterte es den Teilnehmenden freier über Tabuthemen wie Untreue, Homosexualität oder Tod zu reden.