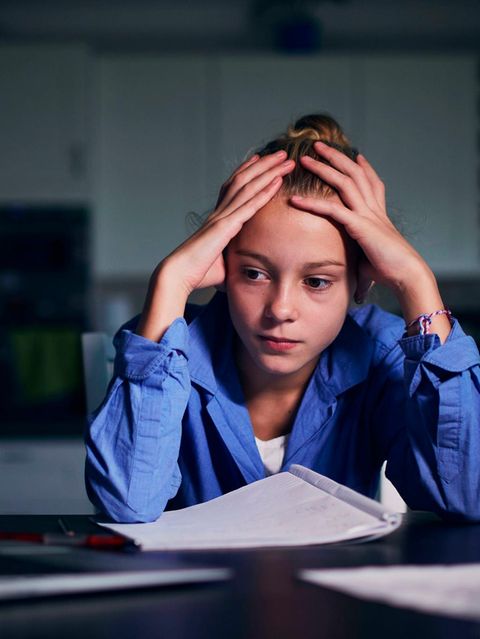Gedränge, Geschubse, Geschrei – auf dem Gang des Provinzkrankenhauses in Altai herrscht Tumult. Aufgebrachte Menschen drohen, das Arztzimmer zu stürmen. Lautstark treibt ein stämmiger Mann in Operationskleidung die Traube zurück und schließt die Tür, die Chaos von Ruhe trennt. Drinnen atmet eine Frau im weißen Kittel auf. Darunter trägt sie ein modisches Kleid mit Spitzenbesatz, dazu cremefarbene Stöckelschuhe, Lippenstift und eine Spange, die ihr pechschwarzes Haar am Schopf zusammenhält. Dr. Nara nimmt einen Schluck Milchkaffee aus ihrer Thermoskanne und streicht sich die Strähnen aus dem Gesicht, das aussieht wie mit weichem Bleistift gezeichnet. Die 44-jährige Ärztin wirkt gelassen, obwohl sie weiß, was vor der Tür auf sie wartet.
Dr. Nara heißt eigentlich Naranjargal Dashdorj. Aber mongolische Namen sind Zungenbrecher, das finden manchmal sogar die Einheimischen. Der Einfachheit halber nennen sie einander oft bei gekürzten Vor- oder Nachnamen. Selbst der Präsident des Landes, Ukhnaa Khurelsukh, heißt hier schlicht: Huuk.

Für die Ungeduldigen im Krankenhaus ist Dr. Nara gerade weitaus wichtiger als der Präsident. Sie ist eine von ihnen. Und eine Heldin. Die Biografie der Ärztin klingt wie ein Märchen: Ein kleines Mädchen wächst in der Steppe auf; durch Fleiß, Talent und Intelligenz erarbeitet sie sich als junge Frau eine Karriere in fernen Ländern. Und schließlich kehrt sie zurück, um ihre Heimat vor einem tödlichen Gespenst zu retten: der Hepatitis.
Mehr als 350 Millionen Menschen auf der Erde leben mit einer chronischen Hepatitis-Infektion. Die Viruserkrankung gilt als eine der Hauptursachen für Leberzirrhose und Leberkrebs, an dem weltweit rund 1,3 Millionen Menschen im Jahr sterben, mehr als an den Folgen von HIV und Aids. Mehr als 90 Prozent aller Infizierten leben in Ländern mit niedrigen und mittleren Pro-Kopf-Einkommen. In Ländern wie der Mongolei, wo die weltweit höchste Leberkrebs-Sterberate verzeichnet wird. Impfungen und Medikamente dagegen gäbe es generell. Doch in der Mongolei sind die Wege weit und die Mittel knapp, ist die medizinische Versorgung rudimentär.
Außerdem wissen 95 Prozent der Patientinnen und Patienten gar nichts von ihrer Hepatitis-Infektion. Da die Krankheit teils unspezifisch oder weitgehend symptomlos verläuft, erfahren viele erst Jahre, mitunter gar Jahrzehnte später, dass sie sich angesteckt haben. Dann allerdings sind Schäden an der Leber oftmals so fortgeschritten, dass jegliche Behandlung zu spät kommt. Hepatitis ist eine stille Epidemie.
Ein Land, hunderttausende Infizierte
Frühzeitige Diagnosen erhöhen die Überlebenschancen. Darum gründete Dr. Nara mit ihren Brüdern Naranbaatar und Tulgabaatar die NGO Onom Foundation mit dem Ziel, Hepatitis in ihrer Heimat zu eliminieren. Nun reist sie mit einem fünfköpfigen Team regelmäßig durch das riesige Land, um auf Hepatitis zu testen, auch in den abgelegensten Winkeln der Mongolei. Dr. Naras Reise nach Altai ist nicht nur für die infizierten Menschen etwas Besonderes, sondern auch für die Ärztin: Sie kehrt an ihren Geburtsort zurück.

Die Stadt Altai liegt am Rand der Wüste Gobi, mehr als 1000 Kilometer südwestlich der Millionenmetropole Ulaanbaatar und inmitten einer der unwirtlichsten Gegenden der Welt: baumlos, strauchlos, endlos. Eine Provinzstadt mit etwa 19 000 Menschen, in der um Mitternacht der Strom abgeschaltet wird und die vielen Karaokebars plötzlich verstummen. Ein Ort in ausgewaschenen Pastellfarben, einzig der Himmel strahlt in Blau. Die Sommer sind heiß und trocken, die Winter brutal eisig, mit Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius. Gobi-Altai gilt als ärmste Provinz der Mongolei, nach Maßstäben der UNO ist hier jeder zweite Mensch von absoluter Armut betroffen. Gleichzeitig herrscht in der Region eine erhöhte Rate bei Krebserkrankungen – sowohl Magen- und Speiseröhren- als auch Leberkrebs.
Fernab der Hauptverkehrsader, die durch Altai führt, liegt eine Jurtensiedlung: ein Gelände ohne geteerte Straßen, in dem sich ein Hof an den nächsten reiht, getrennt durch marode Holzlatten, verbunden durch Stromleitungen. Zwischen den Jurten stehen Bretterverschläge und kleine Rohbauten, eine einsame Bushaltestelle und eine Bruchbude, in der sich ein Kiosk verbirgt. Dahinter Menschenleere und Schotterpisten, die in rotbraunen Hügelketten enden.
"Geh studieren, werde keine Hausfrau"
Vor 23 Jahren hat Dr. Nara ihren Geburtsort zuletzt gesehen. Während des Spaziergangs durch ihr einstiges Viertel verläuft sie sich: zweimal, dreimal, viermal. Auf nahezu jedem Hof bellt ein angeketteter Hirtenhund. Auf dem Erdboden liegen Tierknochen, Scherben und leere Wodkaflaschen. Auf den Dächern der Jurten ragen Solarpaneele und Satellitenschüsseln in den Himmel. Es riecht nach Wermutkraut, Estragon, Wacholder, herb, bitter, wild. Schließlich erkennt Dr. Nara das Grundstück, auf dem sie aufwuchs und das nun von einer anderen Familie bewohnt wird. Über den Zaun blickt sie in ihre Vergangenheit. "Alles wie damals", sagt sie, "nichts hat sich verändert. Gar nichts. Nicht einmal der Bretterzaun wurde erneuert."

Hier hütete sie einst Schafe und Ziegen, lernte Reiten und Bogenschießen. Hier ging sie eines Winters in der weglosen Wildnis verloren und zog sich Erfrierungen im Gesicht zu, unter denen sie bis heute bei Minusgraden leidet. Hier wuchs Dr. Nara – mit Vater, Mutter und den beiden Brüdern – in einer Jurte auf, in der das gesamte Leben einer Familie Platz finden musste.
Die meiste Zeit ihrer Kindheit und Jugend verbrachte Nara nebenan bei der Großmutter, einer spirituellen Frau, die Kraft aus dem Schamanismus schöpfte. Sie gewährte dem Mädchen Wärme, Ruhe und Orientierung. Und schärfte ihrer Enkelin ein: "Ich soll die letzte Analphabetin unserer Familie bleiben. Geh studieren, werde keine Hausfrau."
Während Nara heranwuchs, litt die Mongolei unter dem Zusammenbruch der Sowjetunion. In dem ehemaligen Satellitenstaat der UdSSR waren die 1990er-Jahre überschattet von Misswirtschaft. Naras Eltern konnten sich damals nicht einmal genügend Mehl leisten und brachten die Familie nur mit Mühe über die Runden. Seine Bekleidung nähte sich das Kind selbst.

Also wurde Naras Vater, eigentlich Lehrer von Beruf, erfinderisch. Er erkannte eine Schwachstelle des gängigsten Motorradmodells in der Mongolei, der russischen IZH Planeta, und begann, jenes Teil selbst herzustellen, das früher oder später als Ersatz benötigt wurde: die Kupplungstrommel. "Er war damals schon ein sturer Mann mit Visionen, der uns Kinder wie Erwachsene behandelte", erzählt die Ärztin. Sie und ihre Brüder halfen bei der Produktion des zahnradähnlichen Metallstücks und bekamen dafür auch einen Lohn.
Mit Leichtigkeit verbrachte Nara die Vormittage in der Schule. Mit Eifer und Engagement sägte sie nachmittags Zacken aus Metallplatten. Nebenbei lernte sie, Tiere zu zerlegen, ihre Innereien zu säubern. Gründlich und detailverliebt. "Möchte man Chirurgin werden, ist es ein Vorteil, hier aufzuwachsen", sagt sie.
Kaum greifbare Bedrohung
In jener Zeit infizierten sich Zehntausende, womöglich Hunderttausende Mongolinnen und Mongolen mit Hepatitis. In den Krankenhäusern mangelte es an Wissen und an medizinischen Hilfsmitteln; Spritzen wurden immer wieder benutzt, ohne sie zu desinfizieren. Menschen, die zum Arzt mussten, hatten ein teils fünffach erhöhtes Risiko, sich mit Hepatitis B anzustecken. Viele der Kinder, die damals gegen Masern oder gegen Tuberkulose geimpft wurden, sind heute bei Dr. Nara in Behandlung.
Im Krankenhaus von Altai, in dem die Ärztin einst geboren wurde, vermischt sich heute der Geruch von Desinfektionsmittel mit dem Duft von salzigem Milchtee und gekochtem Hammel. Holzverkleidete Wände, Linoleumböden und Deckenspots, die ein grelles Licht in den Raum strahlen. Dazwischen Fenster, staubig und verschmiert. Überall Fliegen.

Mittlerweile überrennen die Patienten die Rezeption. Wie üblich hat die Mundpropaganda funktioniert, und für große Resonanz sorgte auch die Ankündigung über Facebook, eine Plattform, die sehr viele der 3,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Mongolei nutzen: Dr. Nara und ihr Team machen ein Screening in Altai.
Die Daten der Reihenuntersuchung fließen in immer genauere Studien ein. Die Onom Foundation leitet etliche davon, etwa darüber, ob Hepatitis D sexuell übertragbar ist, ob Hepatitis die Immunogenität der Covid-19-Impfungen beeinflusst oder ob es günstigere und einfachere Wege gibt, auf eine Infektion mit Hepatitis D zu testen.
Dr. Naras Behandlungszimmer wird nun doch gestürmt, die Menschen umzingeln ihren Schreibtisch. Trotz des anarchischen Trubels bewahrt sie die Ruhe, duldet das Chaos. In Windeseile liest Dr. Nara Blutbefunde und interpretiert Ultraschallbilder, mit denen ihr die Patientinnen und Patienten vor der Nase herumwedeln. Mitteilungshefte, Mappen, lose Zettel, manche sind vergilbt, angeknabbert, eingerissen. Wie ein Highspeed-Rechner stellt die Ärztin die Diagnosen. Eine nach der anderen: "Hepatitis B." "Hepatitis C." "Hepatitis B und D." "Leberzirrhose." "Leberkrebs." "1,3 Zentimeter Leberläsion." "Nur eine Fettleber." "Drei Monate Sofosbuvir." "Dich nehmen wir in die klinische Studie auf." "Du musst unbedingt für weitere Untersuchungen nach Ulaanbaatar kommen." Zehn Stunden lang, ohne Pause.
Von der Hand in den Mund
Fünf Formen der Hepatitis sind derzeit bekannt in der Medizin, unterteilt werden sie in A bis E, Buchstaben, die über Leben und Tod entscheiden können. Während Infektionen mit Typ A oder E vor allem durch verunreinigtes Wasser und Essen erfolgen, wieder ausheilen und sich in der Regel nicht zu chronischen Krankheiten entwickeln, werden Hepatitis B, C und D durch Blut und andere Körperflüssigkeiten übertragen. Unbehandelt sind sie für beinahe alle Hepatitis-Todesfälle durch die Spätfolgen Leberzirrhose oder Leberkrebs verantwortlich.

Auch weil es mittlerweile wirkungsvolle Medikamente gegen Hepatitis C gibt, will die Weltgesundheitsorganisation diese Form bis 2030 so stark eindämmen, dass von einer weitgehenden Eliminierung gesprochen werden kann. Gegen Hepatitis B gibt es eine Impfung und für chronisch Erkrankte Medikamente, die die Virusvermehrung hemmen. Die große Gefahr bei Hepatitis-B-Infizierten: Dieser Erreger dient dem Hepatitis-D-Virus als Struktur. Da es für die Delta-Art aktuell keine Heilungsmöglichkeit gibt, gilt die Kombination aus Hepatitis B und D als schlimmste Form der Infektion. Die Weltgesundheitsorganisation geht von weltweit rund 12 Millionen gleichzeitig mit Hepatitis B und D Infizierten aus, die Dunkelziffer liegt vermutlich weit höher: andere Studien schätzen, dass bis zu 72 Millionen infiziert sein könnten.
Nahezu alle, die vor Dr. Nara Platz nehmen, haben mindestens eine Form der Hepatitis. Viele leben von der Hand in den Mund, sie haben Kriege überstanden, Fremdherrschaft, den Sozialismus. Doch die Bedrohung, die von der Hepatitis ausgeht, ist für sie kaum greifbar; Leberkrebs verursacht erst im fortgeschrittenen Stadium Beschwerden. Daher wirkt es oft so, als würde Dr. Naras Gegenüber nicht verstehen, dass es um die eigene Gesundheit geht, um das eigene Leben. Zurück bleibt eine verdutzte Ärztin. "Manche erinnern sich nicht einmal an ihr Geburtsdatum", sagt Dr. Nara. "Ob und wogegen sie jemals geimpft wurden, wo alte Testresultate sind, ob die Diagnose auf Hepatitis B, C oder D lautete, wissen sie dann natürlich auch nicht."
Das erschwert die Datensammlung. Dennoch hat die Onom Foundation in jahrelanger Kleinarbeit die wohl weltgrößte Datenbank mit Hepatitis-Betroffenen erstellt. "Das ist zwar der langweiligste, aber auch der wichtigste Teil unserer Arbeit", sagt Dr. Nara. "Nur so können wir Infizierte nach sechs Monaten zu einem Check-up einladen und fangen nicht jedes Mal bei null an." Selbst dann, wenn die Patientinnen und Patienten nicht mehr wissen, ob sie Hepatitis haben und in welcher Form, wann sie wogegen getestet, geimpft oder behandelt wurden: Dr. Nara weiß es. Mehr als 1,3 Millionen Screenings sind mittlerweile in ihren Unterlagen dokumentiert, Bestandsaufnahmen von einem guten Drittel der Gesamtbevölkerung der Mongolei.

In Altai kommen mehr als 200 neue Screenings hinzu. Als das Team am Ende erschöpft den Arbeitstag beenden will, läuft eine Frau auf die Gruppe zu. "Bitte nehmen Sie mich noch dran", fleht sie Dr. Nara an. "Tut mir leid", sagt diese, "für heute sind wir fertig." Tränen strömen der Frau über die Wangen, sie zittert, als sie von ihrer Odyssee berichtet: Sie und ihr Mann, beide schwer leberkrank, seien heute 200 Kilometer aus dem Distrikt Bugat hierhergefahren, um zu dem Screening zu kommen. Jeder in der Mongolei weiß, welche Strapazen für eine solche Reise in Kauf genommen werden müssen. Dr. Nara legt ihre Hand auf die Schulter der Frau und redet sanft auf sie ein. "Kommen Sie morgen früh um acht Uhr, dann machen wir einige Untersuchungen." Die Frau packt die Ärztin am Arm: "Danke!"
Stolz auf Moderne und Tradition
Schon mit 16 begann Nara, Medizin zu studieren, nachdem sie, die unterforderte Musterschülerin, verfrüht ihren ersten Abschluss gemacht hatte. Die Familie übersiedelte in einen schäbigen Vorort der Hauptstadt, wo Nara neben dem Studium auf dem Markt Schreibwaren und Kleider verkaufte, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ihre Noten waren derart herausragend, dass ihr – einer jungen mongolischen Frau – ein Stipendium einer der renommiertesten Universitäten Chinas angeboten wurde: des Peking University Health Science Center. Innerhalb eines Jahres lernte Nara Chinesisch; als sie 18 wurde, kauften ihr die Eltern ein Zugticket nach Peking. Aus dem kleinen, urtümlichen Altai kommend in eine der größten Städte der Welt: Nara lebte auf, lernte Freunde aus aller Welt kennen, fühlte sich, wie sie erzählt, ungezwungen und frei.
In China wurde Nara immer wieder von aus der Mongolei angereisten Diplomaten, Industriellen und Funktionären als Übersetzerin eingesetzt. Viele ihrer Landsleute kamen mit Leberproblemen nach China, Medizintouristen, von denen sich einige einer Lebertransplantation unterzogen. "Und in unserem Land war das einzige Medikament am Schwarzmarkt unbezahlbar", erzählt sie. "Viel schlimmer: Betroffene wussten nicht, dass sie krank waren, und die mongolischen Ärzte wussten nicht, wie sie die Erkrankung behandeln sollten."
Zu den Kranken in Peking gehörte eines Tages auch Naras Großonkel. Seine Diagnose: Hepatitis C, fortgeschritten, Leberkrebs. 18 Monate später war er tot. Nara fürchtete um das Leben ihrer Eltern, die ebenfalls infiziert nach China kamen, um sich untersuchen zu lassen. Beide konnten geheilt werden. Möglich war das nur durch die frühzeitige Erkennung der Krankheit, bevor die Infektion zirrhotisch und schließlich zu Leberkrebs werden konnte.

Eine Frage beschäftigte die angehende Ärztin seither: "Wie viele Landsleute sind mit Hepatitis infiziert und wissen darüber nicht Bescheid?" Nach der Promotion entschied sie sich, an einem der größten Krankenhäuser in China zu arbeiten. Fortan war das einstige "Mädchen aus Altai" Dr. Nara, Spezialistin für Lebertransplantationen. Ihr monatliches Gehalt: umgerechnet 144 Euro.
Anderthalb Jahre später veränderte ein Schicksalsschlag Dr. Naras Leben. Eines Wintermorgens läutete das Telefon: Es hatte einen Unfall gegeben. Beim Feuermachen hatte sich die Jurte ihrer Großmutter entzündet, und die alte Frau war verbrannt. "Hätte meine Großmutter in einem Haus mit Zentralheizung gelebt, wäre es nicht zu diesem Unfall gekommen." Natürlich wollte sie sofort nach Hause. Doch als Stipendiatin in einem Programm der chinesischen Regierung musste sie bei der Kommunistischen Partei vorsprechen. Erst nachdem sie von drei Gremien die Erlaubnis erhielt, durfte Dr. Nara das Land verlassen. "Mir wurde damals klar, dass ich nicht in China bleiben, sondern frei sein und mit meinen Fähigkeiten Geld verdienen wollte." Sie bewarb sich für ein Stipendium in Großbritannien. Und zog mit 26 Jahren nach Nottingham, um Neurowissenschaften zu studieren. Eine Herausforderung, die sie weitere sieben Jahre beschäftigen sollte.
Erste repräsentative Studie
In dieser Zeit reifte die Erkenntnis in ihr, dass nachträgliche Behandlungen an der Leber nicht die Lösung für das Hepatitis-Problem in der Mongolei sein können. Gemeinsam mit ihren beiden Brüdern, ebenfalls Wissenschaftler und zudem Unternehmer, gründete sie die Onom Foundation. Die Organisation führte erstmals in der Geschichte der Mongolei eine repräsentative Prävalenzstudie durch, um den Umfang des Hepatitis-Problems zu erfassen. Über mongolische Mobilfunkanbieter wurden eine halbe Million Bürgerinnen und Bürger auf einen Schlag kontaktiert. "Haben Sie schon einmal von Hepatitis gehört?", lautete die Nachricht. Das Telefon der NGO hörte nicht auf zu klingeln, die Menschen hatten unzählige Fragen und wurden in einem zweiten Schritt dazu aufgerufen, sich auf das Virus testen zu lassen.

Mit einem Team testete Dr. Nara landesweit Menschen im Schnellverfahren. Das war nur der Beginn der Studie, die in den folgenden Jahren immer weitere Kreise zog. Am Ende stand eine Zahl, mit der nicht einmal Dr. Nara gerechnet hatte: mehr als 400 000 Hepatitis-Infizierte, davon 250 000 mit Hepatitis B, 150 000 mit Hepatitis C. Jeder siebte Mensch in ihrem Land war damals betroffen, kaum eine Familie, in der niemand an Leberkrebs gestorben war. "Ich wusste damals von einem Medikament, das innerhalb von drei Monaten 90 Prozent der Hepatitis-C-Infizierten heilen würde", sagt die Ärztin. "Der Hersteller bot es armen Ländern kostengünstig an. Das war die Lösung!"
Die drei Geschwister entwarfen einen Masterplan zur radikalen Bekämpfung von Hepatitis C und präsentierten diesen im mongolischen Gesundheitsministerium. Es dauerte weitere 18 Monate, bis die Regierung überzeugt war, die mongolische Bürokratie einlenkte und das Projekt "Gesunde Leber" 2017 endlich lief. Bis 2030 soll Hepatitis C in der Mongolei eliminiert werden. Die Chancen stehen gut: Rund 60 000 Personen konnten bereits geheilt werden. Abzüglich der in der Zwischenzeit neu Infizierten und Verstorbenen entspricht das in etwa der Hälfte aller ursprünglich mit Hepatitis C Infizierten. Auch zur tödlichen Kombination aus Hepatitis B und D führt die Stiftung klinische Studien durch. Ihre Daten helfen westlichen Pharmafirmen in der Forschung, die im Gegenzug bereit sind, der Mongolei günstige Medikamente zu liefern.
Drängende Patienten
Nach fünf Tagen in der Abgeschiedenheit der westlichen Mongolei und mehr als 500 Screenings treten Dr. Nara und ihr Team die Heimreise in die Hauptstadt Ulaanbaatar an. Zum Abschied und als Zeichen der Dankbarkeit überreicht ihr der Krankenhausdirektor in Altai ein Geschenk: ein Kilogramm Mehl.

Ulaanbaatar: 1,7 Millionen Menschen, 700 000 registrierte Fahrzeuge. Die Hauptverkehrsadern stets verstopft, die Stadt nicht bereit für so viele Bewohner, darum wird in die Höhe gebaut: Wolkenkratzer, Betonklötze und viel verspiegeltes Glas. Auf den Straßen sind viele junge, hippe, gut gekleidete Menschen zu sehen. Ulaanbaatar: schräg, brutal und jedenfalls widersprüchlich.
Hier wartet nicht nur die Auswertung der auf dem Altai-Trip gewonnenen Daten auf Dr. Nara, hier warten auch Tausende Patienten auf ihre Behandlung in der Privatklinik der Onom Foundation, einer von drei auf Leberkrankheiten spezialisierten Kliniken in der mongolischen Hauptstadt.
In Ulaanbaatar findet außerdem das Privatleben statt, das Dr. Nara zur Verfügung steht. Ihr Partner Andreas Bungert, 46, stammt aus dem hessischen Seeheim-Jugenheim, ist Physiker von Beruf und steht für Rückhalt, nicht nur beruflichen, sondern auch seelischen. "Ohne seine Unterstützung könnte ich all das nicht machen. Er hat viel für mich geopfert." Und sich auf ein herausforderndes Leben in der Mongolei eingelassen, als es seine Frau zurückzog in ihre Heimat. Sie erinnerte sich damals an einen eindringlichen Satz ihres Vaters: "Hast du die Möglichkeit, Großes zu tun, tu es!" Ein Jahr wollten sie bleiben, um das Projekt "Gesunde Leber" zu starten, bis es zum Selbstläufer wird. Das ist nun neun Jahre her.

Im vierten Stock des Wohnhauses duftet es nach frisch gebackenem Apfelstrudel und Milchkaffee. Die Fünfzimmerwohnung des mongolisch-deutschen Paars strahlt: weiße Wände, Glas und Holz. Parkettboden, Zentralheizung, ein 3-D-Drucker, außerdem Sofas, Teppiche aus Schafwolle und ein gut gefüllter Kühlschrank. Zwischen mongolischer, englischer und deutscher Literatur stehen Fotorahmen: Bilder aus Nottingham, wo Dr. Nara und ihr Mann sich während des Studiums kennenlernten. Und von ihrer mongolischen Hochzeit. Von den Söhnen, Temuleen und Nomuun, die in einer anderen Mongolei aufwachsen als ihre Mutter.
Bruch mit patriarchalen Strukturen
In ihrem Zuhause in Ulaanbaatar treffen Welten aufeinander, nicht immer frei von Reibungen. Das Paar bricht mit den geschlechterspezifischen Regeln in der patriarchalen Mongolei. Während sie durchs Land reist oder zu internationalen Konferenzen fliegt, forscht und Geld nach Hause bringt, kümmert Andreas Bungert sich um die Kinder und den Haushalt und erledigt die Einkäufe.
"Für hiesige Verhältnisse bin ich eine furchtbare Ehefrau", scherzt Dr. Nara und schielt zu dem Foto ihrer verstorbenen Großmutter, die stolz zurücklächelt. "Aber meine Freundinnen beneiden mich. Machst du mir einen Kaffee, Andreas?" Ihr Ehemann lächelt müde mit. "Nara scheut keine Konflikte und eckt schon manchmal an", sagt Bungert, "beruflich wie auch privat. Aber sonst würde auch nichts in Bewegung kommen."
Dennoch ergänzt sich das Paar, zieht an einem Strang, arbeitet gemeinsam an Anträgen für wissenschaftliche Förderungen, diskutiert Projektvorschläge für die Regierung, analysiert Daten aus aktuellen Studien. Dazwischen besprechen sie das Wochenendprogramm für die Kinder: Ballett, Karaoke, koreanisches Restaurant. "Was uns verbindet: Wir sind Streber", sagt Dr. Nara.
Als sie zusammen mit ihren Brüdern die erste klinische Studie im Land durchführen wollte, wurde die Onom Foundation vom mongolischen Geheimdienst beobachtet, und Dr. Nara, als CEO der Organisation, erhielt anonyme Drohanrufe. Über die Gründe kann sie nur spekulieren: Vielleicht weil die Geschwister ihre Fähigkeiten im Ausland erworben hatten? Vielleicht aus persönlichem Neid Einzelner, die das revolutionäre Vorhaben verhindern wollten? Oder weil eine Frau, ihre Stimme und ihr Wirken in der Mongolei kein Gewicht haben sollten?

Schließlich initiierte die Onom Foundation ein Treffen mit den maßgeblichen Leuten im mongolischen Gesundheitswesen. Mit dabei auch eine Staatssekretärin, die sich gegen die klinische Studie sperrte. Und die Dr. Nara eröffnete, dass die Regierung ihren Masterplan übernehmen und selbst durchführen wollte. Naranbaatar Dashdorj, Dr. Naras Bruder, saß damals direkt neben seiner Schwester und erinnert sich an das Treffen, als wäre es gestern gewesen: Der Raum war voll, alle kamen zu Wort. Alle bis auf Nara, die – trotz aufzeigender Hand – mehr als eine Stunde lang "übersehen" wurde. Irgendwann knallte sie ihre Faust auf den Tisch und brüllte: "Ich bin die Hauptverantwortliche dieses Projekts, ich weiß, wovon ich spreche, im Gegensatz zu euch. Ohne mich gäbe es noch nicht mal die Blaupause. Also hört mir gut zu: Ohne mich könnt ihr gar nichts machen!"
Stille im Raum. Alle erstarrten und blickten entsetzt um sich, so erzählt es ihr Bruder. "Ich dachte, jetzt ist alles verloren", sagt er. Die Ministerin war schockiert. Die Vizeministerin versuchte, zu intervenieren: "Das ist respektloses Verhalten!" "‚Halten Sie den Mund!‘, antwortete meine Schwester und redete sich in Rage. ‚Ihr wollt mein Projekt klauen, für das ich so hart gearbeitet habe? Niemand außer mir in diesem Land kann das umsetzen. Wenn ich hier rausgehe, ist das Ding gelaufen."
"Vieles frustriert mich noch"
Die Stimmung blieb angespannt, bis einige Mediziner sich auf Dr. Naras Seite schlugen und der Ministerin Vorwürfe machten. Es dauerte nicht lange, und alle Augen richteten sich auf die Staatssekretärin. "Sie hat gelogen", sagte Dr. Nara. "Sie hat mir gedroht, und sie hat mich vom Geheimdienst beobachten lassen. Weil ich unserem Land einen Dienst erweisen möchte?" Schließlich beauftragte die Ministerin die Onom Foundation mit der Studie. Und feuerte die Staatssekretärin. Die erste dreiphasige Studie in der Geschichte der Mongolei konnte starten.

"Vieles frustriert mich noch", bekennt Dr. Nara, "und ich frage mich oft, ob ich nicht in das gemütliche Leben in Europa zurückkehren soll." Denn trotz des Andrangs in den Kliniken gibt es immer noch etliche Patientinnen und Patienten, die ihre Hilfe nicht in Anspruch nehmen, weil sie nicht erreicht werden können. Nach wie vor stecken sich Neugeborene bei ihren unbehandelten Müttern an. Handelt die Regierung oft langsam und ineffizient. Werden Pläne verworfen und Abmachungen ignoriert: Krankenhäuser halten sich nicht an mühsam ausgearbeitete Richtlinien zur Behandlung. Apotheken in Altai führen Medikamente nicht, die in der Hauptstadt problemlos erhältlich sind. Und, globaler gesehen: Hepatitis bekommt nicht die Aufmerksamkeit wie beispielsweise Aids, dabei bräuchte es die, um wirkungsvollere Medikamente entwickeln zu können. In der Mongolei sorgt immerhin Dr. Nara für Aufsehen: "Irgendeine muss es ja tun", sagt sie und lacht.
Das Liver Centre der Onom Foundation befindet sich mitten im Finanzdistrikt von Ulaanbaatar, in einem Betondschungel aus Wolkenkratzern, Shoppingmalls und Hotelburgen. Im zweiten Stockwerk eines verspiegelten Bürogebäudes liegen Behandlungsräume und das Labor, in dem täglich im Schnitt 60 Hepatitis-Tests analysiert, DNA sequenziert und Viruslasten ausgewertet werden. Überall stehen Hightech-Geräte, Werkzeuge für ein multifunktionales Team: 35 Fachleute für Molekular- und Zellbiologie, für Hepatologie und für Infektionskrankheiten treiben das Projekt voran. Pflanzen und einige Kinderzeichnungen aus einem Malwettbewerb zum Thema "Leber" sorgen für Farbe in der Klinik. Einen Stock höher, angrenzend an ein Nagelstudio: Dr. Naras Büro. Das Fenster, mit Klebestreifen abgedichtet, lässt auf eine Baustelle blicken, unten wütender Verkehr auf einer vierspurigen Straße. Auf dem Schreibtisch stapeln sich Dokumente, Anträge, wissenschaftliche Artikel. Drei Patienten warten bereits vor der Glastür. Komplizierte Fälle.
Etwa Erkhbayar Batkhuu, 37. Ein großer Mann mit Brille und militärischem Kurzhaarschnitt, verheiratet, ein Kind. Ein Mann, der lange nachdenkt, bevor er antwortet. Während einer Routineuntersuchung im Jahr 2011 wurde bei ihm Hepatitis B diagnostiziert. Keinerlei Symptome, keine Schmerzen. Im Februar 2024 dann die Hiobsbotschaft: Hepatitis D. Seitdem ist er bei Dr. Nara in Behandlung. "Ich weiß nicht, wo ich mich infiziert habe", sagt er beinahe entschuldigend.

Dr. Nara hofft, ihren Patienten aufnehmen zu können in ein experimentelles Therapieprogramm, in dem Batkhuu mindestens drei Jahre lang täglich eine kostenlose Spritze bekommen würde. Ein Hoffnungsschimmer für ihn und für 136 andere Auserwählte, zumindest ein kleiner. Von einer Heilung kann auch danach noch nicht die Rede sein, nur von einer Unterdrückung der Hepatitis-D-Viren. "Täglich eine Spritze oder in zehn Jahren sterben", sagt er, "da muss man nicht lange nachdenken." Die Kosten der Behandlung, rund 800 Euro pro Monat, könnte Batkhuu nicht tragen, obwohl er für ein ausländisches Bergbauunternehmen arbeitet, das in der Wüste Gobi Kupfer und Gold schürft.
"In Europa würde man ihn mit derartigen Werten sofort auf die Liste für ein solches Programm setzen", sagt Dr. Nara, "aber hier gibt es sogar Patienten, denen es weitaus schlechter geht. Doch im Moment werden nur die VIPs der Mongolei für die Behandlung aufgenommen. Was sind die Kriterien?, frage ich dann. Die Gesundheit der Patienten oder ihr Bekanntheitsgrad?" Dr. Nara wird das diskutieren. Mit Geduld. Wenn es sein muss, auch mit einem Knall.
Diese Recherche wurde unterstützt vom Memento-Medienpreis für vernachlässigte Krankheiten.