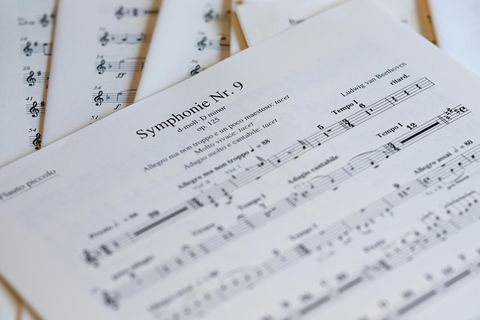Heute steht der Name MP3 synonym für digitale Audiodaten. Musikstreaming oder Podcasts wären ohne die Entwicklung des Formats "MPEG Audio Layer 3" nicht denkbar gewesen, für das am 14. Juli 1995 ein Team um den Elektrotechnik-Ingenieur Karlheinz Brandenburg im Fraunhofer Institut in Erlangen das dreistellige Kürzel MP3 wählte, weil das damals gängige Betriebssystem Windows 3.1 es so verlangte.
Bereits seit 1982 hatten Mitarbeiter des Instituts unter der Leitung von Hans Georg Musmann an der Möglichkeit geforscht, Audiodaten durch Kompression zu verkleinern. Es ging darum, Musikdateien in ordentlicher Qualität über eine digitale Telefonleitung (ISDN) zu übertragen. Über die Tragweite der Forschung war sich das Team vermutlich nicht im Klaren.
Der neue Standard beeinflusste den Musikkonsum von Milliarden. Die Entwicklungsarbeit von Brandenburg und Forschern wie Heinz Gerhäuser, Harald Popp, Stefan Krägeloh, Harmut Schott, Berhard Grill, Ernst Eberlein sowie Thomas Sporer erneuerte nicht nur die Rundfunktechnik grundlegend, sondern leitete in der Musikindustrie das Ende der Compact Disc (CD) ein. Der Einfluss hält bis heute an: ob beim Streaming, im Digitalradio, im digitalen Fernsehen oder bei Videotelefonaten – überall wird eine Form des MP3-Nachfolgers AAC eingesetzt.
Erkenntnisse aus der Psychophysik
Seit den 1980er-Jahren hatten sich die Forschenden Erkenntnisse der Psychoakustik zunutze gemacht: Nicht alle Parameter der Musik und somit nicht die komplette Datenmenge sind für unser Hörerlebnis wirklich von Bedeutung. So lassen sich bei der MP3-Enkodierung etwa Signalanteile in Frequenzbereichen, die das menschliche Ohr weniger genau wahrnimmt, mit weniger Präzision darstellen. Andere Töne werden nur gerade so genau (mit so vielen Bits) abgespeichert, dass das durch die Komprimierung entstehende Rauschen noch verdeckt wird und somit nicht hörbar ist. So kann eine Musikdatei auf etwa ein Zehntel ihrer ursprünglichen Größe schrumpfen. Musik lässt sich objektiv verlustbehaftet komprimieren, ohne dass der Klang für die meisten Menschen merklich schlechter wird.
Bis dahin war es allerdings noch ein weiter Weg. Bis der Klang einer MP3-Datei nur halbwegs mit dem Sound einer CD oder Schallplatte mithalten konnte, mussten die Forscher unzählige Stunden experimentieren. "Einfache Stücke, komplexe Stücke, Musik aus allen Genres, querbeet", erinnerte sich Brandenburg 2020 in einem Zeitungsinterview. "Wir wussten ja nicht, was funktionieren würde und, noch wichtiger, was nicht."
Herausforderung der puren menschlichen Stimme
In einer Hifi-Zeitschrift hatte Brandenburg gelesen, dass deren Techniker hochwertige Anlagen mit einem Acapella-Song der New Yorker Künstlerin Susan Vega testeten: "Tom’s Diner". Er war neugierig, was sein Algorithmus, der Vorläufer von MP3, mit diesem vermeintlich einfachen Musikstück machen würde. Doch "das Ergebnis war erschütternd. Die Stimme von Suzanne Vega klang ganz heiser, und sie schien mit sich selber ein Duett zu singen. Wirklich schlimm," wie er in einem Zeitungsinterview bekannte. Es habe lange gebraucht, um zu verstehen, warum. Brandenburg hörte sich den Song Tausende Male an, um seinen Algorithmus zu verbessern. Ein Ansatz dabei war, die tieferen Frequenzen viel genauer zu übertragen als die höheren, um Speicherplatz zu sparen.
Noch heute bestreiten Musik-Puristen die Qualität der MP3-Kompression. Miterfinder Brandenburg kann die Kritik am Original-MP3 noch nachvollziehen. Die neuen MP3-Codes wie AAC seien bei höheren Datenraten aber inzwischen so gut, dass sie vom menschlichen Ohr nicht von analogen Soundübertragungen etwa von Vinyl-Schallplatten zu unterscheiden seien. Das hätten Blindtests mit geübten Hörern erwiesen.
Vom "Rippen" zum Standard
Eigentlich wollte das Fraunhofer-Institut die Software zur Umwandlung in MP3 an Entertainmentfirmen lizenzieren. Doch ein australischer Student durchkreuzte den Plan: 1997 erwarb er mit einer gestohlenen Kreditkartennummer die Encoder-Software und stellte das Programm frei verfügbar ins Netz. Schnell wurde das "Rippen" von CDs – also das Umwandeln in MP3-Dateien – allgegenwärtig. Vor allem die Online-Tauschplattform Napster schadete ab 1999 der Musikindustrie und den Künstlerinnen und Künstlern enorm. Die Software erlaubte es Millionen von Nutzern, ihre MP3-Dateien miteinander zu teilen. Ganze Plattensammlungen ließen sich plötzlich mit wenigen Klicks verbreiten. Napster machte das MP3-Format zum weltweiten Standard für digitale Musik – und ebnete den Weg für legale Musikdienste und die Digitalisierung der gesamten Branche.
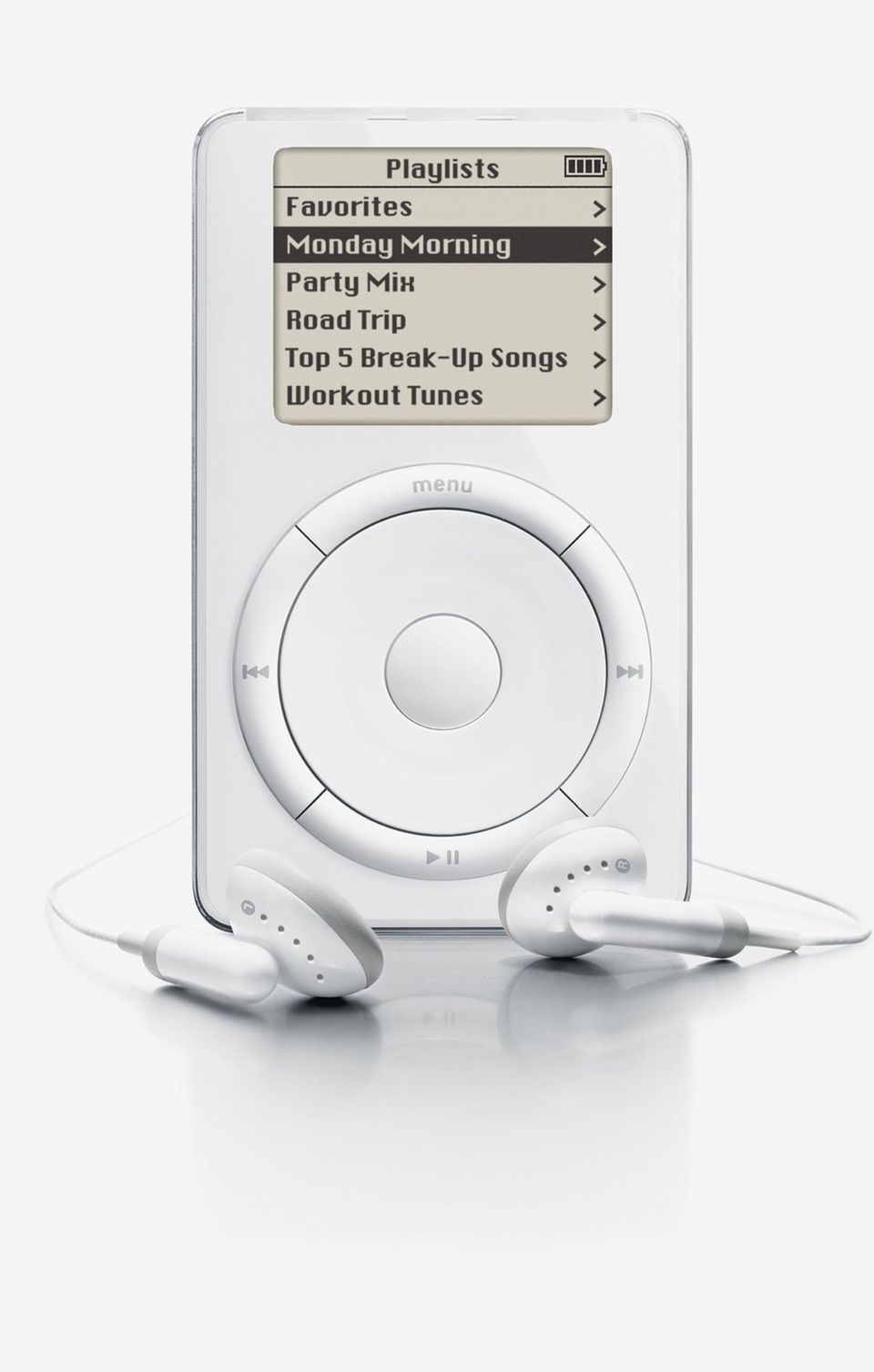
Denn das zwang die Musikindustrie, sich mit digitalen Vertriebswegen auseinanderzusetzen – mit dem iPod (2001) und den iTunes Music Stores (ab 2003) sowie legalen Streamingdiensten wie Spotify ab 2008 erholte sich die Branche langsam wieder. Das große Geschäft machten die kommerziellen Anwender der MP3-Technologie, die Hersteller von MP3-Playern wie Apple oder Sony. Apple erzielte mit dem iPod geschätzt 60 bis 70 Milliarden US-Dollar Umsatz und einen Gewinn von mindestens 15 Milliarden Dollar.
Auch an seinen Erfindern, am Fraunhofer Institut und der deutschen Wirtschaft ging der kommerzielle Erfolg nicht vorbei. Schon die ersten MP3-Chips für Abspielgeräte wurden 1994 in Freiburg produziert. Karlheinz Brandenburg schätzt, dass sein damaliger Arbeitgeber, die Fraunhofer-Gesellschaft, 50 bis 100 Millionen Euro jährlich an Gebühren von Lizenznehmern kassiert hat, bis 2017 das letzte MP3-Patent in den USA auslief. Insgesamt hätten alle Technologien rund um MP3 mindestens eine halbe bis eine Milliarde Euro an Einnahmen gebracht. Und bis heute findet sich im iPhone der Hinweis, dass die Audio-Coding-Technologie MPEG Layer-3 von Fraunhofer IIS lizenziert wurde.