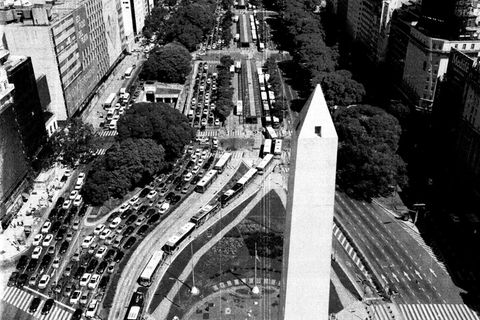Oktyabr Dospanov erinnert sich genau an die Zeit, bevor das Wasser verschwand. Daran, wie er die Vögel am grünen Ufer des Aralsees beobachtete, am Strand vor der Haustür in die Wellen sprang, die vielen Schiffe an den Piers bestaunte. 100.000 Menschen lebten damals in Muynak, und fast alle arbeiteten in der Fischindustrie: Frühmorgens fuhren sie mit dem Kutter auf den Aralsee hinaus und warfen die Netze aus. Nachmittags verkauften sie den massenhaft gefangenen Fisch auf dem Markt, verarbeiteten ihn bis in die Nacht in einer der Fischfabriken oder verpackten ihn in Konserven. Dreimal pro Woche startete in Muynak ein Flugzeug in die usbekische Hauptstadt Taschkent. Schulklassen aus der ganzen Sowjetunion reisten an, um sich am fruchtbaren Ufer des Aralsees zu erholen.
Man sagt, New York sei die Stadt, die niemals schläft. Doch wenn man den Erzählungen von Dospanov lauscht, dann trifft diese Beschreibung ebenso gut auf das Muynak der 1960er-Jahre zu.
Wer heute am Hafen von Muynak sitzt, blickt in eine sandige Einöde. Skelette von Fischerbooten liegen in Reih und Glied auf dem staubigen Boden, als warteten sie nur darauf, in See zu stechen. Dabei sind sie von Rost zerfressen, Jugendliche vieler Generationen haben Liebesschwüre auf ihrem Rumpf hinterlassen, längst hat der Sand der Wüste seinen Weg in ihr Inneres gefunden. Ihr Zustand ist die Folge der einst unter Josef Stalin beschlossenen Intensivierung des Baumwollanbaus in Zentralasien: Die Zuflüsse des Aralsees wurden angezapft und in Bewässerungskanäle für Baumwoll- und Reisfelder entlang der Flussläufe umgeleitet – nur noch Rinnsale drangen zum Aralsee durch und konnten die Verdunstung nicht ausgleichen. Der See trocknete aus und schrumpfte. Inzwischen ist das Ufer 80 Kilometer vom Hafen von Muynak entfernt. Die meisten Menschen haben die Stadt verlassen. Und nirgendwo ein Tropfen Wasser.
Dafür Musik. Wummernde Techno-Beats hallen durch die Wüste, werden vom heißen Wind über die Schiffsgerippe hinweg getragen. Eine gigantische Diskokugel wirft das Licht der untergehenden Sonne zurück, Menschen mit bunten Zöpfen und metallisch-glänzenden Tops tanzen im zuckenden Stroboskoplicht.

Einmal im Jahr pilgern Techno-Fans aus ganz Zentralasien zum Stihia-Festival nach Muynak in die autonome Republik Karakalpakistan im Westen Usbekistans. Am Fuß des Leuchtturms der einst pulsierenden Fischereimetropole treffen sie auf jene Menschen, die geblieben sind, als das Wasser verschwand. Dann wird vor vier Bühnen getanzt, in Jurten gezeltet, auf Podien und in wissenschaftlichen Vorträgen über Ökologie diskutiert. Das Festival soll an die Umweltkatastrophe erinnern, die hier noch immer Menschen tötet und im Rest der Welt in Vergessenheit geraten ist. Besucher und Besucherinnen zurückbringen in eine Region, die fast alles verloren hat, außer ihrem Optimismus. Und soll vor allem: Spaß machen.