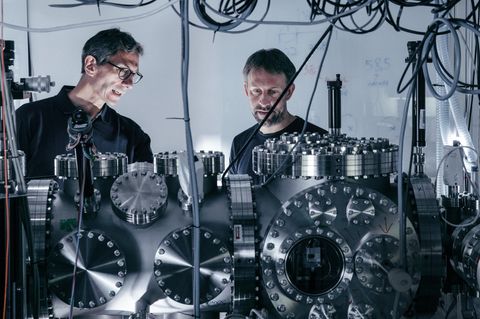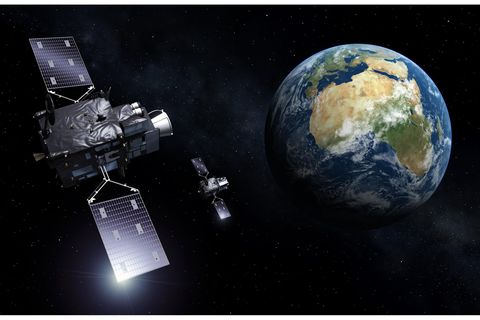Er kann ganze Täler verschlucken, Wälder in Bühnenkulissen verwandeln und Autobahnen in Geisterstrecken. Nebel ist eines der alltäglichsten und zugleich geheimnisvollsten Wetterphänomene. Seit jeher ranken sich Geschichten um diesen flüchtigen Schleier: In den Mooren Mitteleuropas, so glaubte man einst, schwebten Geister zwischen den Welten. Und wer im Harz das "Brockengespenst" sah – einen überlebensgroßen Schatten, der wie ein Spukbild aus dem Nebel stieg –, dem wurde bang. Heute weiß man: Es war der eigene Schatten auf der Nebelwand, durch Streuung verzerrt. Der Zauber ist entschlüsselt und bleibt doch faszinierend.
Wie entsteht Nebel? Feinste Partikel spielen eine wichtige Rolle
Meteorologisch betrachtet ist Nebel nichts anderes als eine bodennahe Wolke, ein feines Gemisch aus winzigen Wassertröpfchen oder Eiskristallen, die in der unteren Luftschicht schweben. Er entsteht durch Kondensation: Wenn die Temperatur der Luft unter den Taupunkt sinkt, kann sie den in ihr enthaltenen Wasserdampf nicht mehr halten, das gasförmige Wasser schlägt sich als Flüssigkeit nieder.
Doch damit diese Tröpfchen überhaupt entstehen können, braucht es winzige "Kondensationskerne", Staubpartikel, Pollen oder Aerosole, an denen sich die Wassermoleküle anlagern. Millionen solcher mikroskopischer Tropfen brechen das Licht in alle Richtungen. Ein Effekt, der als Mie-Streuung bekannt ist und das diffuse, milchige Aussehen des Nebels erklärt.
Nebel bildet sich, wenn die Luft gesättigt ist und sich zusätzlich Wasserdampf ansammelt – oder wenn sie einfach stark abkühlt. Man unterscheidet drei grundlegende Entstehungsmechanismen:
- Abkühlung unter den Taupunkt,
- Zufuhr von Wasserdampf durch Verdunstung,
- Vermischung unterschiedlich warmer und feuchter Luftmassen.
Oft wirken mehrere dieser Prozesse gleichzeitig. Entscheidend ist immer, dass sich genug Kondensat bildet, um die Sicht spürbar zu trüben.
Wann ist es Nebel – und wann nur Dunst?
Nicht jede diesige Luft gilt als Nebel. Erst wenn die Sichtweite unter einen Kilometer sinkt, spricht man offiziell davon. Reicht der Blick noch weiter – etwa vier bis acht Kilometer – und liegt die Luftfeuchte über 80 Prozent, ist meist von Dunst die Rede. Besonders dichter Nebel kann die Sichtweite auf unter 50 Meter reduzieren, mit entsprechenden Gefahren im Straßenverkehr. Bei weniger als 100 Meter Sichtweite sprechen Meteorologinnen und Meteorologen von "hochnebelartigem Nebel", bei unter 50 Metern von "dichtem Nebel".
Je nach Ursache unterscheidet man verschiedene Nebelarten:
- Strahlungsnebel ist eine Nebelform, die in klaren, windstillen Nächten entsteht: Die Erde strahlt Wärme ab, der Boden kühlt aus und mit ihm die feuchte Luft darüber. Wenn sie den Taupunkt erreicht, bilden sich Tröpfchen. Dieser Typ tritt besonders häufig in Herbstnächten und in Senken oder über Mooren auf.
- Advektionsnebel entsteht, wenn warme, feuchte Luft über eine kühle Fläche zieht – etwa über eine ausgekühlte Landschaft oder kaltes Wasser. Dabei kühlt sich die Luft ab, Nebel entsteht. Besonders an Küsten oder im Winter ist dieser Nebeltyp häufig.
- Hebungsnebel, auch orographischer Nebel genannt, tritt auf, wenn feuchte Luft gezwungen wird, an Gebirgshängen aufzusteigen. Dabei dehnt sie sich aus und kühlt ab. Es bilden sich Wolken, die den Boden berühren und als Nebel erscheinen.
- Verdunstungsnebel oder Dampfnebel entsteht, wenn zusätzlicher Wasserdampf in die Luft gelangt, etwa von einer warmen Wasseroberfläche an einem kalten Morgen. Die feuchte, warme Luft trifft auf kalte Umgebungsluft – Tröpfchen entstehen.
- Mischungsnebel entsteht, wenn unterschiedlich warme und feuchte Luftmassen aufeinandertreffen. Auch der Atem an einem kalten Tag ist ein Beispiel für einen solchen Mischungsnebel: Warme, feuchte Luft aus den Lungen trifft auf kalte Außenluft: ein Mini-Nebel entsteht.
- Eisnebel ist eine Nebelform, die sich bei extremer Kälte bildet, wenn der Wasserdampf direkt zu Eiskristallen kondensiert. Vor allem in Polarregionen oder kontinentalen Wintern kann man ihn beobachten – ein glitzerndes Gespinst aus feinsten Kristallen.
Warum Nebel weiß erscheint
Ein einzelner Nebeltropfen ist winzig, oft nur wenige Tausendstel Millimeter groß. Für das Auge unsichtbar. Doch zusammen streuen sie das Licht in alle Richtungen. Anders als bei Regenbogen oder bläulichem Himmel, bei denen bestimmte Wellenlängen bevorzugt werden, streuen Nebeltropfen alle sichtbaren Farben gleichmäßig. Deshalb erscheint Nebel weißlich oder hellgrau – ein diffuses Leuchten aus Licht und Wasser.
Dass Nebel besonders im Winter erscheint, liegt daran, dass die Sommersonne die Schleier meist schon am Vormittag vertreibt. In der kühlen Saison dagegen wabern sie teils tagelang über den Boden. Der Grund ist die tief stehende Sonne, die wenig Energie liefert, sowie Inversionslagen: Dabei liegt kalte Luft in Bodennähe, darüber wärmere Luft – ein stabiles, "deckelartiges" System. Ohne Luftaustausch kann sich der Nebel nicht verflüchtigen, sondern bleibt wie festgehalten in einer Schüssel.
Nebel als Segen: Wenn der Dunst zur Quelle wird
Sosehr wir Nebel mit nassen Novembertagen in Europa verbinden: Auch in den trockensten Regionen der Erde spielt er eine zentrale Rolle. In Küstenwüsten wie der Namib oder Teilen der Atacama entsteht häufig Nebel, wenn kühle Meeresluft auf heiße Landmassen trifft. Und diese Nebelhäufigkeit sichert Leben: So klettert der Schwarzkäfer frühmorgens auf Dünenkämme, reckt seinen Leib in die Höhe und senkt das Köpfchen: Auf seinem Rücken sammelt sich Kondenswasser, das in die Mundöffnung läuft und den Insektenkörper mit Feuchtigkeit versorgt. Man nennt den schwarzen Wüstenbewohner auch Nebeltrinker-Käfer.
Der Nebel, einst als unheilvoller Schleier angesehen, mysteriös, geisterhaft, er ist also nicht bloß ein physikalisch erklärbares Phänomen. Sondern in manchen Gefilden auch ein Lebenselixier.