Wer klein ist, muss erfinderisch sein. Das gilt in der Natur für viele Arten, besonders aber für mikroskopisch kleine Winzlinge wie den Fadenwurm Steinernema carpocapsae: Er ist nur so lang wie eine Nadelspitze breit und lebt im Boden – macht aber als parasitäres Raubtier Jagd auf deutlich größere, sogar fliegende Beute. Mehr noch, er ist auf sie angewiesen, um weiterleben und sich fortpflanzen zu können.
Der unsegmentierte Fadenwurm ist fast überall im Boden zu finden und lebt in Symbiose mit einem Bakterium. Als Jäger aus dem Hinterhalt wartet der Wurm aufgerichtet auf seinem Schwanz sitzend geduldig auf seine Beute. Nähert sich ein Insekt, stürzt er sich auf dieses, dringt durch eine natürliche Körperöffnung in das Tier ein und setzt dort die Bakterien ab, die die Körperabwehr des Wirts überwinden. Binnen 48 Stunden ist das Insekt tot – und S. carpocapsae hat mit dem verwesenden Gewebe seines Kadavers nicht nur Nahrung in Hülle und Fülle, sondern auch eine Brutstätte für nachfolgende Generationen.
Ein Befall bedeutet für das Insekt also den sicheren Tod – und einen Triumph auf ganzer Linie für den Fadenwurm. Doch wie kann der Winzling vom Boden aus selbst fliegende Beute so zielsicher ansteuern?
Forscher aus den USA haben dafür eine verblüffende Erklärung gefunden: Zwischen Jäger und Beute besteht eine tödliche Anziehungskraft. Der Wurm am Boden lässt sich mithilfe elektrischer Ladung von einem Insekt, etwa einer Fliege, ansaugen. Dadurch kann der Wurm das 25-fache seiner Körperlänge überbrücken und sich beispielsweise an eine Fliege heften, berichten die Forscher aus Atlanta und Berkeley in der Fachzeitschrift PNAS. Zum Vergleich: Ein Mensch müsste ein zehnstöckiges Gebäude überspringen, um an den Satz des Wurmes heranzureichen.
Jäger und Beute ziehen sich elektrisch an
"Wir haben den elektrostatischen Mechanismus identifiziert, den dieser Wurm nutzt, um sein Ziel zu treffen. Und wir zeigen, wie wichtig dieser Mechanismus für das Überleben des Wurms ist", sagt Studienautor Justin Burton von der Emory University in Atlanta in einer Mitteilung der Universität. "Eine höhere Spannung in Kombination mit einem leichten Windhauch erhöht die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass sich ein springender Wurm an einem fliegenden Insekt festklammern kann."
Der Mechanismus dahinter: Die Flügelschläge eines Insekts reiben an Ionen in der Luft und erzeugen so eine Ladung von mehreren hundert Volt. Durch elektrostatische Induktion löst diese eine entgegengesetzte, ähnlich hohe Ladung in dem am Boden lauernden Wurm aus – Jäger und Beute ziehen sich also elektrisch an.
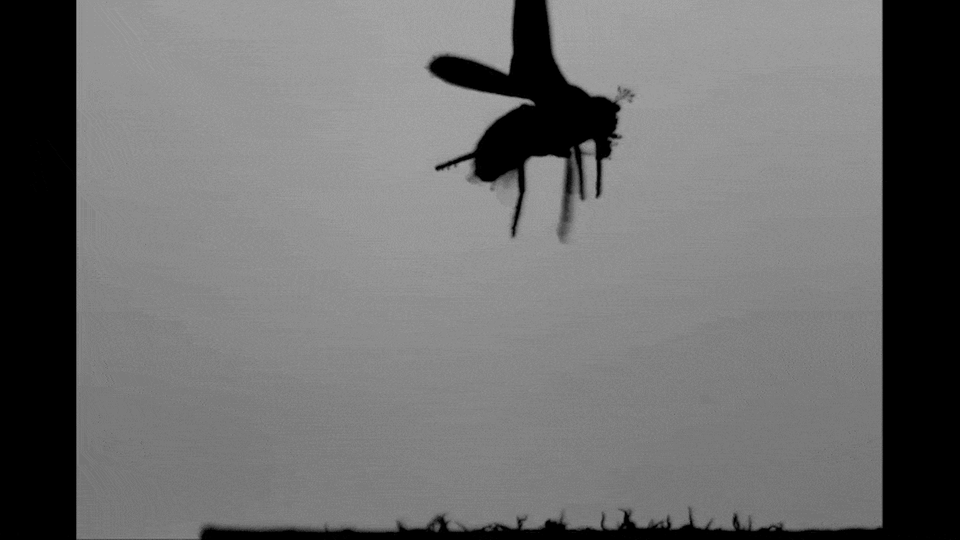
Um ihre These zu beweisen, befestigten die Forscher einen winzigen, mit einer Hochspannungsquelle verbundenen Draht am Rücken von Fruchtfliegen, um deren Spannung zu messen. Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera zeichneten sie dann die Sprünge der Würmer auf. Deren Bewegungsbahnen wurden anschließend mithilfe einer Software digitalisiert und analysiert. Das Ergebnis: Bei einer Ladung von nur 100 Volt erreichten die Würmer ihre Beute in weniger als zehn Prozent der Sprünge. Bei 800 Volt – einer Ladung, wie sie häufig bei fliegenden Insekten zu finden ist – erhöhte sich die Trefferquote der Würmer auf 80 Prozent.
"Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Entwicklung dieses Raubverhaltens bei den Würmern ohne Elektrostatik keinen Sinn ergibt", schreiben die Forschenden. Schließlich ist der Sprung für den Wurm nicht nur kräftezehrend, sondern er geht auch das Risiko ein, in der Luft gefressen zu werden oder auszutrocknen. Eine hohe Erfolgsquote ist für den Wurm deshalb unabdingbar. Und die hat der Wurm dank seiner geschickten Jagdstrategie definitiv: Weil er so effektiv Jagd auf Insekten macht, die wiederum Pflanzen befallen, wird er von Landwirtinnen und Gärtnern gezielt als biologisches Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt.
Statische Elektrizität, wie wir sie etwa auch spüren, wenn wir mit unseren Fingern über einen Wollpullover reiben und dann eine Metalltürklinge fassen, spielt in der Natur übrigens immer wieder eine Rolle: Co-Studienautor Victor Ortega-Jiménez hatte beispielsweise schon 2013 entdeckt, dass auch Spinnennetze die Ladung fliegender Insekten nutzen, um diese im Flug elektrostatisch anzuziehen.
"Man könnte erwarten, dass große Entdeckungen bei großen Tieren gemacht werden", sagt er. "Aber auch die kleinen Tiere bergen viele interessante Geheimnisse."





























